Der Umweltminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Rote Liste. der gefährdeten Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns
|
|
|
- Cathrin Klein
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Der Umweltminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern Rote Liste der gefährdeten Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns
2 Herausgeber: Verfasser: Fotos: Titelfoto: Rücktitel: Herstellung: Papier: Der Umweltminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern Schloßstr. 6-8, Schwerin Wachlin, Volker, Clara-Zetkin-Str. 9, Greifswald Röbbelen, Frank: Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Titelfoto, Rücktitel Der Große Feuerfalter Lycaena dispar - in vielen Ländern Westund Mitteleuropas bereits ausgestorben oder vom Aussterben bedroht - findet in den ausgedehnten Flußtalmooren und auf (kleinseggenreichen) Feuchtwiesen vor allem im vorpommerschen Gebiet noch stellenweise ausreichenden Lebensraum. Dennoch ist auch bei dieser Art ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, so daß sie insgesamt als stark gefährdet gilt. Struktur- und blütenreiche extensiv genutzte Feuchtwiesen und - weiden sind heute sehr selten geworden, sie sind die letzten Rückzugsgebiete für zahlreiche, ehemals weit verbreitet vorkommende Tagfalterarten der Feuchtbereiche. Goldschmidt Druck GmbH, Schwerin 1993 Umschlag chlorfrei gebleicht Inhalt 100% Recycling
3 ROTE LISTE der gefährdeten Tagfalter / Mecklenburg-Vorpommerns 1. Fassung Stand: November 1993 Bearbeiter: Volker Wachlin unter Mitarbeit von Uwe Deutschmann Axel Kallies Heinz Tabbert
4 INHALT 1. Einleitung 2. Gefährdungskategorien 3. Gefährdungsursachen 4. Liste der gefährdeten Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns 5. Checkliste der Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns 6. Bilanz und Bewertung 7. Literatur
5 4
6 1. Einleitung Die Tagfalter werden gemeinhin zu den am besten bearbeiteten Tiergruppen gerechnet, haben sie doch aufgrund ihrer i.a. relativ leichten Ansprechbarkeit im Gelände und ihrer attraktiven äußeren Erscheinungsform seit jeher eine Vielzahl von Interessenten und Bewunderern gefunden. Dennoch bleibt festzustellen, daß es für Mecklenburg-Vorpommern keine grundlegende faunistische Bearbeitung jüngeren Datums gibt. So konstatierte REINHARDT (1982) einen nur durchschnittlichen Durchforschungsgrad für unser Gebiet, wobei aus einigen Kreisen überwiegend nur alte Angaben aus der Literatur Vorlagen. Auch nachfolgende Untersuchungen in den 80er Jahren im Rahmen der Erhebungen zur Tagfalterfauna der DDR ergaben für die ehemaligen drei Nordbezirke eine vergleichsweise geringe Beobachtungsintensität. Dem stehen seit Beginn der 90er Jahre zum Teil sehr umfangreiche Kartierungsarbeiten im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen für Straßenneubauvorhaben gegenüber, die die Kenntnislücken weitgehend aufgefüllt haben. Die vorliegende Analyse berücksichtigt sämtliche Arten, die gegenwärtig zur Fauna des Landes gezählt werden können. Grundlage dafür ist einerseits die faunistische Literatur (BOLL 1850; SCHMIDT 1879; PAUL & PLÖTZ 1872/ 80; SPORMANN 1907/09; PFAU 1928; URBAHN 1939; FRIESE 1956; REINHARDT & KAMES 1982, REINHARDT 1983, 1985, 1989 und zahlreiche Arbeiten lokalen Charakters) sowie andererseits die langjährige Tätigkeit vieler Hobbyentomologen, die im Rahmen der Arbeiten an der Fauna der DDR und weiterführend der Fauna Mecklenburg-Vorpommerns wesentliche Ergebnisse zusammengetragen und zur Verfügung gestellt haben. Ihnen allen gilt an dieser Stelle ausdrücklicher Dank. Ebenso sei hier Herrn Rolf Reinhardt, Mittweida, für seine Unterstützung und bereitwillige Überlassung der im Rahmen der DDR-Fauna zusammengeflossenen Informationen über die Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns gedankt. Seit 1990 wird die faunistische Arbeit durch den Landesfachausschuß Entomologie im Rahmen des Naturschutzbundes Deutschland weitergeführt, so daß insgesamt auf ein recht umfangreiches und größtenteils aktualisiertes Datenmaterial zurückgegriffen werden kann.
7 2. Gefahrdungskategorien Rote Listen haben sich einen festen Platz in Theorie und Praxis von Naturschutz und Landschaftsplanung erobert. Eine Untersuchung zur Tier- und Pflanzenwelt, ein Gutachten über mögliche Auswirkungen eines geplanten Eingriffes auf den Naturhaushalt ist heutzutage ohne die Verwendung entsprechender Roter Listen undenkbar. Sie sind damit zu einem politischen Instrument zur Naturschutzargumentation geworden, das einerseits als Entscheidungshilfe für Politiker und Behörden und andererseits als Mahnung an die Öffentlichkeit, das Bewußtsein für die Notwendigkeit von Natur- und Artenschutz ständig wachzuhalten, zu verstehen ist (BLAB et al. 1977, 1984). Dies ist zweifellos schon weitgehend erreicht und kann als Fortschritt gewertet werden. Dennoch sind bis heute die kritischen Stimmen nicht versiegt (KUDRNA 1986, AUHAGEN 1991, u.a.). Auf zwei Aspekte dieser Kritik, die von beachtlicher Relevanz für den praktischen Gebrauch der Roten Listen in der Naturschutz- und Landschaftsplanung sind, soll hier kurz eingegangen werden. 1. Die Beurteilung der Schutzwürdigkeit von Lebensräumen und Natur allgemein darf nicht ausschließlich anhand der Gefährdung der dort vorkommenden Arten im Sinne der Roten Liste erfolgen. In den Roten Listen sind ja nur die besonders gefährdeten oder seltenen Arten enthalten. Den landschaftsökologischen Wert eines Lebensraumes, einer Landschaft kann man aber nicht nur daran messen, vielmehr müssen die lebensraum- bzw. landschaftstypischen Arten stets mit zur Beurteilung herangezogen werden - sie bilden die Masse der vorkommenden Species und damit das eigentliche Artenpotential. Faunistische (und natürlich auch floristische) Untersuchungen sollten also immer das gesamte Artenspektrum einer Gruppe umfassen und möglichst flächendeckend erfolgen'(kein selektives Vorgehen, wie oft aus finanziellen Gründen diktiert!). Auf der Grundlage solcher möglichst umfassenden Untersuchungen lassen sich über die Gefährdung ( Rote Liste ), das Vorhandensein lebensraum- (Indikatorarten) und landschaftstypischer (Repräsentanzarten) Species fachlich fundiertere Aussagen zur Bewertung von Lebensräumen bzw. Landschaftsteilen treffen. 2. Nie aufgehört haben die Diskussionen um die Gefährdungskategorien. In der BRD hat sich seit 1977 ein mehr oder weniger pragmatischer Konsens herausgebildet, der zu einer weitgehend vereinheitlichten Formulierung der Gefährdungskategorien in den Roten Listen geführt hat (obwohl diese dann durchaus auch wieder verschieden interpretiert und angewendet werden). Zweifellos trägt dies zu einer besseren Vergleichbarkeit der verschiedenen Listen bei. Kernpunkt der dennoch vorhandenen Kritik ist dabei der Vorwurf der
8 zu unbestimmten und unvollständigen Definition der Kategorien (s. AUHA GEN 1991). Dies wird besonders deutlich daran, daß in deutschen Roten Listen die Kategorie 4, selten - potentiell gefährdet sehr unterschiedlich angewendet wird und daß die Trennung zwischen stark gefährdet und gefährdet oft nicht nachvollziehbar ist. Darüberhinaus besteht ein Hauptmangel deutscher Roter Listen in der Verwendung einer Ordinalskala für die Gefährdungskategorien, die automatisch eine Rangfolge suggeriert. Dies steht jedoch in krassem Widerspruch zu den tatsächlichen Gegebenheiten. Gerade die Arten der Gruppe 4 - selten, potentiell gefährdet stellen einen naturschutzpolitisch außerordentlich wertvollen Teil der Fauna und Flora dar und sind eine wesentliche Bereicherung der Biozönose - wenn man das Schlagwort von der Artenvielfalt, die Lebensqualität bedeuten soll, ernst nimmt. Natürlich spielt diese Gruppe in der Gesamtbilanz des Naturhaushaltes rein quantitativ eine untergeordnete Rolle - da sind die verbreiteten und häufigeren Arten von viel entscheidenderem Gewicht für dessen Funktionieren. Natur kann jedoch nicht nur quantitativ beurteilt werden, kein noch so ausgeklügeltes Kochrezept ist dazu in der Lage. Deshalb müssen diese seltenen Arten einen ihrer Bedeutung angemessenen Platz in den Bewertungsprozeduren erhalten. Dies ist jedoch mit der in Deutschland bisher gebräuchlichen und auch entsprechend angewendeten Ordinalskala kaum möglich. Deshalb erscheint es dem Verfasser viel sinnvoller, die international üblichen Kategorien und Kriterien zu verwenden. Ansätze dazu sind in einigen jüngeren Veröffentlichungen bereits festzustellen. So verwenden EBERT (1991) und HEINICKE (1993) die Kategorie R - rare, BERG & WIEHLE (1993) fügen eine Kategorie Verbreitung und Gefährdung ungenügend bekannt hinzu und nehmen ebenso wie MÜLLER-MOTZFELD (1992, 1993) eine Zuordnung der deutschen Gefährdungskategorien zu den im IUCN Red Data Book verwendeten vor. Diesem Vorgehen wird im Rahmen dieser Liste gefolgt. Des besseren Verständnisses wegen seien an dieser Stelle die internationalen Kategorien der IUCN wiedergegeben, dazu in Klammem die Bedeutung laut deutscher Roter Liste: Ex - extinct = erloschen (ausgestorben) ehemals autochtone Arten, die trotz intensiver Nachsuche in den letzten 50 Jahren nicht nachgewiesen wurden. E - endangered = gefährdet (vom Aussterben bedroht) Arten, die in Gefahr sind auszusterben und deren Überleben unwahrscheinlich ist, wenn die Ursachen für ihre Gefährdung weiter wirken;
9 d.h. Arten, deren Anzahl (Individuenzahl) auf ein kritisches Niveau gesunken ist oder deren Lebensräume so drastisch reduziert wurden, daß für sie eine unmittelbare Gefahr des Aussterbens besteht. V - vulnerable = schutzbedürftig, empfindlich (stark gefährdet und gefährdet) Arten, die in naher Zukunft der E-Kategorie zugerechnet werden müssen, wenn die Ursachen für die Gefährdung weiter wirken; d.h. Arten, deren meiste Populationen abnehmen aufgrund von Übernutzung bzw. umfassender Zerstörung der Lebensräume oder anderen Umweltstörungen bzw. verschiedenster widriger Faktoren. R - rare = selten (selten, potentiell gefährdet) Arten mit kleinen Populationen, die nicht den Kategorien E bzw. V angehören, aber einem Risiko unterliegen; d.h. Arten, die gewöhnlich geographisch sehr zersplitterte Areale oder Lebensräume aufweisen oder die sehr dünn über ein größeres, ausgedehntes Gebiet verteilt sind. Neben diesen, mit den in deutschen Listen üblicherweise verwendeten etwa vergleichbaren Kategorien, empfiehlt die IUCN die Anwendung weiterer Einstufungen: I - indeterminate = unsicher, unbestimmt Arten, die verdächtigt werden, zu einer der vorigen Kategorien zu gehören, aber es liegen zu wenig Informationen vor, um zu sagen zu welcher. O - out of danger = (wieder) außer Gefahr Arten, die früher in einer der vorstehenden Kategorien geführt wurden, aber durch Schutzmaßnahmen derzeit relativ gesichert sind oder bei denen die Ursachen für die Bedrohung aufgehört haben zu wirken. Anzumerken ist, daß die Kategorie I im Sinne der Definition von HEATH (1981) verwendet wird. Die von der IUCN darüber hinaus noch angegebene Kategorie K - unsufficiently known (ungenügend bekannt) ist damit weitgehend deckungsgleich, so daß auf eine getrennte Anwendung der Kategorien I und K verzichtet werden kann. Die Verwendung der Kategorie O muß zwangsläufig im Rahmen der Ersterarbeitung einer Roten Liste entfallen. Es erscheint auch recht schwierig zu beurteilen, ob bei dem gegenwärtig ungebrochenen Trend der Übernutzung der Landschaft eine solche Aussage überhaupt sachlich richtig sein kann. Die allei-. nige Ausweisung von Naturschutzgebieten und Nationalparken ist m.e. kein hinreichender Schutz für die Arten, wenn nicht die allgemeinen, weit und großräumig vorhandenen Gefährdungsursachen, die ja auch zum Teil auf diese
10 Gebiete einwirken (z.b. Luftverschmutzung), eliminiert werden. Dagegen wird durch die Anwendung der Kategorie I ein realistischeres Bild gezeichnet. Insbesondere bei großen bzw. schwierig zu bearbeitenden Gruppen lassen sich oft aufgrund des unvollständigen Datenmaterials keine gesicherten und eindeutigen Zuordnungen vornehmen. Dennoch bestand auch für diese Rote Liste der gefährdeten Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns der primäre Wunsch, sie in der Verwendung der Kategorien vergleichbar mit anderen Listen des Landes und der BRD zu halten. Deshalb wurde zusätzlich die Kategorisierung nach den Regeln der IUCN innerhalb der Checkliste (s. Pkt. 5) eingefügt. Dadurch kommt es zu Differenzen, da für einige Arten der gegenwärtige Kenntnisstand eigentlich noch keine sichere Zuordnung erlaubt, die deutschen Kategorien aber eine Entscheidung erforderten. Es wäre wünschenswert, bei künftigen Neubearbeitungen von Roten Listen dem internationalen Vorgehen zu folgen. Nachfolgendes Schema veranschaulicht die Bestandssituationen und deren zeitliche Entwicklung für die einzelnen Kategorien. historische Erfassungs-Grenze aktuelle Bestands-Entwicklung (Dichte x Arealgröfle) mögliche Bestands-Entwicklung einer anderen Art der gleichen Kategorie Prognose-Grenze Abb. 1 Schema zur Verdeutlichung objektiver Grundlagen für die Festlegung von Gefahrdungskategorien (nach MÜLLER-MOTZFELD 1992)
11 Einige Anmerkungen dazu sollen die Vorgehensweise im Rahmen dieser Liste erläutern. 1. Der Beurteilungszeitraum darf nicht zu kurz gewählt werden. Zehn Jahre, wie in einigen Roten Listen noch üblich, sind zumindest für Insekten keine angemessene Zeitspanne. Aus der Populationsökologie ist bekannt, daß sich die Entwicklung von Populationen eng gekoppelt an großklimatische Prozesse vollziehen, die teilweise in Zyklen von bis zu 50 Jahren ablaufen. Daher sollte dieser Zeitraum zugrunde gelegt werden, ehe eine Art als ausgestorben oder verschollen bezeichnet wird. Dies schließt nicht aus, daß in Ausnahmefällen auch einmal eine Art als ausgestorben gewertet werden muß, wenn die Zerstörung oder starke Veränderung der wenigen Lebensräume zum Verschwinden dieser Art führte und aus zoogeographischen o.a. Gründen ein weiteres Vorkommen relativ sicher auszuschließen ist. 2. Problematisch bleibt die Wahl des Prognosezeitraumes. Wird er zu kurz angesetzt, so würden - bei strenger Handhabung - kaum Arten der E-Kategorie zuzuordnen sein. Ohnehin bleibt ein gewisses Maß an Spekulation bei der Aussage, wann denn nun bei Weiterwirken der bestehenden gegenwärtigen Ursachen für die Gefährdung einer Art diese aussterben wird. Entscheidend ist dabei die qualitative Seite dieses Prozesses. Die zeitliche Begrenzung ist dann von untergeordneter Bedeutung und aus rein pragmatischen Gründen für die Erarbeitung einer solchen Roten Liste anzusehen. 3. Eine Unterteilung der V-Kategorie in stark gefährdet und gefährdet ist unnötig. Einerseits entzünden sich gerade daran bei den oft üblichen Expertenumfragen die heftigsten Diskussionen, in deren Ergebnis meist Kompromisse geschlossen werden. Andererseits ist es für die heutige Schutzstrategie unerheblich, ob die Art früher mehr oder weniger häufig und flächendeckend vorkam. Entscheidend ist vielmehr die Tatsache, daß nachweisbare Populationsverluste und ein Rückgang in der Verbreitung in jüngster Zeit vonstatten gingen und somit eine Gefährdung dieser Art besteht, die Anstrengungen für die Erhaltung der verbliebenen Lebensräume der Art erforderlich machen. 4. Die größten Unterschiede zwischen den einzelnen Roten Listen gibt es bei der Anwendung der R-Kategorie. Es lassen sich zahlreiche Belege dafür anführen, wo trotz der an sich eindeutigen textlichen Definition der tatsächliche Gebrauch völlig davon abweicht (jüngstes Beispiel ist die soeben erschiene Rote Liste der Libellen Mecklenburg-Vorpommerns ). Im Sinne der IUCN- Kategorie sollen in dieser Roten Liste folgende zwei Möglichkeiten der Bestandssituation verstanden werden: a) Arten mit sehr wenigen, lokal begrenzten Vorkommen, die aber über den Beurteilungszeitraum keine wesentliche Bestandsabnahme zu verzeichnen haben. Typische Vertreter sind L.coridon, C.alceae, C. palaemon, C.minimus.
12 b) Arten, die eine weitere Verbreitung aufweisen, aber im gesamten Verbreitungsgebiet sehr selten, oft über lange Zeiträume hinweg nicht nachgewiesen werden. Typischer Vertreter: A.crataegi. Dabei ist es in beiden Fällen möglich, daß zwischenzeitlich eine Art eine kurzzeitige deutliche Häufigkeits- und Verbreitungszunahme zeigt und dann wieder auf den normalen Bestand zurückgeht. So sind die sich in großen Zeitabständen wiederholenden Massenvermehrungen und -Vorkommen von A.crataegi allgemein bekannt, während in den Zeiträumen dazwischen die Art äußerst selten auftritt. 5. Wie alle Schemata, so hat auch dieses seine Grenzen. Es kann daher nur ein Hilfsmittel für die fachliche Entscheidung auf der Grundlage eines möglichst umfassenden faunistischen Kenntnisstandes sein. Im Einzelfall muß dann nach der quantitativen faunistischen Analyse und den ökologischen Ansprüchen der Art entschieden werden. Eine Benachteiligung einer dieser beiden Komponenten muß zu Fehlschlüssen führen. Dabei sollte künftig in deutschen Roten Listen der Mut aufgebracht werden, durch den Gebrauch der I-Kategorie auf nicht ausreichendes Wissen und bestehenden Forschungsbedarf aufmerksam zu machen.
13 3. Gefährdungsursachen Mehr und mehr setzen sich auch in Deutschland Rote Listen durch, die über die bloße Einstufung der Arten in eine Gefährdungskategorie hinaus noch weitere Informationen enthalten, die dem Anwender Hilfe für einen sachgerechteren Umgang mit der Liste sein können. Praktisch wird damit das internationale Red Data Book-Konzept in verkürzter Form angewendet. Es wäre wünschenswert, entsprechende kommentierte Rote Listen im Sinne des Red Data Books auch in Deutschland zu erstellen. Im Rahmen der Aufstellung der Roten Listen für Insekten sind im Landesfachausschuß Entomologie Mecklenburg-Vorpommerns Vorschläge erarbeitet worden, die zusätzliche Angaben zu Habitatansprüchen, Substratbindungen und mögliche Gefährdungsursachen enthalten und die in allen Roten Listen für Insekten Mecklenburg-Vorpommerns Anwendung finden sollten - soweit dies die Spezifik der zu bearbeitenden Gruppe zuläßt. Aus diesem Grunde wurde für die Tagfalter auf die Anwendung des bekannten und sehr praktikablen Konzeptes der Zuordnung zu ökologischen Formationen (BLAB & KUDRNA 1982) verzichtet, da für die meisten Insektengruppen entsprechende Arbeiten nicht vorliegen bzw. eine solche Vorgehens weise nicht relevant ist. Die Tagfalter sind in besonderem Maße von der Art und Weise der menschlichen Landnutzung betroffen, sind sie doch zu einem sehr großen Teil auf offene, reich strukturierte Bereiche angewiesen. So ist es nicht verwunderlich, daß sie in der Kulturlandschaft mit extensiven Nutzungsformen in Land- und Waldwirtschaft des 18./19. Jahrhunderts offensichtlich ein Optimum an Lebensbedingungen vorfanden. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts vollzog sich international ein tiefgreifender Wandel in der Art und Weise der menschlichen Landnutzung: Mechanisierung, Chemisierung, Mineraldünger- und Biozideinsatz, Regulierung (Absenkung) des Wasserhaushaltes - kurz, die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft. Mehrere große Wellen gingen auch über unser Land, die letzte zog in den 70er Jahren die wohl tiefgreifendsten negativen Veränderungen vor allem in den Feuchtgrünlandbereichen nach sich - die komplexe Melioration. Parallel dazu vollzog und vollzieht sich eine allgemeine Eutrophierung der Umwelt durch ein Überangebot an Nähr- und Schadstoffen im Boden, im Wasser und in der Luft. Dieser Prozeß zeigt eindeutig steigende Tendenz, und es ist der Zeitpunkt absehbar, wo die allgemeine Eutrophierung der alles dominierende Gefährdungsfaktor sein wird.
14 Dies führte zwangsläufig zu einem weltweiten, wenn auch regional durchaus unterschiedlich ausgeprägten Artenrückgang. Seit Beginn der 60er Jahre ist dieser Prozeß zunehmend Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Dabei wurde sehr schnell klar, daß die Hauptursache für den allgemeinen Artenrückgang in der Zerstörung der Lebensräume der Arten zu suchen ist. HEATH (1981) machte dafür drei Hauptaspekte verantwortlich: die Entwässerung von Feuchtgebieten, die Intensivierung der Grünlandnutzung und der Forstwirtschaft. Als weitere Gefährdungsursachen benannte er u.a. die Luftverschmutzung, den Pestizideinsatz, die allgemeinen Klimaveränderungen und die Zersiedlung der Landschaft. Im einzelnen ist es sehr schwer, die konkreten Ursachen für den Rückgang einer Art zu belegen. Hier wären aufwendige und langjährige Untersuchungen nötig, die z. Zt. niemand bezahlen kann und will. Es bleibt daher oft nur der empirische Schluß aus einer möglichst großen Anzahl von Freilandbeobachtungen vieler Entomologen. Ebenso läßt sich in gewissem Sinne auch aus der Gefährdung des Habitates auf die der daran gebundenen Arten schließen. Die nachfolgende Liste der verwendeten Abkürzungen für Gefährdungsursachen, Habitate und Substratbindungen stellt somit den gegenwärtigen Stand der Diskussion dieser Problematik dar. Gefahrdungsursachen Fw Intensivierung der Forstwirtschaft Lw Intensivierung der Landwirtschaft Mo - Eingriffe in Moore (z.b. Torfabbau) Me Melioration/Grundwasserabsenkung Bi Biozideinsatz Nu - Nutzungsänderung auf Grenzstandorten Trockenbereiche - Aufforstung, zu hohe Beweidungsintensität u.a. Feuchtgebiete - Grünlandintensivierung, Umbruch u. Umwandlung in Ackerland u.a. Su - natürliche Sukzession durch Nutzungsaufgabe Gu Gewässer-AJfereingriffe Ks Küstenschutz To - Urlauber/Tourismus Z - Habitatzerstörung infolge Überbauung, Mülldeponierung u.ä.? - z.zt. unklar, allgemeine Eutrophierung der Umwelt?
15 Natürliche Einflüsse A R G - Arealveränderung (Rückzug bzw. Oszillation) - Reliktvorkommen - Grenzart, Verbreitungsgrenze in Mecklenburg-Vorpommern von n: Norden o: Osten s: Süden w: Westen erreichend Habitate D - Dünen H - Heiden (Zwergstrauch- u. Kiefernheiden) TR - Trocken- u. Magerrasen NM - Niedermoore AM - Arm- und Zwischenmoore FS - Feuchtgebiete (allgemein) /Sümpfe FW - Feuchtwiesen u. -weiden' extensiv genutzt SW - Salzwiesen u. -weiden G - Gewässer (allgemein) FG - Fließgewässer KG - Kleingewässer UF - Uferbereiche KÜ - Küsten SF - Spülfelder W - Wälder (allgemein) BW - Bruchwälder/Bruchmoore LW - Laub- und Mischwälder GF - Gebüschformationen incl. Feldgehölze, Hecken u.ä. NW - Nadelwälder RF - Ruderalflurenu.a. stark anthropogen überformte Gebiete (z.b. Gärten) Weitere ökologische Charakterisierungen ps xe th hy ty tb - psammophil (sandliebend) - xerothermophil (wärme- und trockenheitsliebend) - thermophil (wärmeliebend) - hygrophil (feuchtigkeitsliebend) - tyrphophil (torfliebend) - tyrphobiont (torfgebunden)
16 hp hb sy - halophil (salzliebend) - halobiont (salzgebunden) - synanthrop Dabei soll mit dem Symbol? angedeutet werden, daß eine genauere Benennung der konkreten Ursache für den Rückgang der Art z.zt. nicht möglich ist. Vielmehr ist in diesen Fällen oft die allgemeine Eutrophierung in Kombination mit anderen Faktoren als Ursache zu vermuten, jedoch schwer nachzuweisen. 4. Artenliste Kategorie 0 Ausgestorben oder verschollen (Ex - extinct) Bestandssituation: - Arten, deren Populationen nachweisbar ausgestorben sind, oder - verschollene Arten, deren Vorkommen früher belegt worden sind, die jedoch seit längerer Zeit (mindestens seit 50 Jahren) nicht mehr nachgewiesen wurden, bei denen daher der begründete Verdacht besteht, daß ihre Populationen erloschen sind. Ihnen muß bei Wiederauftreten besonderer Schutz gewährt werden. Wissenschaftl. Name Deutscher Name Habitate Gefährdungsursache Colias palaeno Hochmoor-Gelbling Erebia aethiops Graubindiger Mohrenfalter Erynnis tages Dunkler Dickkopffalter Everes argiades Kurzschwänziger Bläuling Glaucopsyche alexis Alexis-Bläuling Hamearis lucina Perlbinde Lopinga achine Gelbringfalter AM;tb Mo, Me; R, Gno W, NW Fw, Bi; Gso, A GF, H, W?;A GF, TR, W?; Gs, A W, GF, TR; xe?;a W, GF; th Fw, Nu, Bi LW, MW; th?;a.
17 Wissenschaftl. Name Deutscher Name Habitate Gefährdungsursache Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter Maculinea arion Schwarzfleckiger Ameisenbläuling Melitaea didyma Roter Scheckenfalter Nymphalis xanthomelas Östlicher Großer Fuchs Pyrgus alveus Sonnenröschen-Würfel Dickkopffalter Pyrgus carthami ' Steppenheiden-Würfel- Dickkopffalter Pyrgus serratulae Schwarzbrauner Würfel Dickkopffalter Pyronia tithonus Rotbraunes Ochsenauge Satyrium spini Kreuzdom-Zipfelfalter FW, NM; hy, ty Me, Lw, Nu, Su TR, H, GF; xe? TR, H, GF; xe?, Su, Nu; Gso LW, BW, GF; hy?; Gso, A TR, H,GF; th Nu, Su TR, H; xe Nu, Su; Gso, A GF, TR; xe Nu, Su; Gs, A LW, GF,H; th?, Fw, Nu; Gsw GF, TR; xe Nu, Su, Z; Gs Kategorie 1 Vom Aussterben bedroht (E - endangered) Bestandssituation: - Arten, die heute nur noch in Einzelvorkommen oder wenigen, isolierten und kleinen bis sehr kleinen Populationen auftreten; - Arten, deren Bestände durch langen, anhaltenden starken Rückgang auf eine bedrohliche Größe zusammengeschmolzen sind oder deren Rückgangsgeschwindigkeit im größten Teil des heimischen Areals extrem hoch ist. Das Überleben dieser Arten ist in Mecklenburg-Vorpommern unwahrscheinlich, wenn die verursachenden Faktoren weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und Hilfsmaßnahmen des Menschen nicht unternommen werden bzw. wegfallen. Die Erfüllung eines der Kriterien reicht zur Anwendung dieser Kategorie aus.
18 Wissenschaft. Name Deutscher Name Habitate Gefährdungsursache Apatura ilia LW, MW; th Fw, Bi; Gso Kleiner Schillerfalter Argyronome laodice AM, FW, FS; ty Mo, Me, Su; Go Grünlicher Perlmutterfalter Boloria ciquilonaris AM;tb Mo, Me, Su; R Hochmoor-Perlmutterfalter Clossicina dia GF, TR, W; xe Su, Nu, Bi; Gso Magerrasen-Perlmutterfalter Clossicina euphrosyne W; th?, Fw, Bi Silberfleck-Perlmutterfalter Erebia medusa W?; Gs Rundaugen-Mohrenfalter Fabriciana niobe H, GF, TR, W; th Nu, Su, Bi, Fw Mittlerer Perlmutterfalter Hipparchia hermione H, NW, TR; xe Fw, Bi, Su; Gs Kleiner Waldportier Hipparchia statilinus D, H, NW; xe, ps Nu, Su, Z, To; Gs Eisenfarbener Samtfalter Hypodryas maturna LW, BW?, Me, Fw Eschen-Scheckenfalter Lasiommata maera W; th?, Fw; A Braunauge Leptidea sinapis W, GF, TR; th?, Nu, Su, Bi Tintenfleck-Weißling Limenitis populi LW, BW, MW Fw, Bi Großer Eisvogel Maculinea alcon NM, AM, FW; ty Me, Mo, Lw, Nu, Su Lungenenzian-Ameisenbläuling Mellicta aurelia FW; ty,th Me, Lw, Nu, Su; Gso Grasheiden-Scheckenfalter Mellicta neglecta FW; hy, ty Lw, Me, Nu, Su Übersehener Scheckenfalter Mesoacidalia aglaja W, GF, H Fw, Bi Großer Perlmutterfalter Minois diyas NM, FS, FW; hy Me, Lw, Nu, Su; Gs Blaukernauge Proclossiana eunomia Randring-Perlmutterfalter FW; hy, ty Me, Lw, Nu, Su; R
19 Wissenschaftl. Name Deutscher Name Habitate Gefahrdungsursache Thymelicus acteon GF, TR, NW;xe Nu, Su, Z; Gso Mattscheckiger Braundickkopffalter Kategorie 2 Stark gefährdet (V - vulnerable) Bestandssituation: - Arten mit niedrigen Beständen - Arten, deren Bestände nahezu im gesamten einheimischen Verbreitungsgebiet signifikant zuriickgehen oder regional verschwunden sind. Die Erfüllung eines der Kriterien reicht aus. Wissenschaftl. Name Habitate Gefährdungsursache Deutscher Name Coenonympha tullía FW, NM, AM; Me, Mo, Lw, Nu, Su Großes Wiesenvögelchen ty, hy Fabriciana adippe W Fw,Bi Feuriger Perlmutterfalter Hesperia comma H, TR, GF, W; th Lw, Nu, Su Komma-Dickkopffalter Hypodryas aurinia FW, NM, W; hy Lw, Fw, Me, Nu, Su, Goldener Scheckenfalter Bi Hyponephele lycaon GF, H, TR, NW; Fw, Nu, Su; Gs Kleines Ochsenauge xe Lycaena alciphron TR, GF, W, FW; Nu, Su, Z, Me; Gs Violetter Feuerfalter th Lycaena dispar FW, FS, NM, U; Me, Lw, Nu, Su, Gu; Großer Feuerfalter hy Gs Lycaena hippothoe FW, W; hy Fw, Me, Nu, Su Lilagold-Feuerfalter Mellicta athalia W Fw, Bi Wachtelweizen-Scheckenfalter Melitaea diamina FS, NM, AM; Me, Mo, Nu, Lw Baldrian-Scheckenfalter ty, hy
20 Wissenschaftl. Name Habitate Gefährdungsursache Deutscher Name Plebejus argus H, TR, D, AM; th Nu, Su, Mo, Z Geißklee-Bläuling Vacciniina optilete AM; tb Mo, Me, Su; R Hochmoor-B läuling Kategorie 3 Gefährdet (V - vulnerable) Die Gefährdung besteht in großen Teilen des einheimischen Verbreitungsgebietes. Bestandssituation: - Arten mit regional niedrigen oder sehr niedrigen Beständen - Arten, deren Bestände regional bzw. vielerorts lokal zurückgehen oder total verschwunden sind. Die Erfüllung eines der Kriterien reicht aus. Wissenschaftl. Name Deutscher Name Habitate Gefährdungsursache Apatura iris W Fw, Bi Großer Schillerfalter Argynnis paphia W Fw, Bi Kaisermantel Aricia agestis TR, GF, H, D; xe Su, Nu, Bi, Z Kleiner Sonnenröschenbläuling Cartemcephalus silvicolus LW, BW; hy Fw, Bi Schwarzfleckiger Golddickkopffalter Coenonympha arcania W, GF, TR Fw, Nu, Su, Bi Weißbindiges Wiesenvögelchen Coenonympha glycerion NW, GF, H; th Fw, Nu, Su, Bi; Gs Rotbraunes Wiesenvögelchen Cyaniris semiargus Violetter Waldbläuling GF, W, TR; th Fw, Nu, Su, Bi
21 Wissenschaftl. Name Deutscher Name Habitate Gefahrdungsursache Hipparchia semele H, TR, GF, NW; Fw, Bi, Su, Nu Ockerbindiger Samtfalter th Limenitis camilla LW, BW, MW Fw Kleiner Eisvogel Lycaeides idas H, GF, W, AM; th Nu, Su, Fw Ginster-Bläuling Melitaea cinxia GF, TR, W; th Lw, Fw, Nu, Su, Bi, Z Wegerich-Scheckenfalter Nymphalis antiopa W, H Fw, Bi Trauermantel Nymphalis polychloros W, GF, RF Fw, Nu, Bi, Z Großer Fuchs Papilio machaon TR, RF, GF, FW Lw, Nu, Su, Bi, Z Schwalbenschwanz Quercusia quercus LW, MW, GF Fw, Bi Blauer Eichenzipfelfalter Satyrium ilicis LW, MW, GF; th Fw, Bi Brauner Eichenzipfelfalter Satyrium w-album LW, BW, MW, GF Fw, Bi Ulmen-Zipfelfalter Kategorie 4 Selten, potentiell gefährdet (R - rare) Arten, die im Gebiet nur wenige Vorkommen besitzen, und Arten, die in kleinen Populationen am Rand ihres Areals leben bzw. die sehr dünn über ein größeres, ausgedehntes Gebiet verteilt sind (sehr selten auftreten), sofern sie nicht bereits wegen ihrer aktuellen Gefährdung zu den Gruppen 1-3 gezählt werden. Auch wenn eine aktuelle Gefährdung heute nicht erkennbar ist, sind solche Arten doch allein aufgrund ihres räumlich eng begrenzten oder seltenen Vorkommens potentiell gefährdet.
22 Abb. 2 Ein Kleinod der heimischen Tagfalterfauna ist der Randring-Perlmulterfalter Proclossuma eimomia. Dieses Eiszeitrelikt ist vom Aussterben bedroht, kommt es doch nur noch an zwei lokal begrenzten Bereichen in den mecklenburgisch-vorpommerschen Flußtalmooren vor (Flügeloberseite). Abb. 3 Proclossicma eimomia (Flügelunterseite).
23 Abb. 4 Extensiv genutzte Feuchtwiesen und -weiden auf Niedermoor (ein- bis zweimalige Mahd ohne Mineraldüngereinsatz, gelegentliche Nachbeweidung mit Rindern) stellen den Lebensraum des Übersehenen Scheckenfalters Mellicta neglecta dar. Die wenigen, letzten Vorkommen dieser Art befinden sich alle in den großen Flußtalmooren des östlichen Landesteiles, so daß M. neglecta als vom Aussterben bedroht angesehen werden muß. Abb. 5 Der Goldene Scheckenfalter Hypodryas aitrinia besiedelt feuchte, moorige Wiesen mit Beständen der Futterpflanze (Teufelsabbiß - Succisia pratensis). Daneben kommt es auf Kahlschlägen in feuchteren Laub-Mischwäldern gelegentlich zu Massenvermehrungen der Art, die jedoch nach wenigen Jahren völlig zusammenbrechen. Seine ursprünglichen Lebensräume sind durch Entwässerung und intensive Grünlandnutzung weitestgehend verlorengegangen, so daß H. aitrinia als stark gefährdet anzusehen ist.
24 Abb. 6 Bereits längere Zeit aufgelassene Niedermoorbereiche (Feucht- und Streuwiesen) mit Beständen des Kleinen Baldrians Valeriana dioica sind die letzten Rückzugsgebiete für den Silberscheckenfalter MeUicta diamina. Das fast völlige Verschwinden der Streuwiesen und der damit verbundenen extensiven Nutzungsform solcher nasser Standorte hat diese ehemals als weit verbreitet angesehene Art in ihrem Bestand stark gefährdet.
25 Abb. 7 Praktisch vor dem Aussterben steht der Große Eisvogel Umenitis populi. Die früher als Charakterart der großen, feuchten Laub- und Mischwälder insbesondere des vorpommerschen Raumes angesehene Art ist hier seit 15 Jahren nicht mehr nachgewiesen worden. Die veränderten Nutzungsformen der Forstwirtschaft, insbesondere das systematische Vernichten der sogenannten Forstunkräuter (wozu die Futterpflanze - kleine, verkrüppelte Espensträucher Poptihis tremula - gehört), verbunden mit gleichzeitigem Herbizideinsatz zum Frei -Halten der Waldwegränder, haben zu dieser bedauerlichen Situation geführt.. Abb. 8 Früher besiedelte der Kleine Eisvogel Umenitis camiila praktisch jeden nicht zu trockenen Wald bzw. Forst. Auch diese Art hat den forstwirtschaftlichen Intensivierungsmaßnahmen erheblichen Tribut zollen müssen. Dunkelwaldwirtschaft mit Koniferenkulturen und insbesondere die Beseitigung der Forstunkräuter unter Herbizideinsatz, wozu die Futterpflanzen (Geißblattarten) des Kleinen Eisvogels gehören, haben dazu geführt, daß die Art als gefährdet anzusehen ist.
26 Wissenschaft!. Name Deutscher Name Habitate Gefährdungsursache Aporia crataegi Baumweißling Carcharodus alceae Malvendickkopffalter Carterocephciliis palaemon Gelbwürfeliger Dickkopffalter Cupido minimus Zwergbläuling Fixsenia pnini Pflaumen-Zipfelfalter Lysandra coridon Silbergrüner Bläuling Mellicta britomartis Östlicher Scheckenfalter Pontici daplidice *) Resedaweißling W, MW, GF, RF Fw, Bi TR, RF; th Lw, Nu, Su, Z; Gs LW, BW; hy Fw, Bi TR, GF; xe Nu, Su, Z GF, TR, W; xe Fw, Bi, Z, Nu TR; xe Nu, Su, Z; Gs GF, W, FW; th? TR, H, RF; xe Nu, Su, Bi, Z; Gs *) P.dapUdice gilt La.'im gesamten norddeutschen Tiefland als Wanderart. Lediglich im bereits klimatisch deutlicher kontinental getönten Bereich entlang des Odertales ist die Art bodenständig. In Mecklenburg-Vorpommern betrifft dies einige lokal begrenzte Flugstellen in der Ückermünder Heide südlich des Oderhaffs. Die hier vorgenommene Eingruppierung trifft nur für diesen Bereich zu, ansonsten gilt die Art als Wanderart. Dabei ist auch noch genau abzuklären, ob es sich tatsächlich um P.dapUdice handelt oder diese lokalen Vorkommen möglicherweise der östlichen Art P.caiUdice zuzurechnen sind (REINHARDT, pers. Mitteilung). Aus diesen Gründen kommt es zu der unterschiedlichen Eingruppierung im Rahmen der Checkliste (Kategorie I). Kategorie B.2 Vermehrungsgäste bzw. W anderarten (W) und Irrgäste (I) Arten, deren Fortpflanzungsgebiete normalerweise außerhalb Mecklenburg Vorpommerns liegen, die sich hier jedoch in Einzelfällen oder sporadisch vermehren bzw. Arten, die jährlich in unser Gebiet einfliegen und sich hier fortpflanzen, deren Nachkommen jedoch in unseren Wintern meist zugrunde gehen oder im Herbst zurückwandern.
27 Wissenschaftl. Name Deutscher Name Habitate Status Colias crocea Ubiquist W Wander-Gelbling Colias hyale Ubiquist W Weißklee-Gelbling Cynthia cardui Ubiquist w Distelfalter Iphiclides podalirius TR, GF; xe I; A, Gs Segelfalter Vanessa atalanta Admiral Ubiquist W Fragliche Nachweise Wissenschaftl. Name Deutscher Name Habitate Quelle Coenonympha hem LW, BW; hy BOLL 1855, Wald-Wiesenvögelchen RÜHL 1895 Colias alfacariensis TR; xe REISSINGER 1960 Hufeisenklee-Gelbling Lysandra bellargus TR, H; xe SCHMIDT 1879 Himmelblauer Bläuling Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf- FW; hy REINHARDT 1983 Ameisenbläuling r. Maculinea teleius FW; hy REINHARDT 1983 Heller Wiesenknopf Ameisenbläuling
28 5. Checkliste der Tagfalter von Mecklenburg-Vorpommern Nachfolgende Liste enthält alle Tagfalterarten, die auf dem Territorium des heutigen Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen wurden bzw. für die sich entsprechende Hinweise in der Literatur finden - unabhängig davon, ob diese Angaben sich aus heutiger Sicht als richtig bzw. überhaupt noch als nachprüfbar erwiesen haben. In letzterem Fall wird dies unter der Spalte Kategorie mit einem Fragezeichen vermerkt (fraglicher, in der Regel sehr alter Nachweis). Zusätzlich wird bei jeder Art die Nummer der betreffenden Art aus dem hierzulande weitverbreiteten und genutzten Standardwerk für die Schmetterlinge von M. KOCH ( Wir bestimmen Schmetterlinge. Band 1) angegeben, um dem mit der neuen Nomenklatur und Systematik nicht so vertrauten Anwender den Umgang mit dieser Liste zu erleichtern. Jede Art wird außerdem mit ihrem deutschen Namen wiedergegeben, auch wenn er sich als ziemliches Wortungeheuer darstellt. An sich genügt für die eindeutige Benennung der wissenschaftliche Name, doch hat sich gerade in der gutachterlichen Praxis die Gepflogenheit herausgebildet, dem Nichtfachmann (z.b. Politikern) das Verständnis entsprechender Listen und Arbeiten durch deutsche Namen der beschriebenen Arten zu erleichtern. Dies ist zweifellos nicht bei allen Tiergruppen sinnvoll (s. MÜLLER-MOTZFELD, 1993). Die Tagfalter gehören jedoch zu den Gruppen, wo eine solche Handhabung denkbar ist. Leider gibt es auch hier eine Vielzahl von verschiedenen deutschen Namen für die einzelnen Arten, die zudem noch regional recht unterschiedlich verwendet werden. Deshalb wurde im Rahmen dieser Liste auf die Checkliste der Tagfalter der BRD von REINHARDT et. al (1993) zurückgegriffen, weil hier erstmalig von einem Fachkollegenkreis der gesamten Bundesrepublik Deutschland ein einheitlicher Sprachgebrauch gefunden wurde - auch wenn man sich für den einen oder anderen deutschen Namen glücklichere Lösungen gewünscht hätte. Nr. b. KOCH Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Kategorien MV / IUCN Familie Hesperiidae (Dickkopffalter) 135 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) 4 R Gelbwürfeliger Dickkopffalter 134 Carterocephahts silvicolus (Meigen, 1829) 3 V Schwarzfleckiger Golddickkopffalter 133 Heteroptenis morpheus (Pallas, 1771) - Spiegelfleck 138 Thymelicits sylvestris (Poda, 1761) - Braunkolbiger Braundickkopffalter
29 Nr. b. Wissenschaftlicher Name Kategorien KOCH Deutscher Name MV / IUCN 136 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1806) Schwarzkolbiger Braundickkopffalter 137 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Mattscheckiger Dickkopffalter 140 Hesperia comma (Linnaeus, 1785) Komma-Dickkopffalter 139 Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853) Rostfarbiger Dickkopffalter 132 Eiynnis tages (Linnaeus, 1758) Dunkler Dickkopffalter 123 Carcharodus alceae (Esper, 1780) Malven-Dickkopffalter 125 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Kleiner Würfel-Dickkopffalter 130 Pyrgus alveus (Hübner, 1803) Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter 128 Pyrgus serratulae {Rambur, 1840) Schwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter 127 Pyrgus carthami (Hübner, 1813) Steppenheiden-Dickkopffalter Familie Papilionidae (Ritterfalter) 1 Papilio machaon (Linnaeus, 1758) Schwalbenschwanz 2 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Segelfalter 1 E 2 V OEx 4 R OEx OEx OEx 31 B.2 Familie Pieridae (Weißlinge) 16 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) I E Tintenfleck-Weißling 12 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) 0 Ex Hochmoor-Gelbling 13 Colias hyale (Linnaeus, 1758) B.2 Weißklee-Gelbling 13a Colias alfacariensis (australis) (Ribbe, 1905)? Hufeisenklee-Heufalter 14 Colias crocea (Fourcroy, 1785) B.2 W ander-gelbling
30 Nr. b. Wissenschaftlicher Name Kategorien KOCH Deutscher Name M V/IU CN 11 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Zitronenfalter 5 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Baumweißling 6 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Großer Kohlweißling 7 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Kleiner Kohlweißling 8 Pieris napi (Linnaeus, 1758) Grünaderweißling 9 Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) Resedaweißling 10 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurorafalter ' - 4 R 41 Familie Nymphalidae (Edelfalter) 44 Apatura iris (Linnaeus, 1758) 3 V Großer Schillerfalter 45 Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 E Kleiner Schillerfalter 46 Limenitis Camilla (Linnaeus, 1764) 3 V Kleiner Eisvogel 48 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) 1 E Großer Eisvogel 53 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Großer Fuchs 3 V 54 Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775) 0 Ex Östlicher Großer Fuchs 55 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) 31 Trauermantel 51 Inachis io (Linnaeus, 1758) Tagpfauenauge 49 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) B.2 Admiral 50 Cynthia (Vanessa) cardui (Linnaeus, 1758) B.2 Distelfalter 52 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Kleiner Fuchs
31 Nr. b. Wissenschaftlicher Name Kategorien KOCH Deutscher Name MV / IUCN 56 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) - C-Falter 57 Araschnia levana (Linnaeus, 1758) - Landkärtchenfalter 81 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 3 V Kaisermantel 80 Argyronome laodice (Pallas, 1771) IE Grünlicher Perlmutterfalter 77 Mesoacidalia aglaja (Linnaeus, 1758) 1 E Großer Perlmutterfalter 79 Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) 2 V Feuriger Perlmutterfalter 78 Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) 1 E Mittlerer Perlmutterfalter 76 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Kleiner Perlmutterfalter 74 Brenthis ino (Rottemburg, 1775) Mädesüß-Perlmutterfalter 71 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) I E Hochmoor-Perlmutterfalter 68 Proclossiana eunomia (Esper, 1799) 1 E Randring-Perlmutterfalter 69 Clossiana selene (Denis & Schiffermüller, 1775) - Braunscheckiger Perlmutterfalter 70 Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758) 1 E Silberfleck-Perlmutterfalter 72 Clossiana dia (Linnaeus, 1767) 1 E Magerrasen-Perlmutterfalter 60 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 3 V Wegerich-Scheckenfalter 62 Melitaea didyma (Esper, 1799) 0 Ex Roter Scheckenfalter 67 Melitaea diamina (Lang, 1789) 2 V Baldrian-Scheckenfalter 65 Mellicta athalia (Rottemburg, 1775) 2 V Wachtelweizen-Scheckenfalter 65a Mellicta neglecta (Pfau, 1962) IE Übersehener Scheckenfalter 64 Mellicta britomartis (Assmann, 1847) Östlicher Scheckenfalter 41
32 Nr. b. Wissenschaftlicher Name Kategorien KOCH Deutscher Name MV / IUCN 63 Mellicta aurelia (Nickerl, 1850) Grasheiden-Scheckenfalter 58 Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Eschen-Scheckenfalter 59 Eurodryas aurinia (Rottemburg, 1775) Goldener Scheckenfalter 1 E 1 E 2 V Familie Satyridae (Augenfalter) 22 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) - Schachbrettfalter 25 Hipparchia hermione (Linnaeus, 1767) 1 E Kleiner Waldportier 27 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) 3 V Ockerbindiger Samtfalter 28 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) 1 E Eisenfarbener Samtfalter 29 Minois dryas (Scopoli, 1763) 1 E Blaukemauge 20 Erebia aethiops (Esper, 1777) OEx Graubindiger Mohrenfalter 18 Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) 1 I Rundaugen-Mohrenfalter 37 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Großes Ochsenauge 38 Hyponephele lycaon (Kühn, 1774) 2 V Kleines Ochsenauge 35 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Schornsteinfeger 36 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1758) OEx Rotbraunes Ochsenauge 42 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Kleines Wiesenvögelchen 43 Coenonympha tullia (O.F. Müller, 1764) 2 V Großes Wiesenvögelchen 39 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)? Wald-Wiesenvögelchen 41 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 3 V Weißbihdiges Wald Vögelchen
33 Nr. b. Wissenschaftlicher Name Kategorien KOCH Deutscher Name MV / IUCN 40 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 3 V Rotbraunes Wiesenvögelchen 30 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) - Waldbrettspiel 31 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) ' - Mauerfuchs 33 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) 1 E Braunauge 34 Lopinga achine (Scopoli, 1763) 0 Ex Gelbringfalter Familie Lycaenidae (Bläulinge) 82 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) 0 Ex Perlbinde 83 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) - Grüner Zipfelfalter 90 Theda betulae (Linnaeus, 1758) Nierenfleck-Zipfelfalter 89 Quercusia quercus (Linnaeus, 1758) 3 V Blauer Eichenzipfelfalter 86 Satyrium ilicis (Esper, 1779) 3 V Brauner Eichenzipfelfalter 85 Satyrium w-album (Knoch, 1782) 3 V Ulmen-Zipfelfalter 84 Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) 0 Ex Kreuzdorn-Zipfelfalter 88 Fixsenia pruni (Linnaeus, 1758) 4 1 Pflaumen-Zipfelfalter 97 Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) 0 Ex Blauschillernder Feuerfalter 95 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) - Kleiner Feuerfalter 92 Lycaena dispar (Haworth, 1803) 2 V Großer Feuerfalter 91 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) Dukaten-Feuerfalter 96 Lycaena tityrus (Poda, 1761) - Brauner Feuerfalter
34 Nr. b. KOCH Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Kategorien MV / IUCN 94 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) Violetter Feuerfalter 93 Lycaena hippothoe (Linnaeus 1761) Lilagold-Feuerfalter 98 Cupido minimus (Fuessly, 1775) Zwergbläuling 99 Everes argiades (Pallas, 1771) Kurzschwänziger Bläuling 122 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Faulbaum-Bläuling 117 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) Alexis-Bläuling 118 Maculinea alcon (Denis & Schiffmüller, 1775) Lungenenzian-Ameisenbläuling 121 Maculinea arion (Linnaeus, 1758) Schwarzfleckiger Ameisenbläuling 119 Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 120 Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 100 Plebejus argus (Linnaeus, 1758) Geißklee-Bläuling 101 Lycaeides idas (Linnaeus, 1761) Ginster-Bläuling 106 Aricia agestis (Denis & Schiffmüller, 1775) Kleiner Sonnenröschen-Bläuling 103 Vacciniina optilete (Knoch, 1781) Hochmoor-B läuling 116 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) Violetter Waldbläuling 110 Plebicula amanda (Schneider, 1792) Prächtiger Bläuling 114 Lysandra coridon (Poda, 1761) Silbergrüner Bläuling 113 Lysandra bellargus {Rottemburg, 1775) Himmelblauer Bläuling 108 Polyomatus icarus (Rottemburg, 1775) Hauhechel-Bläuling 2 V 2 V 4 R OEx OEx 1 E OEx V 3 V 3 V 2 V 3 V 4 R?
35 6. Bilanz und Bewertung Insgesamt wurden auf dem Territorium des heutigen Landes Mecklenburg Vorpommern 109 Tagfalterarten nachgewiesen, den Anteil der gefährdeten Tagfalter an der Fauna Mecklenburg-Vorpommerns gibt Abb. 10 wieder. Von fünf weiteren Arten liegen unsichere und nicht nachprüfbare Mitteilungen aus der älteren Literatur vor, die z.t. auch nicht in das heutige Verbreitungsbild der Arten passen, so daß Fundortverwechslungen oder Bestimmungsfehler zu vermuten sind. Daher werden diese fünf Arten nicht zum Bestand der Tagfalterfauna Mecklenburg-Vorpommerns gezählt. Immerhin müssen bereits 15 Arten (= 13,8 %) als ausgestorben betrachtet werden, weitere 20 Arten (= 18,3 %) gelten als vom Aussterben bedroht. Somit befinden sich insgesamt 35 Arten (= 32,1 %) - also ein Drittel des Gesamtbestandes - in einer für den Naturschutz äußerst kritischen, im Prinzip unrettbaren Situation. Ein weiteres Drittel wird in den Kategorien 2 bis 4 (V und R) geführt, so daß praktisch nur noch 37 Arten (= 34 %) gegenwärtig nicht als gefährdet gelten. Darunter befinden sich allerdings weitere 5 Arten (Vermehrungs- und Irrgäste), die nicht bodenständig in unserem Land sind, obwohl mit Cynthia cardui, Vanessa atalanta und Colias hyale in guten Flugjahren durchaus häufige Arten dazugehören. Abb. 10 Anteile gefährdeter Arten an der Tagfalterfauna Mecklenburg-Vorpommerns
36 Ein Vergleich mit den benachbarten Bundesländern (s. Tab.l) ergibt eine weitgehende Übereinstimmung des Gesamtgefährdungsgrades mit der Brandenburger Liste. So stimmen z.b. die Zahlen in den Kategorien 0 und 1 fast überein. Auffallende Unterschiede treten auch hier in der Kategorie 4 ( R - rare) auf. Dies erklärt sich jedoch relativ einfach aus der Tatsache, daß in Mecklenburg Vorpommern viele Arten ihre nördliche Verbreitungsgrenze erreichen (Ostsee) und somit naturgemäß ein nur noch inselartiges Verbreitungsbild zeigen. Dies betrifft vor allem xerothermophile Arten. Bezogen auf die Gesamtlandesfläche sind in den ausgedehnten Grund- und den meisten Endmoränengebieten Trocken- und Magerstandorte ausgesprochen selten bzw. oft so kleinräumig vertreten, daß die daran angepaßten Tagfalter nur wenige entsprechende Lebensräume vorfinden. Tab. 1 Vergleich des Gefährdungsgrades der Tagfalterfauna Mecklenburg Vorpommerns mit dem der deutschen Nachbarländer (0-4 = Anteil der gefährdeten Arten, ungef. = Anteil der ungefährdeten Arten, Ges. = Gesamtartenzahl) Land M-V Brandenburg GELB RECHT, WEIDLICH Niedersachsen LOBEN STEIN Schleswig Holstein HEYDE- MANN, STUNING Hamburg STÜB IN GER Berlin (West) GERST- BERGER et.al. Kat /13,8% 16/14,0% 11/ 9,1% 7/ 8,8% 22/27,2% 30/27,8% 1 20/18,3% 18/15,8% 35/28,9% 15/18,8% 20/24,7% 17/15,7% 2 12/11,0% 19/16,7% 20/16,5% 17/21,2% 16/19,7% 3/ 2,8% 3 17/15,6% 20/17,6% 18/14,9% 15/18,8% 6/ 7,4% 12/11,1% 4 8/ 7,3% 3/ 2,6% 11*)/9,1% 23/28,7% /66,0% 76/66,7% 95/78,5% 77/96,3% 64/79,0% 62/57,4% ungef. 37/34,0% 38/33,3% 26/21,5% 3/ 3,7% 17/21,0% 46/42,6% Ges. 109/100% 114/100% 121/100% 80/100% 81/100% 108/100% *) in der Roten Liste Niedersachsens wird eine Kategorie 5 bei anhaltender Lebensraumzerstörung gefährdet verwendet, die aber inhaltlich sehr verschieden zur allgemein gebrauchten Kategorie R (rare, potentiell gefährdet) ist.
37 Die z.t. erheblichen Unterschiede zu den Listen der übrigen Nachbarbundesländer dürften im wesentlichen auf zwei Ursachen zurückzuführen sein: 1. hat die Intensität der Flächennutzung und damit der Zerstörung von Naturräumen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR noch nicht den Grad wie in den alten Bundesländern erreicht, 2. dürfte die bereits weiter oben diskutierte unterschiedliche Handhabung und Interpretation der Gefährdungskategorien hier zum Ausdruck kommen. So fehlt die R-Kategorie in den Listen Niedersachsens, Hamburgs und (West-) Berlins vollständig. Die verschiedene Handhabung läßt sich wohl am deutlichsten an der Zahl der nicht eingestuften, also der ungefährdeten Arten ablesen. Auffallend sind auch die geringen Gesamtartenzahlen Schleswig-Holsteins und Hamburgs, was im Falle des Stadt-Staates ja noch eher verständlich ist. Völlig aus dem Rahmen fällt allerdings der Gesamtgefährdungsgrad in der Liste Schleswig-Holsteins, dies kann nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich das Land bei der gegenwärtigen Überarbeitung der Roten Liste der üblichen Vorgehensweise anschließt. Bei der näheren Betrachtung der Gefährdungsursachen und der natürlichen Einflüsse ergibt sich folgende Rangfolge in der Häufigkeit der Vergabe in der Roten Liste: 1. Veränderungen der Standortbedingungen durch Nutzungsänderung oder Nutzungsaufgabe 2. Intensivierung der Forstwirtschaft 3. Biozideinsatz 4. Grenzarten 5. Entwässerung von Feuchtgebieten und Mooreingriffe 6. direkte Habitatzerstörungen 7. Intensivierung der Landwirtschaft 8. z.zt. unklare Ursachen, wahrscheinlich allgemeine Eutrophierung 9. Arealveränderungen 10. Reliktarten Dabei stehen die anthropogen bedingten Veränderungen der Lebensräume durch Nutzungsänderung bzw. -aufgabe deutlich an der Spitze der Ursachen, gefolgt von dem Ursachenkomplex Intensivierung der Forstwirtschaft und dem Biozideinsatz. Der hintere Rangplatz des Ursachenkomplexes Intensivierung der Landwirtschaft relativiert sich sofort dadurch, daß die anthropogen bedingten Standortveränderungen (Pos. 1), der Biozideinsatz (Pos. 3), die Entwässerung von Feuchtgebieten (Pos. 5) und die Habitatzerstörung (Pos. 6) zu einem nicht unerheblichen Teil ebenfalls auf das Konto der veränderten Nut
38 zungsformen der Landwirtschaft gehen. Es wurden im Rahmen dieser Untersuchung unter Intensivierung der Landwirtschaft im engeren Sinne intensivere Methoden der Land- und Grünlandbearbeitung verstanden ( Mahd- und Beweidungsregime, Bodenbearbeitungstechnologien usw.). Somit rangieren die Gefährdungsursachen, die mit der Intensivierung der Landnutzung in Land- und Forstwirtschaft insgesamt Zusammenhängen, eindeutig an der Spitze. Am stärksten sind hiervon die Tagfalterarten der Trockenstandorte betroffen. Sie gelten.bereits vollständig als gefährdet (s. Tab. 3), dicht gefolgt von den Arten der Feuchtgebiete und der Moore. Beide Gruppen besiedeln die nährstoffarmen - trockenen und feuchten - Standorte. Diese Bereiche waren schon immer durch menschliches Einwirken besonders betroffen. Bedrohten in der Vergangenheit die komplexe Melioration, die allgemeine Übernutzung und der Einsatz von Bioziden diese Arten, so dürften künftig mit der gewaltigen Umstrukturierung der hiesigen Landwirtschaft zwei parallel laufende Prozesse diese Tagfaltergruppen beeinträchtigen: a) Einerseits wird auf den ertragsschwachen (- nährstoffarmen) Standorten die Aufgabe jeglicher Nutzung in gewaltigen Größenordnungen stattfinden, so daß es langfristig zu gravierenden Auswirkungen kommen wird; b) andererseits wird auf den übrigen Flächen die Nutzungsintensität auf (alt)bundesdeutsches Niveau gehoben und damit den entsprechenden Arten so gut wie keine Überlebenschance gegeben. Gleichzeitig ist mit einem erhöhten Flächenverbrauch für Gewerbeansiedlungen und damit oft mit der Zerstörung gerade solcher ertragsarmer Standorte in Ortsrandlagen (= Ödland ) zu rechnen. Bei den Trockenstandorte besiedelnden Arten betrifft dies wie bereits aufgeführt vor allem solche, die hier an ihrer Verbreitungsgrenze leben und oft nur noch inselartig Vorkommen (Pontia daplidice, Hipparchia hermione, Hipparchia statilinus, Lysandra coridon und Thymelicus acteon). Dagegen haben die Feuchtgebietsarten im norddeutschen Tiefland eigentlich einen Verbreitungsschwerpunkt. Ausgedehnte Flußtalmoore, große Niedermoorbereiche und zahlreiche Zwischen- und Armmoore boten dieser Artengruppe in der Vergangenheit ausreichenden Lebensraum. Wenn nun aber bereits 79 % dieser einstmals doch mehr oder weniger großflächig verbreiteten Arten als gefährdet eihgestuft werden müssen, so ist dies das wohl deutlichste Alarmsignal. Dennoch sind in Mecklenburg-Vorpommern noch die größten bzw. einzigen Bestände des norddeutschen Raumes solcher Feuchtgebietsarten wie Minois dryas, Argyrognome laodice, Proclossiana eunomia, Hypodryas aurinia, Meldetet neglecta, Mellicta aurelia und Lycaena dispar zu verzeichnen.
39 Tab. 3: Prozentualer Anteil gefährdeter Tagfalterarten nach ökologischen Gruppen Gesamtartenzahl gefährdete Arten prozentualer Anteil Arten der Trockenstandorte (incl. Gehölzbereiche) Arten der Feuchtgebiete und Moore Waldarten incl. Gehölzbereiche % % % Offenlandbewohner % Ubiquisten 13 0 Beunruhigend hoch ist auch bereits der Gefährdungsgrad der Waldarten - galten diese doch lange Zeit mit dem Wald als ein noch intakter Teil unserer Natur. Hier haben jedoch in den letzten 10 bis 15 Jahren die intensiveren Methoden der Forstwirtschaft (Kahlschlagwirtschaft, Koniferenmonokulturen, Melioration, Chemieeinsatz, Wegebau einschließlich Versiegelung, Beseitigung von Mantel- und Saumstrukturen u.a.) sowie die allgemeine Umweltzerstörung (Waldsterben) sichtbare Spuren hinterlassen. Charakterarten der Wälder wie Apatura ilia, Apatura iris, Limenitis populi, Mesoacidalia aglaja, Fabriciana adippe, Mellicta athalia, ja selbst Nymphalis polychloros und Argynnis paphia sind heute nur noch selten zu finden bzw. stehen kurz vor dem Aussterben. Dagegen liegt der Gefährdungsgrad der Arten der (Kultur-)Offenlandschaft noch relativ niedrig. Doch auch hier sind künftig negative Veränderungen nicht ausgeschlossen, geht der gegenwärtige Trend in der Landnutzung unverändert weiter. Insgesamt sind die Aussichten/Überlebenschancen für die Tagfalterfauna unseres Landes als sehr problematisch einzuschätzen. Zwei Drittel des Bestandes sind bereits gefährdet, ein Drittel sogar in höchstem Maße. Wenn es nicht gelingt, den Gefährdungsprozeß, der zu dieser Situation führte, zu stoppen, werden sich künftige Rote Listen stets nur verlängern. Der politische Umbruch zu Beginn der 90er Jahre in Europa bietet andererseits auch die Chance, mit den alten, zerstörerischen Gewohnheiten und Lebensformen zu brechen. Im Interesse unserer Zukunft und der unserer Nachfahren muß eine Umorientierung in
40 der menschlichen Landnutzung erfolgen. Eine noch größere Intensivierung auf immer geringerer Anbaufläche führt unweigerlich in den Umweltkollaps. Es geht nicht ohne Verzicht und Zurücknahme sowohl des. Intensitätsgrades der Nutzung und des Nährstoffeinsatzes als auch der Konsumbedürfnisse der Gesellschaft allgemein. Abb. 11 Prozentuale Anteile gefährdeter Tagfalterarten nach ökologischen Gruppen
41 7. Literaturverzeichnis AUHAGEN, A., PLATEN, R. & SUKOPP, H. (Hrsg., 1991): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Berlin(West). - Landschaftsentw. u. Umweltforsch. S.6. BERG, Ch. & WIEHLE, W. (1993): Rote Liste der gefährdeten Moose Mecklenburg-Vorpommerns. 1.Fassung. - Hrsg.: Umweltministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin. BLAB, J. & KUDRNA, O. (1982): Hilfsprogramm für Schmetterlinge. - Kilda- Verlag, Greven. BLAB, I, NOWAK, E. & TRAUTMANN, W. (1984): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. - Kilda Verlag, Greven. BOLL, E. (1850): Übersicht der mecklenburgischen Lepidopteren. - Arch. Ver. Naturg. Mecklenb. 4, Nachtrag dazu von SCHMIDT (1851), l.c., 5, Nachtrag dazu von BOLL (1855), l.c., 9, Nachtrag dazu von BOLL, SCHMIDT, UNGER (1856), l.c., 10, Nachtrag dazu von SCHMIDT (1859), l.c., 13, Nachtrag dazu von UNGER (1866), l.c., 20, EBERT, G. & RENNWALD, E: (Hrsg., 1991): Die Schmetterlinge Baden Württembergs. Band 1+2: Tagfalter I+II. - Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart. EITSCHBERGER, R REINHARDT, R. & STEINIGER, H. (1991): Wanderfalter in Europa. - Atalanta 22(1). FRIESE, G. (1956): Die Rhopaloceren Nordostdeutschlands (Mecklenburg und Brandenburg). - Beitr. Ent. 6, , , GELBRECHT, J. & WEIDLICH, M. (1992): Rote Liste Großschmetterlinge (Macrolepidoptera), Gefährd. Tiere im Land Brandenburg - Rote Liste. Hrsg.: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, HEATH, J. (1981): Threatened Rhopalocera (Butterflies) in Europe. Council of Europe, Nature and Environment Series, No.23; Strasbourg. HEINICKE, W. (1993): Vorläufige Synopsis der in Deutschland beobachteten Eulenfalterarten mit Vorschlag für eine aktualisierte Eingruppierung in die Kategorien der Roten Liste (Lepidoptera, Noctuidae).- Ent.Nachr.Ber. 37(2),
42 HENDRIKSEN, H.J & KREUTZER, IB (1982): The Butterflies of Skandinavia in Nature. - Skandinavisk Bogforlag, Odense. HEYDEMANN, B. & STÜNING, D. (1982): Rote Liste der gefährdeten Wirbellosen-Arten in Schleswig-Holstein. 9. Schmetterlinge (Lepidoptera), Teil 1, in : Rote Liste der Pflanzen und Tiere Schleswig-Holsteins. - Schriftenreihe des Landesamtes für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holsteins Heft 5, HIGGINS, L.G. & RILEY, N.D. (1978): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas (2. Auflage). - Verlag Paul Parey, Hamburg & Berlin. HOMEYER, A. v. (1884): Vorkommen und Verbreitung einiger Macrolepidopteren in Vorpommern und Rügen. - Stett.Ent.Ztg. 45, KOCH, M. (1984): Wir bestimmen Schmetterlinge. - Neumann Verlag, Leipzig Radebeul. KUDRNA, O. (1986): Grundlagen zu einem Artenschutzprogramm für die Tagschmetterlingsfauna in Bayern und Analyse der Schutzproblematik in der Bundesrepublik Deutschland. - Nachr.Ent.Ver.Apollo Frankf. Suppl. 6, KUDRNA, 0.(1986): Butterflys of Europe. Vol AULA-Verlag Wiesbaden. LOBENSTEIN, U. (1986): Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Großschmetterlinge. - Merkblatt Nr. 20. Niedersächsisches Landesverwaltungsamt. MÜLLER-MOTZFELD, G. (1992): Die Rote Liste der Laufkäfer von Mecklenburg-Vorpommern (Expertenumfrage contra Computerfaunistik). - Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 35 (1/2), MÜLLER-MOTZFELD, G. (1993): Rote Liste der gefährdeten Laufkäfer Mecklenburg-Vorpommerns. 1. Fassung; Hrsg.:Umweltministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. - Schwerin. PAUL, H. & PLÖTZ, C. (1872/1880): Verzeichnis der Schmetterlinge, welche in Neuvorpommern und auf Rügen beobachtet wurden. - Mitt. Naturw. Ver. Neuvorpomm. 4, Makrolep.: Nachtrag l.c., 12, PFAU, J. (1928): Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlinge Pommerns. - Abh. Ber. Pommer. Nat. Ges. Stettin 9, REINHARDT, R. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperiidae Teil II. - Ent.Nachr.Ber. 26, Beiheft Nr.l. REINHARDT, R. (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperiidae 1.Nachtrag. - Ent.Nachr.Ber. 29,
43 REINHARDT, R. (1989): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperiidae 2.Nachtrag. - Ent.Nachr.Ber. 33, REINHARDT, R. et.al. (1993): Übersicht zum Stand der faunistischen und bibliographischen Erfassung der Tagfalter in den deutschen Bundesländern mit einer Checkliste der Tagfalter der Bundesrepublik Deutschland (Lep., Rhopalocera). - Ent.Nachr.Ber. 37 (4), REINHARDT, R. & KAMES, P. (1 82): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperiidae Teil I. - Ent.Nachr.Ber. 26, Beiheft Nr.l. REINHARDT, R. & THUST, R. (1988): Zur ökologischen Klassifizierung und zum Gefährdungsgrad der Tagfalter der DDR. - Ent.Nachr.Ber. 32 (5), REINHARDT, R. & THUST, R. (1989): Rote Liste der Tagfalter der DDR (Stand: 31Januar 1989). - Ent.Nachr.Ber. 33 (6), REISSINGER, E. (1960): Die Unterscheidung von Colias hyale L. und Colias australis Veritry (Lep. Pieridae) - zugleich ein Beitrag zum Wanderfalterproblem. - Ent. Z. 70, , , , ROESLER, R. (1935): Beiträge zur mecklenburgischen Großschmetterlingsfauna mit besonderer Berücksichtigung der Rostocker Umgebung. - Arch. Ver. Naturg. Mecklenb. N.F. 9, SCHMIDT, F. (1879): Übersicht der in Mecklenburg beobachteten Macrolepidopteren. - Arch.Ver.Naturg.Mecklenb. 33, Register dazu l.c. 34, I- XXVII (1880). SPORMANN, K. (1907/1909): Die im nordwestlichen Neuvorpommern bisher beobachteten Großschmetterlinge, mit besonderer Berücksichtigung der näheren Umgebung Stralsunds. - Jahresber.Gymnas.Stralsund 1907, 1-56, und 1909, STANGE, G. (1901): Die Macrolepidopteren der Umgebung von Friedland in Mecklenburg. - Wiss.Beil.Progr.Gymnas.Friedl.i.M. 1901, 1-87; Nachtrag dazu l.c., 1912, STÜBINGER, R. (1983): Schutzprogramm für Tagfalter und Widderchen in Hamburg. - Schriftenreihe der Behörde für Bezirksangelegenheiten, Naturschutz und Umweltgestaltung der Freien und Hansestadt Hamburg 7/1983. URBAHN, E. & URBAHN, H. (1939): Die Schmetterlinge Pommerns mit einem vergleichenden Überblick über den Ostseeraum - Macrolepidoptera. - Stett. Ent. Ztg. 100,
44
45
Rote Liste und Artenverzeichnis der Schmetterlinge (Lepidoptera) - Tagfalter (Diurna) - in Nordrhein-Westfalen
 4. Fassung, Stand Juli 2010 Bearbeiter: Heinz Schumacher unter Mitarbeit der AG Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen 0 achine Lopinga 0 1891 A3 7315 77 34 0 Gelbringfalter 2 acteon Thymelicus 0 2 3
4. Fassung, Stand Juli 2010 Bearbeiter: Heinz Schumacher unter Mitarbeit der AG Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen 0 achine Lopinga 0 1891 A3 7315 77 34 0 Gelbringfalter 2 acteon Thymelicus 0 2 3
Tagfalter Steckbriefe
 Tagfalter Steckbriefe Kleiner Fuchs Aglais urticae Der Kleine Fuchs ist ein häufiger und sehr weit verbreitetet Tagfalter. Seine schwarzen Raupen sind leicht auf sonnig stehenden Brennnesseln zu finden.
Tagfalter Steckbriefe Kleiner Fuchs Aglais urticae Der Kleine Fuchs ist ein häufiger und sehr weit verbreitetet Tagfalter. Seine schwarzen Raupen sind leicht auf sonnig stehenden Brennnesseln zu finden.
Tagfalter in Hamburg Rote Liste und Artenverzeichnis
 Natur & Stadtgrün Tagfalter in Hamburg Rote Liste und Artenverzeichnis 3. Fassung Wachsende Stadt Grüne Metropole am Wasser 1 2 Titelseite Callophrys rubi (Grüner Zipfelfalter) Frank Röbbelen Inhalt Inhalt...3
Natur & Stadtgrün Tagfalter in Hamburg Rote Liste und Artenverzeichnis 3. Fassung Wachsende Stadt Grüne Metropole am Wasser 1 2 Titelseite Callophrys rubi (Grüner Zipfelfalter) Frank Röbbelen Inhalt Inhalt...3
HOCHWASSERSCHUTZ UND AUENLANDSCHAFT THURMÜNDUNG
 Projekt HOCHWASSERSCHUTZ UND AUENLANDSCHAFT THURMÜNDUNG Erfolgskontroll-Programm Fauna Wiesen Zwischenbericht: Stand 2011 Westlicher Scheckenfalter Melitaea parthenoides Februar 2012 Auftraggeber: Amt
Projekt HOCHWASSERSCHUTZ UND AUENLANDSCHAFT THURMÜNDUNG Erfolgskontroll-Programm Fauna Wiesen Zwischenbericht: Stand 2011 Westlicher Scheckenfalter Melitaea parthenoides Februar 2012 Auftraggeber: Amt
Tagfalter in Hamburg Rote Liste und Artenverzeichnis
 Natur & Stadtgrün Tagfalter in Hamburg Rote Liste und Artenverzeichnis 3. Fassung Wachsende Stadt Grüne Metropole am Wasser 1 2 Titelseite Callophrys rubi (Grüner Zipfelfalter) Frank Röbbelen Inhalt Inhalt...3
Natur & Stadtgrün Tagfalter in Hamburg Rote Liste und Artenverzeichnis 3. Fassung Wachsende Stadt Grüne Metropole am Wasser 1 2 Titelseite Callophrys rubi (Grüner Zipfelfalter) Frank Röbbelen Inhalt Inhalt...3
5 Jahre Nasswiesenpflege im Allerbachtal (Harz)
 5 Jahre Nasswiesenpflege im Allerbachtal (Harz) Entwicklungen im Falterbestand 2010-2014 Lycaena hippothoe Lilagold-Feuerfalter Männchen Allerbachwiesen - Projektgebiet Wiederherstellung und Pflege der
5 Jahre Nasswiesenpflege im Allerbachtal (Harz) Entwicklungen im Falterbestand 2010-2014 Lycaena hippothoe Lilagold-Feuerfalter Männchen Allerbachwiesen - Projektgebiet Wiederherstellung und Pflege der
Schmetterlinge - Zauber der Natur
 Schmetterlinge - Zauber der Natur Weitere Tagfalter Blauäugiger Waldportier * Minois dryas Großer Feuerfalter * Lycaena dispar 4 cm Großer Schillerfalter Apatura iris 6,6 cm Kleiner Eisvogel Limenitis
Schmetterlinge - Zauber der Natur Weitere Tagfalter Blauäugiger Waldportier * Minois dryas Großer Feuerfalter * Lycaena dispar 4 cm Großer Schillerfalter Apatura iris 6,6 cm Kleiner Eisvogel Limenitis
Rote Liste der Tagfalter (Insecta: Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Thüringens
 Rote Liste der Tagfalter (Insecta: Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Thüringens Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Maculinea nausithous, im geplanten NSG Am Schwertstein Himmelsgrund bei Bad
Rote Liste der Tagfalter (Insecta: Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Thüringens Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Maculinea nausithous, im geplanten NSG Am Schwertstein Himmelsgrund bei Bad
 DIURNA - TAGFALTER Papilio machaon L.: podalirius L.: Parnassius mnemosyne L.: apollo L.: Pieris brassicae L.: rapae L.: napi L.: bryoniae 0.: Anthocharis cardamines L.: Gonepteryx rhamni L.: Colias palaeno
DIURNA - TAGFALTER Papilio machaon L.: podalirius L.: Parnassius mnemosyne L.: apollo L.: Pieris brassicae L.: rapae L.: napi L.: bryoniae 0.: Anthocharis cardamines L.: Gonepteryx rhamni L.: Colias palaeno
Tagfaltermonitoring im Nationalpark Kellerwald- Edersee. Gefördert durch
 Tagfaltermonitoring im Nationalpark Kellerwald- Edersee Gefördert durch Ziele des Tagfalter-Monitorings 1) Evaluation des Managements von FFH-Lebensraumtypen in den Offenlandbereichen des Nationalparks
Tagfaltermonitoring im Nationalpark Kellerwald- Edersee Gefördert durch Ziele des Tagfalter-Monitorings 1) Evaluation des Managements von FFH-Lebensraumtypen in den Offenlandbereichen des Nationalparks
Der Blauschillernde Feuerfalter. Rur & Kall Lebensräume im Fluss
 Der Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) im LIFE+ Projekt Rur & Kall Lebensräume im Fluss Bernhard Theißen Das LIFE+ Projekt Rur & Kall Lebensräume im Fluss Projektträger: Biologischen Station des
Der Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) im LIFE+ Projekt Rur & Kall Lebensräume im Fluss Bernhard Theißen Das LIFE+ Projekt Rur & Kall Lebensräume im Fluss Projektträger: Biologischen Station des
Pieridae: Coliadinae. 1013/23 Colias hyale LINNAEUS, a/24 Colias alfacariensis RIBBE, 1905
 Pieridae: Coliadinae 1013/23 Colias hyale LINNAEUS, 1758 1013a/24 Colias alfacariensis RIBBE, 1905 Die besten Unterschiede zwischen Colias hyale und Colias alfacariensis zeigen die Raupen (siehe unten).
Pieridae: Coliadinae 1013/23 Colias hyale LINNAEUS, 1758 1013a/24 Colias alfacariensis RIBBE, 1905 Die besten Unterschiede zwischen Colias hyale und Colias alfacariensis zeigen die Raupen (siehe unten).
Zur Tagfalterfauna von Wildwiesen im Südwest Hunsrück ein Beitrag zum Arten und Biotopschutz im Wald
 Zur Tagfalterfauna von Wildwiesen im Südwest Hunsrück ein Beitrag zum Arten und Biotopschutz im Wald Vortrag anlässlich des Symposiums für Schmetterlingsschutz und des 20. UFZ Workshops zur Populationsbiologie
Zur Tagfalterfauna von Wildwiesen im Südwest Hunsrück ein Beitrag zum Arten und Biotopschutz im Wald Vortrag anlässlich des Symposiums für Schmetterlingsschutz und des 20. UFZ Workshops zur Populationsbiologie
Die Schmetterlinge Osttirols
 Die Schmetterlinge Osttirols Eine bebilderte Checkliste mit Verbreitungskarten HELMUT DEUTSCH Teil 2 - Tagfalter Ritterfalter Papilioidae Dickkopffalter, Würfelfalter Hesperiidae Weißlinge Pieridae Edelfalter
Die Schmetterlinge Osttirols Eine bebilderte Checkliste mit Verbreitungskarten HELMUT DEUTSCH Teil 2 - Tagfalter Ritterfalter Papilioidae Dickkopffalter, Würfelfalter Hesperiidae Weißlinge Pieridae Edelfalter
Rote Liste (Gefährdungsabschätzung) der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens
 Rote Liste (Gefährdungsabschätzung) der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens Dritte Fassung, Stand 6.4.28, Ergänzungen 18.1.29 Erstellt im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie,
Rote Liste (Gefährdungsabschätzung) der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens Dritte Fassung, Stand 6.4.28, Ergänzungen 18.1.29 Erstellt im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie,
Tierökologisches Gutachten. - Tagfalter - zum. Hochwasserrückhalteraum 5 Schorndorf-Urbach
 Tierökologisches Gutachten - Tagfalter - zum Stadt Schorndorf, Gemeinde Urbach Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg Tierökologisches Gutachten - Tagfalter - zum Stadt Schorndorf, Gemeinde Urbach Rems-Murr-Kreis
Tierökologisches Gutachten - Tagfalter - zum Stadt Schorndorf, Gemeinde Urbach Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg Tierökologisches Gutachten - Tagfalter - zum Stadt Schorndorf, Gemeinde Urbach Rems-Murr-Kreis
11 Vordere Wasserfallen, Waldenburg
 11 Vordere Wasserfallen, Waldenburg Höhe : 1000 X-Koord: 620 Y-Koord : 247 Ausgedehnte, nord- bis süd(west)exponierte Wiesen und Weiden im Gebiet der Vorderen Wasserfallen. Besonders wertvoll sind die
11 Vordere Wasserfallen, Waldenburg Höhe : 1000 X-Koord: 620 Y-Koord : 247 Ausgedehnte, nord- bis süd(west)exponierte Wiesen und Weiden im Gebiet der Vorderen Wasserfallen. Besonders wertvoll sind die
Kreis Nürnberger Entomologen; download unter D ie Tagfalter des Vinschgaues - Südtirol (Lep., Diurna) H.
 B e r.k r.n t ir n b g.e n t. g a l a t h e a 9 / 4 - N ü r n b e r g 1993 S.124-134 D ie Tagfalter des Vinschgaues - Südtirol (Lep., Diurna) H. Teil (Schluß) Udo Luy Nymphalis antiopa LINNAEUS 1758 Polygonia
B e r.k r.n t ir n b g.e n t. g a l a t h e a 9 / 4 - N ü r n b e r g 1993 S.124-134 D ie Tagfalter des Vinschgaues - Südtirol (Lep., Diurna) H. Teil (Schluß) Udo Luy Nymphalis antiopa LINNAEUS 1758 Polygonia
06 Blauenweide, Blauen
 06 Blauenweide, Blauen Höhe : 650 X-Koord: 606 Y-Koord : 256.2 Die ausgedehnte, südexponierte Blauenweide liegt oberhalb des Dorfes Blauen. Der extensiv beweidete Hang ist geprägt durch grossflächige Halbtrockenrasen
06 Blauenweide, Blauen Höhe : 650 X-Koord: 606 Y-Koord : 256.2 Die ausgedehnte, südexponierte Blauenweide liegt oberhalb des Dorfes Blauen. Der extensiv beweidete Hang ist geprägt durch grossflächige Halbtrockenrasen
Tagfalterbeobachtunqen im Wallis. U. Luy
 fralathoa 2/T Nürnberg l')86 Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.biologiezentrum.at Tagfalterbeobachtunqen im Wallis U. Luy Vom 10. 17. Juli 1986 konnte ich endlich einmal eine seit langem
fralathoa 2/T Nürnberg l')86 Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.biologiezentrum.at Tagfalterbeobachtunqen im Wallis U. Luy Vom 10. 17. Juli 1986 konnte ich endlich einmal eine seit langem
Schmetterlinge Zauber der Natur. Manfred Pendl
 Schmetterlinge Zauber der Natur * streng geschützt (Wien) Nachtfalter Russischer Bär * Callimorpha quadripunctaria Kl. Nachtpfauenauge Saturnia pavonia Abendpfauenauge* Smerinthus ocellata! 5,2 cm!" 8,5
Schmetterlinge Zauber der Natur * streng geschützt (Wien) Nachtfalter Russischer Bär * Callimorpha quadripunctaria Kl. Nachtpfauenauge Saturnia pavonia Abendpfauenauge* Smerinthus ocellata! 5,2 cm!" 8,5
und spanischen Bergen 2. bis Jürgen Puchs
 Zwölf Tage Tagfalterbeobachtungen Kreis Nürnberger Entomologen; download unter in www.biologiezentrum.at den portugi esischen und spanischen Bergen 2. bis 13. 8. 1987 Jürgen Puchs Zusammenfassung: Aus
Zwölf Tage Tagfalterbeobachtungen Kreis Nürnberger Entomologen; download unter in www.biologiezentrum.at den portugi esischen und spanischen Bergen 2. bis 13. 8. 1987 Jürgen Puchs Zusammenfassung: Aus
DDR in deren Fluktuationszone. Aus den Nachbarländern wurden vergleichsweise
 Nota lepid. 5 (4) : 177-190 ; 31. XII. 1982 ISSN 0342-7536 Übersicht zur Tagfalterfauna der DDR Rolf Reinhardt DDR-9044 Karl-Marx-Stadt, Irkutsker Strasse 153. In den letzten Jahren wurden intensive Arbeiten
Nota lepid. 5 (4) : 177-190 ; 31. XII. 1982 ISSN 0342-7536 Übersicht zur Tagfalterfauna der DDR Rolf Reinhardt DDR-9044 Karl-Marx-Stadt, Irkutsker Strasse 153. In den letzten Jahren wurden intensive Arbeiten
Kurzbericht 2011/2012. Monitoring auf dem Golfplatz. Sachbearbeiterin
 Monitoring auf dem Golfplatz Kurzbericht 2011/2012 Sachbearbeiterin Sarah Marthaler Büro für ökologische Optimierungen GmbH Wilenstr. 133 8832 Wilen Tel: 043 844 49 51 E-Mail: info@oekobuero.ch Impressum
Monitoring auf dem Golfplatz Kurzbericht 2011/2012 Sachbearbeiterin Sarah Marthaler Büro für ökologische Optimierungen GmbH Wilenstr. 133 8832 Wilen Tel: 043 844 49 51 E-Mail: info@oekobuero.ch Impressum
Ökologische Aufwertung in Ackerfluren in der Oberrheinebene
 Ökologische Aufwertung in Ackerfluren in der Oberrheinebene - Projektvorstellung Vilm 15.3.216 - Dr. Rainer Oppermann, Institut für Agrarökologie und Biodiversität (ifab), Mannheim Julian Lüdemann, Institut
Ökologische Aufwertung in Ackerfluren in der Oberrheinebene - Projektvorstellung Vilm 15.3.216 - Dr. Rainer Oppermann, Institut für Agrarökologie und Biodiversität (ifab), Mannheim Julian Lüdemann, Institut
Widderchen, Zygaenoidea
 Schmetterlingsart Code Rote Liste NRW Kartierhinweise Bestimmungshilfe besserer Artnachweis Widderchen, Zygaenoidea Grün- u. Rotwidderchen, Zygaenidae Grünwidderchen, Procridinae Heide-Grünwidderchen,
Schmetterlingsart Code Rote Liste NRW Kartierhinweise Bestimmungshilfe besserer Artnachweis Widderchen, Zygaenoidea Grün- u. Rotwidderchen, Zygaenidae Grünwidderchen, Procridinae Heide-Grünwidderchen,
Modell- und Demonstrationsvorhaben. Mittelwaldähnliche Waldrandgestaltung und nutzung
 Modell- und Demonstrationsvorhaben Mittelwaldähnliche Waldrandgestaltung und nutzung - Auswirkungen auf die Schmetterlingsfauna - Burkhard Beinlich, Landschaftsstation im Kreis Höxter e.v. Ziele des
Modell- und Demonstrationsvorhaben Mittelwaldähnliche Waldrandgestaltung und nutzung - Auswirkungen auf die Schmetterlingsfauna - Burkhard Beinlich, Landschaftsstation im Kreis Höxter e.v. Ziele des
Bestimmungshilfe für Tagfalter im Altkreis Eckernförde
 NABU - Ortsgruppe Eckernförde Fotos: Marx Harder Arbeitsgruppe Faltergarten Stand: Juli 2017 Bestimmungshilfe für Tagfalter im Altkreis Eckernförde Mit dieser Bestimmungshilfe können Sie vermutlich alle
NABU - Ortsgruppe Eckernförde Fotos: Marx Harder Arbeitsgruppe Faltergarten Stand: Juli 2017 Bestimmungshilfe für Tagfalter im Altkreis Eckernförde Mit dieser Bestimmungshilfe können Sie vermutlich alle
Waldtagfalter und andere Schmetterlinge im Wald
 17. SVS-Naturschutztagung Biodiversität Vielfalt im Wald Burgdorf, 20. November 2010 Waldtagfalter und andere Schmetterlinge im Wald Goran Du ej Dipl. phil. II, Biologe/SVU Waldtagfalter In der Schweiz
17. SVS-Naturschutztagung Biodiversität Vielfalt im Wald Burgdorf, 20. November 2010 Waldtagfalter und andere Schmetterlinge im Wald Goran Du ej Dipl. phil. II, Biologe/SVU Waldtagfalter In der Schweiz
Rote Liste der Tagfalter Hessens
 NATUR IN HESSEN HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ Rote Liste der Tagfalter Hessens Rote Liste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens 1 (Zweite
NATUR IN HESSEN HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ Rote Liste der Tagfalter Hessens Rote Liste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens 1 (Zweite
Checkliste der bayerischen Tagfalter (Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera)
 Dieses PDF wird von der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Entomologen e.v. für den privaten bzw. wissenschaftlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung oder die Bereitstellung in einer
Dieses PDF wird von der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Entomologen e.v. für den privaten bzw. wissenschaftlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung oder die Bereitstellung in einer
Bestandsentwicklung ausgewählter Tagfalterarten in Sachsen
 Vortrag zum Tagfalter Workshop 2016 in Leipzig bearbeitete online-fassung (28.02.2016) Dr. Elisabeth Rieger, Steinigtwolmsdorf & Rolf Reinhardt, Mittweida Bestandsentwicklung ausgewählter Tagfalterarten
Vortrag zum Tagfalter Workshop 2016 in Leipzig bearbeitete online-fassung (28.02.2016) Dr. Elisabeth Rieger, Steinigtwolmsdorf & Rolf Reinhardt, Mittweida Bestandsentwicklung ausgewählter Tagfalterarten
Tierart Gültigkeitsüberprüfung Anforderungen Bestimmung Bemerkungen Verwechlsung Schwierigkeit JU MI AN WZA OZA AS JU MI AN WZA OZA AS Aglais urticae
 Aglais urticae Linnaeus 1758 * * * * * * Sichtbeobachtung N. polychloros 1 Anthocharis cardamines Linnaeus 1758 * * * * * * Sichtbeobachtung (_) Euchloe simplonia 1 Apatura ilia Denis & Schiff. 1775 3
Aglais urticae Linnaeus 1758 * * * * * * Sichtbeobachtung N. polychloros 1 Anthocharis cardamines Linnaeus 1758 * * * * * * Sichtbeobachtung (_) Euchloe simplonia 1 Apatura ilia Denis & Schiff. 1775 3
Rote Liste gefährdeter Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns
 Rote Liste gefährdeter Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns Bearbeitet von Ralf Bolz und Adi Geyer unter Mitarbeit von M. Albrecht, H. Anwander, H.-J. Beck, A. Bischof, B. Binzenhöfer, J. Bittermann,
Rote Liste gefährdeter Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns Bearbeitet von Ralf Bolz und Adi Geyer unter Mitarbeit von M. Albrecht, H. Anwander, H.-J. Beck, A. Bischof, B. Binzenhöfer, J. Bittermann,
Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2017
 35 (2018) Band 35 (2018) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2017 Sofia, 2018 Oedippus Band 35 (2018) Publikationsdatum Dezember 2018 Zeitschrift für Veröffentlichungen zu den Themenbereichen
35 (2018) Band 35 (2018) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2017 Sofia, 2018 Oedippus Band 35 (2018) Publikationsdatum Dezember 2018 Zeitschrift für Veröffentlichungen zu den Themenbereichen
Schmetterlingsförderung auf Biogrünlandbetrieben. Universität Basel, Umweltgeowissenschaften, Bernoullistr. 30, 4056 Basel
 ZWISCHENBERICHT Schmetterlingsförderung auf Biogrünlandbetrieben Andreas Lang 1), Véronique Chevillat und Lukas Pfiffner 1) Universität Basel, Umweltgeowissenschaften, Bernoullistr. 30, 4056 Basel Forschungsinstitut
ZWISCHENBERICHT Schmetterlingsförderung auf Biogrünlandbetrieben Andreas Lang 1), Véronique Chevillat und Lukas Pfiffner 1) Universität Basel, Umweltgeowissenschaften, Bernoullistr. 30, 4056 Basel Forschungsinstitut
Beiträge zur Faunistik Thüringer Tagfalter (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Teil 2
 115 Beiträge zur Faunistik Thüringer Tagfalter 1988 1991 (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Teil 2 von Gerd KUNA 3. Das thüringische Grabfeld 3.1. Beschreibung der Naturräume 1991 untersuchte ich
115 Beiträge zur Faunistik Thüringer Tagfalter 1988 1991 (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Teil 2 von Gerd KUNA 3. Das thüringische Grabfeld 3.1. Beschreibung der Naturräume 1991 untersuchte ich
Exemplarische Untersuchung der Artengruppe der Tagfalter an ausgewählten Standorten hoher Eignung
 I Bauliche Änderungen Weststrecke Trier exempl. Untersuchung Tagfalter Bauliche Änderung der Weststrecke Trier für den Schienenpersonennahverkehr Exemplarische Untersuchung der Artengruppe der Tagfalter
I Bauliche Änderungen Weststrecke Trier exempl. Untersuchung Tagfalter Bauliche Änderung der Weststrecke Trier für den Schienenpersonennahverkehr Exemplarische Untersuchung der Artengruppe der Tagfalter
Auf Insekten-Exkursion im Duvenstedter Brook
 07.08.2010 - Auf Insekten-Exkursion im Duvenstedter Brook Was Ornithologen als Bird Race seit Jahren praktizieren, lässt sich sicher auch auf andere Lebewesen übertragen: Da der Duvenstedter Brook im Hochsommer
07.08.2010 - Auf Insekten-Exkursion im Duvenstedter Brook Was Ornithologen als Bird Race seit Jahren praktizieren, lässt sich sicher auch auf andere Lebewesen übertragen: Da der Duvenstedter Brook im Hochsommer
Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns
 Bayerisches Landesamt für Umwelt Stand Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns 1 Einführung Im Rahmen der Roten Liste werden nur Arten mit bodenständigen bzw. temporär
Bayerisches Landesamt für Umwelt Stand Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns 1 Einführung Im Rahmen der Roten Liste werden nur Arten mit bodenständigen bzw. temporär
Bestimmungshilfe Gütersloher Schmetterlingssommer
 Bestimmungshilfe Gütersloher Schmetterlingssommer Umweltberatung Gütersloh www.schmetterlinge.guetersloh.de Bestimmungshilfe Schmetterlinge in Gütersloh In dieser Bestimmungshilfe sind ausschließlich die
Bestimmungshilfe Gütersloher Schmetterlingssommer Umweltberatung Gütersloh www.schmetterlinge.guetersloh.de Bestimmungshilfe Schmetterlinge in Gütersloh In dieser Bestimmungshilfe sind ausschließlich die
Tagfalterinventar 2002
 Naturlehrgebiet Buchwald Ettiswil: Tagfalterinventar 20 Manfred Steffen, Dipl. Natw. ETH / SVU Langenthal, 20. Januar 2003 Büro für naturnahe Planung und Gestaltung, Hinterbergweg 8A, 4900 Langenthal,
Naturlehrgebiet Buchwald Ettiswil: Tagfalterinventar 20 Manfred Steffen, Dipl. Natw. ETH / SVU Langenthal, 20. Januar 2003 Büro für naturnahe Planung und Gestaltung, Hinterbergweg 8A, 4900 Langenthal,
Insektenförderung im F.R.A.N.Z.-Projekt
 Insektenförderung im F.R.A.N.Z.-Projekt Berlin, 23. Januar 2019 Sibylle Duncker, Umweltstiftung Michael Otto Björn Rohloff, Stiftung Kulturlandpflege Niedersachsen Ein Projekt von Wissenschaftlich begleitet
Insektenförderung im F.R.A.N.Z.-Projekt Berlin, 23. Januar 2019 Sibylle Duncker, Umweltstiftung Michael Otto Björn Rohloff, Stiftung Kulturlandpflege Niedersachsen Ein Projekt von Wissenschaftlich begleitet
Schmetterlinge - Zauber der Natur. Manfred Pendl
 Schmetterlinge - Zauber der Natur * streng geschützt (Wien) Nachtfalter Russischer Bär* Callimorpha quadripunctaria Kl. Nachtpfauenauge Saturnia pavonia Abendpfauenauge* Smerinthus ocellata 5,2 cm 8,5
Schmetterlinge - Zauber der Natur * streng geschützt (Wien) Nachtfalter Russischer Bär* Callimorpha quadripunctaria Kl. Nachtpfauenauge Saturnia pavonia Abendpfauenauge* Smerinthus ocellata 5,2 cm 8,5
Bestandsveränderungen der letzten 30 Jahre und mögliche Ursachen
 http://www.klimawandel-projekte.de Entwicklung von Anpassungsstrategien seitens des Naturschutzes zum Erhalt hochgradig durch den Klimawandel gefährdeter Lebensgemeinschaften Teil 1: Burkhard Beinlich
http://www.klimawandel-projekte.de Entwicklung von Anpassungsstrategien seitens des Naturschutzes zum Erhalt hochgradig durch den Klimawandel gefährdeter Lebensgemeinschaften Teil 1: Burkhard Beinlich
Artengruppen: Libellen, Tagfalter im Wald
 Projekt HOCHWASSERSCHUTZ UND AUENLANDSCHAFT THURMÜNDUNG Erfolgskontroll-Programm Artengruppen: Libellen, Tagfalter im Wald Zwischenbericht: Dokumentation Stand 2013 Veilchen-Perlmutterfalter Boloria euphrosyne
Projekt HOCHWASSERSCHUTZ UND AUENLANDSCHAFT THURMÜNDUNG Erfolgskontroll-Programm Artengruppen: Libellen, Tagfalter im Wald Zwischenbericht: Dokumentation Stand 2013 Veilchen-Perlmutterfalter Boloria euphrosyne
4. Beitrag zur Tagfalterfauna der Insel Rab, Kroatien (Lepidoptera, Hesperioidea und Papilionoidea) von
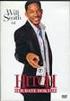 Atalanta (Juni 2002) 33 (1/2):69-75, Würzburg, ISSN 0171-0079 4. Beitrag zur Tagfalterfauna der Insel Rab, Kroatien (Lepidoptera, Hesperioidea und Papilionoidea) von U do Luy eingegangen am 27.IV.2002
Atalanta (Juni 2002) 33 (1/2):69-75, Würzburg, ISSN 0171-0079 4. Beitrag zur Tagfalterfauna der Insel Rab, Kroatien (Lepidoptera, Hesperioidea und Papilionoidea) von U do Luy eingegangen am 27.IV.2002
Schmetterlinge der Ostfriesischen Inseln
 Schriftenreihe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer Band 14 Schmetterlinge der Ostfriesischen Inseln Eine Anleitung für Entdecker Carsten Heinecke Impressum Herausgeber Nationalparkverwaltung Niedersächsisches
Schriftenreihe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer Band 14 Schmetterlinge der Ostfriesischen Inseln Eine Anleitung für Entdecker Carsten Heinecke Impressum Herausgeber Nationalparkverwaltung Niedersächsisches
1 Einleitung. EGGE-WESER Band Seiten Die Tagschmetterlings- und Widderchenfauna des Diemeltales im Wandel der letzten 150 Jahre 1
 EGGE-WESER Band 16 2004 Seiten 3-24 Die Tagschmetterlings- und Widderchenfauna des Diemeltales im Wandel der letzten 150 Jahre 1 Thomas Fartmann 1 Einleitung Die herausragende Bedeutung der Kalk-Halbtrockenrasen-Komplexe
EGGE-WESER Band 16 2004 Seiten 3-24 Die Tagschmetterlings- und Widderchenfauna des Diemeltales im Wandel der letzten 150 Jahre 1 Thomas Fartmann 1 Einleitung Die herausragende Bedeutung der Kalk-Halbtrockenrasen-Komplexe
Natur-Museum Luzern und Entomologische Gesellschaft Luzern; download Entomologische Berichte Luzern 28,1992 5
 Entomologische Berichte Luzern 28,1992 5 Buchbesprechung ("Die Schmetterlinge Baden-Württembergs", Bd.1+2) nebst einem Vergleich der Tagfalterfauna Baden- Württembergs (BRD) mit der der Schweiz (Lepidoptera:
Entomologische Berichte Luzern 28,1992 5 Buchbesprechung ("Die Schmetterlinge Baden-Württembergs", Bd.1+2) nebst einem Vergleich der Tagfalterfauna Baden- Württembergs (BRD) mit der der Schweiz (Lepidoptera:
Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe
 Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe Schmetterlinge im Schönbuch (III): Augenfalter von Ewald Müller In diesem Beitrag möchte ich Vertreter der Augenfalter (Satyridae) im Schönbuch vorstellen.
Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe Schmetterlinge im Schönbuch (III): Augenfalter von Ewald Müller In diesem Beitrag möchte ich Vertreter der Augenfalter (Satyridae) im Schönbuch vorstellen.
Tagfalter- Monitoring Deutschland
 Tagfalter- Monitoring Deutschland Ergebnisse 2006 (Bearbeitung: E. Kühn, A. Harpke, N. Hirneisen) Foto: Walter Müller (Niederzissen) Einführung Die Auswertung der Zähldaten des Jahres 2006 steht nun schon
Tagfalter- Monitoring Deutschland Ergebnisse 2006 (Bearbeitung: E. Kühn, A. Harpke, N. Hirneisen) Foto: Walter Müller (Niederzissen) Einführung Die Auswertung der Zähldaten des Jahres 2006 steht nun schon
Inhalt. Vorwort 15 Schmetterlinge 17. Edelfalter 27. Weißlinge 81. Bläulinge 91
 6 Inhalt Vorwort 15 Schmetterlinge 17 Ritterfalter 18 Schwalbenschwanz 18 Segelfalter 20 Roter Apollo 23 Edelfalter 27 Perlmutterfalter 27 Kaisermantel 28 Feuriger Perlmutterfalter 30 Randring-Perlmutterfalter
6 Inhalt Vorwort 15 Schmetterlinge 17 Ritterfalter 18 Schwalbenschwanz 18 Segelfalter 20 Roter Apollo 23 Edelfalter 27 Perlmutterfalter 27 Kaisermantel 28 Feuriger Perlmutterfalter 30 Randring-Perlmutterfalter
Tagfalter- Monitoring
 Jahresbericht 2011 Neuigkeiten 2012 Tagfalter- Monitoring Bearbeitung: Elisabeth Kühn, Martin Musche, Alexander Harpke, Reinart Feldmann, Birgit Metzler, Norbert Hirneisen und Josef Settele Schachbrett
Jahresbericht 2011 Neuigkeiten 2012 Tagfalter- Monitoring Bearbeitung: Elisabeth Kühn, Martin Musche, Alexander Harpke, Reinart Feldmann, Birgit Metzler, Norbert Hirneisen und Josef Settele Schachbrett
Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2016
 34 (2017) Band 34 (2017) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2016 Sofia Moscow 2017 Oedippus Band 34 (2017) Publikationsdatum Dezember 2017 Zeitschrift für Veröffentlichungen zu den Themenbereichen
34 (2017) Band 34 (2017) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2016 Sofia Moscow 2017 Oedippus Band 34 (2017) Publikationsdatum Dezember 2017 Zeitschrift für Veröffentlichungen zu den Themenbereichen
Zusatzmaterial. Würfel- Brettspiel
 Zusatzmaterial Würfel- Brettspiel Die Schüler können die Spielvorlage farbig gestalten. Einige der Felder müssen markiert werden. Gelangt ein Spieler auf ein solches markiertes Feld, bekommt er eine Frage
Zusatzmaterial Würfel- Brettspiel Die Schüler können die Spielvorlage farbig gestalten. Einige der Felder müssen markiert werden. Gelangt ein Spieler auf ein solches markiertes Feld, bekommt er eine Frage
Tagfalter- Monitoring Deutschland. Jahresbericht 2007 Neuigkeiten 2008
 Tagfalter- Jahresbericht 2007 Neuigkeiten 2008 Monitoring Deutschland (Bearbeitung: Elisabeth Kühn, Reinart Feldmann, Alexander Harpke, Norbert Hirneisen) Schornsteinfeger-Frühstück, Foto: Harm Glashoff
Tagfalter- Jahresbericht 2007 Neuigkeiten 2008 Monitoring Deutschland (Bearbeitung: Elisabeth Kühn, Reinart Feldmann, Alexander Harpke, Norbert Hirneisen) Schornsteinfeger-Frühstück, Foto: Harm Glashoff
Bunte Welt der Schmetterlinge - Tagschmetterlinge
 Bunte Welt der Schmetterlinge - Tagschmetterlinge Die Schmetterlinge sind mit weltweit über 185000 beschriebenen Arten die neben den Käfern die zweitreichste Insektenordnung LEPIDOPTERA In Deutschland
Bunte Welt der Schmetterlinge - Tagschmetterlinge Die Schmetterlinge sind mit weltweit über 185000 beschriebenen Arten die neben den Käfern die zweitreichste Insektenordnung LEPIDOPTERA In Deutschland
Die Tagschmetterlings- und Widderchenfauna der Briloner Hochfläche (Hochsauerlandkreis)
 Natur und Heimat, 63. Jahrg., Heft 3, 2003 Die Tagschmetterlings- und Widderchenfauna der Briloner Hochfläche (Hochsauerlandkreis) Martin Glöckner und Thomas Fartmann, Münster Einleitung Bislang erstreckte
Natur und Heimat, 63. Jahrg., Heft 3, 2003 Die Tagschmetterlings- und Widderchenfauna der Briloner Hochfläche (Hochsauerlandkreis) Martin Glöckner und Thomas Fartmann, Münster Einleitung Bislang erstreckte
04 Oltme - Liesbergweide, Liesberg
 04 Oltme - Liesbergweide, Liesberg Höhe : 680 X-Koord: 598.9 Y-Koord : 251.25 Ein grosses, aus mehreren Teilgebieten bestehendes Vorranggebiet am Hang oberhalb von Liesberg. Es handelt sich um überwiegend
04 Oltme - Liesbergweide, Liesberg Höhe : 680 X-Koord: 598.9 Y-Koord : 251.25 Ein grosses, aus mehreren Teilgebieten bestehendes Vorranggebiet am Hang oberhalb von Liesberg. Es handelt sich um überwiegend
1. Bemerkungen zum ErstBeo
 ERSTBEO Saarland 9/2010 Inhalt 1. Bemerkungen zum ErstBeo 2. Sonstige Bemerkungen 3. Die Regeln 4. Rangliste und Team-Wertung 5. ErstBeo- und LetztBeo-Liste 6. Die Raupen-Liste 1. Bemerkungen zum ErstBeo
ERSTBEO Saarland 9/2010 Inhalt 1. Bemerkungen zum ErstBeo 2. Sonstige Bemerkungen 3. Die Regeln 4. Rangliste und Team-Wertung 5. ErstBeo- und LetztBeo-Liste 6. Die Raupen-Liste 1. Bemerkungen zum ErstBeo
KULTURLANDSCHAFT LUNGERNSEE-WEST. Tagaktive Grossschmetterlinge als Bioindikatoren zur Erfolgskontrolle
 KULTURLANDSCHAFT LUNGERNSEE-WEST Tagaktive Grossschmetterlinge als Bioindikatoren zur Erfolgskontrolle Schlussbericht Dr. Karl Kiser April 2006 Kulturlandschaft Lungernsee-West Schlussbericht Dr. Karl
KULTURLANDSCHAFT LUNGERNSEE-WEST Tagaktive Grossschmetterlinge als Bioindikatoren zur Erfolgskontrolle Schlussbericht Dr. Karl Kiser April 2006 Kulturlandschaft Lungernsee-West Schlussbericht Dr. Karl
Die Tagfalter des Golfplatzes Feldafing
 Die Tagfalter des Golfplatzes Feldafing Bearbeitet von Dr. Annette von Scholley-Pfab LBV-Kreisgruppe München Ein Golfplatz kann für Schmetterlinge, wie diesen Rostfarbenen Dickkopffalter, ein wertvoller
Die Tagfalter des Golfplatzes Feldafing Bearbeitet von Dr. Annette von Scholley-Pfab LBV-Kreisgruppe München Ein Golfplatz kann für Schmetterlinge, wie diesen Rostfarbenen Dickkopffalter, ein wertvoller
1. Bemerkungen zum ErstBeo
 ERSTBEO Saarland 10/2010, 22.VIII Inhalt 1. Bemerkungen zum ErstBeo 2. Sonstige Bemerkungen 3. Die Regeln 4. Rangliste und Team-Wertung 5. ErstBeo- und LetztBeo-Liste 6. Die Raupen-Liste 1. Bemerkungen
ERSTBEO Saarland 10/2010, 22.VIII Inhalt 1. Bemerkungen zum ErstBeo 2. Sonstige Bemerkungen 3. Die Regeln 4. Rangliste und Team-Wertung 5. ErstBeo- und LetztBeo-Liste 6. Die Raupen-Liste 1. Bemerkungen
Band 30 (2014) Tagfalter-Monitoring Deutschland. Jahresbericht 2013
 Band 30 (2014) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2013 Bearbeitung Elisabeth Kühn, Martin Musche, Alexander Harpke, Reinart Feldmann, Martin Wiemers, Norbert Hirneisen, Birgit Metzler, Paula
Band 30 (2014) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2013 Bearbeitung Elisabeth Kühn, Martin Musche, Alexander Harpke, Reinart Feldmann, Martin Wiemers, Norbert Hirneisen, Birgit Metzler, Paula
Newsletter. Saarland 1/ (17/2011; )
 Newsletter NETZ mit ERSTBEO Saarland 1/2012 9.1.2012 (17/2011; 28.11.2011) Inhalt A Anhänge 1. AKTUELLES 2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO 3. Zuschriften 4. Rangliste und Team-Wertung 5. ERSTBEO- und
Newsletter NETZ mit ERSTBEO Saarland 1/2012 9.1.2012 (17/2011; 28.11.2011) Inhalt A Anhänge 1. AKTUELLES 2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO 3. Zuschriften 4. Rangliste und Team-Wertung 5. ERSTBEO- und
Zeig her deinen Schmetterlingsgarten
 Zeig her deinen Schmetterlingsgarten 13. Juli bis 6. August 2017 Citizen Science Projekt Schmetterlingszählung Lebendige Gärten! Es ist das Ende der Welt, sagte die Raupe - Es ist erst der Anfang sagte
Zeig her deinen Schmetterlingsgarten 13. Juli bis 6. August 2017 Citizen Science Projekt Schmetterlingszählung Lebendige Gärten! Es ist das Ende der Welt, sagte die Raupe - Es ist erst der Anfang sagte
Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2014
 31 (2015) Band 31 (2015) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2014 Sofia Moscow 2015 Oedippus Band 31 (2015) Publikationsdatum Dezember 2015 Zeitschrift für Veröffentlichungen zu den Themenbereichen
31 (2015) Band 31 (2015) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2014 Sofia Moscow 2015 Oedippus Band 31 (2015) Publikationsdatum Dezember 2015 Zeitschrift für Veröffentlichungen zu den Themenbereichen
DIE SCHMETTERLINGE LUXEMBURGS. fondation
 DIE SCHMETTERLINGE LUXEMBURGS 30 Joer fondation GEMEINER SCHNEEBALL UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE STIFTUNG Dank Ihrer Spenden konnte natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir d Natur in den vergangenen 30 Jahren über
DIE SCHMETTERLINGE LUXEMBURGS 30 Joer fondation GEMEINER SCHNEEBALL UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE STIFTUNG Dank Ihrer Spenden konnte natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir d Natur in den vergangenen 30 Jahren über
EGGE-WESER 1985/02 Band 3 / Heft
 EGGE-WESER 1985/02 Band 3 / Heft 2 85-93 "Jugend forscht" Wir legen hier zwei Arbeiten vor, die im Städtischen Gymnasium Beverungen entstanden. Der Schmetterlingsbericht fußt auf einer Jahresarbeit des
EGGE-WESER 1985/02 Band 3 / Heft 2 85-93 "Jugend forscht" Wir legen hier zwei Arbeiten vor, die im Städtischen Gymnasium Beverungen entstanden. Der Schmetterlingsbericht fußt auf einer Jahresarbeit des
Biodiversitätsindikatoren für Klimaveränderungen am Beispiel der Tagfalter und Libellen Sachsens
 Biodiversitätsindikatoren für Klimaveränderungen am Beispiel der Tagfalter und Libellen Sachsens Martin Wiemers, Maik Denner, Oliver Schweiger, Marten Winter Biodiversität & Klimawandel Vernetzung der
Biodiversitätsindikatoren für Klimaveränderungen am Beispiel der Tagfalter und Libellen Sachsens Martin Wiemers, Maik Denner, Oliver Schweiger, Marten Winter Biodiversität & Klimawandel Vernetzung der
Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.v. München, download unter
 Atalanta, Bd. X III, Heft 3, Dezember 1982, Würzburg, ISSN 0171-0079 Tagfalterbeobachtungen in Dalmatien/Jugoslawien von M A RTIN WIEMERS Während eines Aufenthaltes in Brela (50 km südöstl. Split) vom
Atalanta, Bd. X III, Heft 3, Dezember 1982, Würzburg, ISSN 0171-0079 Tagfalterbeobachtungen in Dalmatien/Jugoslawien von M A RTIN WIEMERS Während eines Aufenthaltes in Brela (50 km südöstl. Split) vom
Zahl und Häufigkeit der im Freiland
 24 Tagfalter in der Hellwegbörde Schmetterlinge machen Artenvielfalt sichtbar von Ralf Joest Zahl und Häufigkeit der im Freiland von jedermann zu beobachtenden Tagfalterarten geben wichtige Hinweise auf
24 Tagfalter in der Hellwegbörde Schmetterlinge machen Artenvielfalt sichtbar von Ralf Joest Zahl und Häufigkeit der im Freiland von jedermann zu beobachtenden Tagfalterarten geben wichtige Hinweise auf
Tagfalter- Monitoring Deutschland. Jahresbericht 2009 Neuigkeiten 2010
 Tagfalter- Jahresbericht 2009 Neuigkeiten 2010 Monitoring Deutschland (Bearbeitung: Elisabeth Kühn, Alexander Harpke, Martin Musche, Reinart Feldmann, Norbert Hirneisen) Foto: Distelfalter (Vanessa cardui)
Tagfalter- Jahresbericht 2009 Neuigkeiten 2010 Monitoring Deutschland (Bearbeitung: Elisabeth Kühn, Alexander Harpke, Martin Musche, Reinart Feldmann, Norbert Hirneisen) Foto: Distelfalter (Vanessa cardui)
Band 28 (2014) Tagfalter-Monitoring Deutschland. Jahresbericht 2012
 Band 28 (2014) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2012 Bearbeitung Elisabeth Kühn, Martin Musche, Alexander Harpke, Reinart Feldmann, Martin Wiemers, Birgit Metzler, Norbert Hirneisen und Josef
Band 28 (2014) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2012 Bearbeitung Elisabeth Kühn, Martin Musche, Alexander Harpke, Reinart Feldmann, Martin Wiemers, Birgit Metzler, Norbert Hirneisen und Josef
Tagfalter im Naturlehrgebiet Ettiswil
 Kantonsschule Willisau Oktober Maturaarbeit Tagfalter im Naturlehrgebiet Ettiswil Vorgelegt von: Referentin: Korreferent: Lara Egli Astrid Kuster-Baer Lukas Bruderer Fadenwegring 3 I der Sänti 18 Im Feld
Kantonsschule Willisau Oktober Maturaarbeit Tagfalter im Naturlehrgebiet Ettiswil Vorgelegt von: Referentin: Korreferent: Lara Egli Astrid Kuster-Baer Lukas Bruderer Fadenwegring 3 I der Sänti 18 Im Feld
Schmetterlinge (Lepidoptera) Stand:
 Artenliste Nationalpark : Schmetterlinge (Lepidoptera) Stand: 31.12.2006 Nr. Name 1 Häufigkeit Verbreitungs- Tagfalter Dickkopffalter (Hesperidae) 1 Rostfarbiger Dickkopffalter Ochlodes venata Wiesen,
Artenliste Nationalpark : Schmetterlinge (Lepidoptera) Stand: 31.12.2006 Nr. Name 1 Häufigkeit Verbreitungs- Tagfalter Dickkopffalter (Hesperidae) 1 Rostfarbiger Dickkopffalter Ochlodes venata Wiesen,
Artenhilfsprogramm Tagfalter. für die Davert und Hohe Ward
 NABU-Naturschutzstation Naturschutzstation Münsterland e.v. Artenhilfsprogramm Tagfalter für die Davert und Hohe Ward Artenhilfsprogramm Tagfalter für die Davert und Hohe Ward 1 Artenhilfsprogramm Tagfalter
NABU-Naturschutzstation Naturschutzstation Münsterland e.v. Artenhilfsprogramm Tagfalter für die Davert und Hohe Ward Artenhilfsprogramm Tagfalter für die Davert und Hohe Ward 1 Artenhilfsprogramm Tagfalter
Kartierung der Heuschrecken und Schmetterlinge auf den Wiesen des Frankhofes in Seugen
 Kartierung der Heuschrecken und Schmetterlinge auf den Wiesen des Frankhofes in Seugen Bastian Partzsch 04.08.2009 Im Auftrag des Bund Naturschutz in Bayern e.v., Kreisgruppe Pfaffenhofen a. d. Ilm 1.
Kartierung der Heuschrecken und Schmetterlinge auf den Wiesen des Frankhofes in Seugen Bastian Partzsch 04.08.2009 Im Auftrag des Bund Naturschutz in Bayern e.v., Kreisgruppe Pfaffenhofen a. d. Ilm 1.
Blühender Zollernalbkreis TAGFALTER IM ZOLLERNALBKREIS
 Blühender Zollernalbkreis TAGFALTER IM ZOLLERNALBKREIS 1 Inhaltsverzeichnis: Seite Vorwort... 3 Einleitung... 4 Schme"erlinge - vom Leben der bunten Flieger... 5 Lebensräume für Schme"erlinge im Zollernalbkreis...
Blühender Zollernalbkreis TAGFALTER IM ZOLLERNALBKREIS 1 Inhaltsverzeichnis: Seite Vorwort... 3 Einleitung... 4 Schme"erlinge - vom Leben der bunten Flieger... 5 Lebensräume für Schme"erlinge im Zollernalbkreis...
Checkliste und Rote Liste der Tagschmetterlinge der Stadt Wien, Österreich (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea)
 Beiträge zur Entomofaunistik 3 103-123 Wien, Dezember 2002 Checkliste und Rote Liste der Tagschmetterlinge der Stadt Wien, Österreich (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea) Helmut Höttinger * Abstract
Beiträge zur Entomofaunistik 3 103-123 Wien, Dezember 2002 Checkliste und Rote Liste der Tagschmetterlinge der Stadt Wien, Österreich (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea) Helmut Höttinger * Abstract
Tagfalter- Monitoring Deutschland
 Jahresbericht 2010 Neuigkeiten 2011 Tagfalter- Monitoring Deutschland (Bearbeitung: Elisabeth Kühn, Alexander Harpke, Martin Musche, Reinart Feldmann, Norbert Hirneisen) Foto: C-Falter (Nymphalis c-album)
Jahresbericht 2010 Neuigkeiten 2011 Tagfalter- Monitoring Deutschland (Bearbeitung: Elisabeth Kühn, Alexander Harpke, Martin Musche, Reinart Feldmann, Norbert Hirneisen) Foto: C-Falter (Nymphalis c-album)
3. Ergebnisse. Naturinventar Aarau Ergebnisse
 Ergebnisse 3. Ergebnisse 3.1 Vorkommen von Arten und Lebensräumen 14 3.1.1 Pilze (Karte 4 mit separater Artenliste) 14 3.1.2 Moose und Gefässpflanzen (Karte 5 mit separater Artenliste) 14 3.1.3 Säugetiere
Ergebnisse 3. Ergebnisse 3.1 Vorkommen von Arten und Lebensräumen 14 3.1.1 Pilze (Karte 4 mit separater Artenliste) 14 3.1.2 Moose und Gefässpflanzen (Karte 5 mit separater Artenliste) 14 3.1.3 Säugetiere
News letter In ter n et- Zeits c hr ift. Saarland. Nr. 12/ (Nr )
 News letter In ter n et- Zeits c hr ift NETZ mit ERSTBEO Saarland Nr. 12/2012 20.9. (Nr. 11 30.8.) Inhalt A Anhänge 1. AKTUELLES 2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO 3. Zuschriften 4. Rangliste und Team-Wertung
News letter In ter n et- Zeits c hr ift NETZ mit ERSTBEO Saarland Nr. 12/2012 20.9. (Nr. 11 30.8.) Inhalt A Anhänge 1. AKTUELLES 2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO 3. Zuschriften 4. Rangliste und Team-Wertung
News letter. Saarland. Nr. 7/ (Nr )
 News letter NETZ mit ERSTBEO Saarland Nr. 7/2012 6.6. (Nr. 6 13.5.) Inhalt A Anhänge 1. AKTUELLES 2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO 3. Zuschriften 4. Rangliste und Team-Wertung 5. ERSTBEO- und LETZTBEO-Liste
News letter NETZ mit ERSTBEO Saarland Nr. 7/2012 6.6. (Nr. 6 13.5.) Inhalt A Anhänge 1. AKTUELLES 2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO 3. Zuschriften 4. Rangliste und Team-Wertung 5. ERSTBEO- und LETZTBEO-Liste
Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2016
 32 (2016) Band 32 (2016) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2016 Sofia Moscow 2016 Oedippus Band 32 (2016) Publikationsdatum Dezember 2016 Zeitschrift für Veröffentlichungen zu den Themenbereichen
32 (2016) Band 32 (2016) Tagfalter-Monitoring Deutschland Jahresbericht 2016 Sofia Moscow 2016 Oedippus Band 32 (2016) Publikationsdatum Dezember 2016 Zeitschrift für Veröffentlichungen zu den Themenbereichen
Schmetterlinge in Hildesheim
 Schmetterlinge in Hildesheim Fotoführer Tagfalter und Widderchen Guido Madsack 2 Schmetterlinge in Hildesheim Schmetterlinge symbolisieren Schönheit, Romantik und Lebensfreude. Der Anblick einer blütenreichen
Schmetterlinge in Hildesheim Fotoführer Tagfalter und Widderchen Guido Madsack 2 Schmetterlinge in Hildesheim Schmetterlinge symbolisieren Schönheit, Romantik und Lebensfreude. Der Anblick einer blütenreichen
Naturkundliche Reise Extremadura (21. April 30. April 2014)
 Naturkundliche Reise Extremadura (21. April 30. April 2014) Zoologische Beobachtungen (ausser Vögel) Montag, 21. April (Toril: Picknickplatz inmitten einer Dehesa) Amphibien: einige Spanische Wasserfrösche
Naturkundliche Reise Extremadura (21. April 30. April 2014) Zoologische Beobachtungen (ausser Vögel) Montag, 21. April (Toril: Picknickplatz inmitten einer Dehesa) Amphibien: einige Spanische Wasserfrösche
Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Rhopalocera und Zygaenidadae)
 202 Obersand 08 Sommer der alpinen Artenvielfalt Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Rhopalocera und Zygaenidadae) Edwin Kamer-Müller, Näfels, Fridli Marti-Moeckli, Mollis, Roland Müller-Landolt, Näfels
202 Obersand 08 Sommer der alpinen Artenvielfalt Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Rhopalocera und Zygaenidadae) Edwin Kamer-Müller, Näfels, Fridli Marti-Moeckli, Mollis, Roland Müller-Landolt, Näfels
Steppenrasen. Das FEDERGRAS (Stipa pennata) oder der. WALLISER WERMUT (Artemisia valesiaca) gehören. 1. GEMEINER SCHECKENFALTER Melitaea cinxia
 1. Steppenrasen Nach der letzten Eiszeit wurden die trockenen, sonnenexponierten Hänge des Wallis durch eine reichhaltige Steppenvegetation besiedelt. Das FEDERGRAS (Stipa pennata) oder der WALLISER WERMUT
1. Steppenrasen Nach der letzten Eiszeit wurden die trockenen, sonnenexponierten Hänge des Wallis durch eine reichhaltige Steppenvegetation besiedelt. Das FEDERGRAS (Stipa pennata) oder der WALLISER WERMUT
Untersuchungen zur Fauna der Tagfalter und tagaktiven Nachtfalter
 Laufener Forschungsbericht 2, S. 97-105 Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL) - Laufen/Salzach 1996 Untersuchungen zur Fauna der Tagfalter und tagaktiven Nachtfalter Walter Sage und Manfred Siering 1. Kurzbeschreibung
Laufener Forschungsbericht 2, S. 97-105 Akad.Natursch.Landschaftspfl. (ANL) - Laufen/Salzach 1996 Untersuchungen zur Fauna der Tagfalter und tagaktiven Nachtfalter Walter Sage und Manfred Siering 1. Kurzbeschreibung
Konzeption und Errichtung eines zweisprachigen Schmetterlings-Lehrpfades im Naturpark Geschriebenstein- Irottkö, Burgenland
 Auch Entomofaunistik basiert auf der Kenntnis von Arten... Hallo Entomofaunisten, herzlich willkommen bei NOBIS Austria! Dr. Ulrike Aspöck, Naturhistorisches Museum Wien, Zweite Zoologische Abteilung,
Auch Entomofaunistik basiert auf der Kenntnis von Arten... Hallo Entomofaunisten, herzlich willkommen bei NOBIS Austria! Dr. Ulrike Aspöck, Naturhistorisches Museum Wien, Zweite Zoologische Abteilung,
Rote Liste Tagfalter Sachsens. Naturschutz und Landschaftspflege. Landesamt für Umwelt und Geologie
 Rote Liste Tagfalter Sachsens Naturschutz und Landschaftspflege Landesamt für Umwelt und Geologie Impressum / Kontakt Impressum Naturschutz und Landschaftspflege Rote Liste Tagfalter Sachsens Herausgeber:
Rote Liste Tagfalter Sachsens Naturschutz und Landschaftspflege Landesamt für Umwelt und Geologie Impressum / Kontakt Impressum Naturschutz und Landschaftspflege Rote Liste Tagfalter Sachsens Herausgeber:
Viel-Falter: Tagfalter Monitoring Tirol
 Viel-Falter: Tagfalter Monitoring Tirol Der erste systematische Versuch in Österreich, die Schmetterlingsvielfalt zu erheben Region: Nord- und Osttirol (Erweiterung geplant) Unterstützte Organisation:
Viel-Falter: Tagfalter Monitoring Tirol Der erste systematische Versuch in Österreich, die Schmetterlingsvielfalt zu erheben Region: Nord- und Osttirol (Erweiterung geplant) Unterstützte Organisation:
Schmetterlinge des Meerbachtals (Arik Siegel)
 Schmetterlinge des Meerbachtals (Arik Siegel) Aurorafalter (Anthocharis cardamines) Aurorafalter gehören zur Familie der Weißlinge. Sie fliegen von etwa Anfang April bis Ende Juni. Sie gehören somit zu
Schmetterlinge des Meerbachtals (Arik Siegel) Aurorafalter (Anthocharis cardamines) Aurorafalter gehören zur Familie der Weißlinge. Sie fliegen von etwa Anfang April bis Ende Juni. Sie gehören somit zu
FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT
 FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT IN DER SCHWEIZ UND IM KANTON BERN Weshalb verändert sich die Biodiversität? Die Biodiversität verändert sich zum einen durch langfristige und grossräumige
FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT IN DER SCHWEIZ UND IM KANTON BERN Weshalb verändert sich die Biodiversität? Die Biodiversität verändert sich zum einen durch langfristige und grossräumige
Faunistische Erfassung. der geplanten Eingriffsfläche für die geplante Erweiterung. des Betriebsgelände HBM Asphalt in Herborn
 Faunistische Erfassung der geplanten Eingriffsfläche für die geplante Erweiterung des Betriebsgelände HBM Asphalt in Herborn Linden, November 2017 Auftragnehmer: Büro für faunistische Fachfragen Dipl.-Biologe
Faunistische Erfassung der geplanten Eingriffsfläche für die geplante Erweiterung des Betriebsgelände HBM Asphalt in Herborn Linden, November 2017 Auftragnehmer: Büro für faunistische Fachfragen Dipl.-Biologe
Parornix petiolella (FREY, 1863), ein Erstnachweis für Nordrhein-Westfalen (Lep., Gracillariidae)
 Melanargia, 24 (3): 87-88 Leverkusen, 1.10.2012 Parornix petiolella (FREY, 1863), ein Erstnachweis für Nordrhein-Westfalen (Lep., Gracillariidae) von HANS RETZLAFF Zusammenfassung: Bei Warburg in Ostwestfalen
Melanargia, 24 (3): 87-88 Leverkusen, 1.10.2012 Parornix petiolella (FREY, 1863), ein Erstnachweis für Nordrhein-Westfalen (Lep., Gracillariidae) von HANS RETZLAFF Zusammenfassung: Bei Warburg in Ostwestfalen
LIFE-Natur-Projekt. Lebendige Bäche in der Eifel
 LIFE-Natur-Projekt Lebendige Bäche in der Eifel Monitoring Tagfalter Auftraggeber Biologische Stationen im Kreis Euskirchen und im Kreis Aachen e.v. c/o Biologische Station im Kreis Euskirchen e.v. Steinfelder
LIFE-Natur-Projekt Lebendige Bäche in der Eifel Monitoring Tagfalter Auftraggeber Biologische Stationen im Kreis Euskirchen und im Kreis Aachen e.v. c/o Biologische Station im Kreis Euskirchen e.v. Steinfelder
