die region der region?
|
|
|
- Kornelius Schräder
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Was bringt die region der region? Planung und ManageMent für die Stadtregion DoKUMENTATIoN Nr. 127 Beiträge zur regionalen Entwicklung
2 Was bringt die region der region? Planung und Management für die Stadtregion Fachtagung am 12. Oktober 2011 anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Region Hannover Dokumentation
3 VORWORt 10 Jahre Region Hannover dieses Ereignis war im Jahr 2011 Anlass für Regionsversammlung und Regionsverwaltung, auf ein Jahrzehnt engagierter Aufbauarbeit für eine neuartige stadtregionale Organisationsstruktur zurückzublicken. Mit mehreren Veranstaltungen präsentierte sich die Region der regionalen und überregionalen Öffentlichkeit und stellte sich der Diskussion über aktuelle und künftige Herausforderungen. Was bringt die Region der Region? Dies ist eine interessante Frage nicht nur für uns in der Region Hannover, sondern beschäftigt auch Akteure aus Politik und Verwaltung in anderen Stadtregionen. Sie war das Motto zu einer besonders eindrucksvollen Veranstaltung, die wir im Jubiläumsjahr in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände durchgeführt haben. Gemeinsam mit den Mitgliedern dieser Arbeitsgemeinschaft haben wir am 12. Oktober 2011
4 eine Fachtagung organisiert, in der wir gute Beispiele für Planung und Management in den Stadtregionen präsentiert und diskutiert haben. Obwohl die Region Hannover kein Regionalverband im engeren Sinne, sondern eine regionale Gebietskörperschaft ist, fühlen wir uns dieser Arbeitsgemeinschaft weiterhin eng verbunden. Unser Rechtsvorgänger, der Kommunalverband Großraum Hannover, hat von Beginn an intensiv in dieser Arbeitsgemeinschaft mitgewirkt und auch wir als Region suchen den Erfahrungsaustausch mit den anderen deutschen Stadtregionen, in denen jeweils sehr unterschiedlich strukturierte Institutionen an stadtregionalen Gemeinschaftsaufgaben arbeiten. alle Mitwirkenden und Gäste viele neue Erkenntnisse gebracht und die Vernetzung der stadtregionalen Institutionen weiter gefördert hat. Wir danken den Fachleuten für ihre Beiträge zu dieser tagung und freuen uns, mit dieser Dokumentation die tagungsergebnisse vorzulegen, die in der Fachwelt auf großes Interesse stoßen dürften. Auch allen anderen Beteiligten, die zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung beigetragen haben, gilt unser besonderer Dank. In der Rückschau war diese Fachveranstaltung im Regionshaus, zu der wir rund 200 Gäste aus nah und fern begrüßen konnten, ein großartiges Ereignis, das sowohl für uns als Veranstalter als auch für Hauke Jagau Regionspräsident Axel Priebs Erster Regionsrat
5 INHALtSVERZEICHNIS begrüssung und grussworte Hauke Jagau Region Hannover 12 Dr. Dieter Karlin AG Regionalverbände in Ballungsräumen 14 Helmut Etschenberg StädteRegion Aachen 16 Folkert Kiepe Deutscher Städtetag 18 vortrag Kooperation in der Stadtregion Prof. Dr. Rainer Danielzyk 20
6 10 Jahre Region Hannover Hauke Jagau 28 Stadtregionale Kooperation im Großraum Poznań Prof. Dr. Tomasz Kaczmarek 38 plenumsdiskussion Moderation: Andreas Kuhnt 48 Workshop 1 Freiraum und erholung Landschaftspark Region Stuttgart Neue Wege der Freiraumentwicklung Silvia Weidenbacher 54 Gartenregion Hannover Baustein der regionalen Naherholung Astrid Eblenkamp 58
7 Die Montanregion Erzgebirge eine Kulturlandschaft auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe Dr. Jens Uhlig 64 Das Leipziger Neuseenland zwischen aktivem Braunkohlenbergbau und Landschaften nach der Kohle Prof. Dr. Andreas Berkner 68 plenumsdiskussion Moderation: Ulrich Kinder 74 Workshop 2 steuerung des grossflächigen einzelhandels Die Bewertung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben im Großraum Braunschweig vor dem Hintergrund des Regionalen Einzelhandelskonzeptes Jens Palandt 78 Regionalplanerische Steuerung von Einzelhandelsstandorten in der Region Stuttgart Martin Wiemann 82
8 Das Regionale Einzelhandelskonzept für den Ballungsraum FrankfurtRheinMain Matthias Drexelius 86 Erfahrungen mit der verbindlichen Steuerung des großflächigen Einzelhandels in der Region Hannover Susanne Borchert 90 plenumsdiskussion Moderation: Susanne Krebser 96 Workshop 3 klimaschutz und erneuerbare energien Der Beitrag informeller Instrumente zum Klimaschutz Was kann die Regionalplanung leisten? Am Beispiel der Region Südlicher Oberrhein Dr. Dieter Karlin 100 Windkraftkonzeption Industrieregion Mittelfranken Die Steuerung der Errichtung von Windkraftanlagen auf regionaler Ebene Thomas Müller 106
9 Klimawandel in der Regionalplanung Michael Bongartz 110 Der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima: Neue Schwerpunkte in der Verkehrsplanung der Region Hannover im Zeichen des Klimaschutzes Klaus Geschwinder 116 plenumsdiskussion Moderation: Sonja Papenfuß 122 beispiele zum stadtregionalen management in der region hannover Sozialer Lastenausgleich in der Stadt-Umland-Beziehung Erwin Jordan 124 Attraktiver Öffentlicher Personennahverkehr durch Aufgabenbündelung Ulf-Birger Franz 128
10 Workshop 4 stadtregionale planungsinstrumente Der gemeinsame Flächennutzungsplan Überlegungen zum Problemlösungspotenzial des Instrumentes am Beispiel des Zweckverbandes Raum Kassel Andreas Vesper 134 Der Regionalplan Christian Breu 140 Der Regionale Flächennutzungsplan Matthias Drexelius 146 Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar: Regionalplanung in drei Bundesländern Christoph Trinemeier 150 plenumsdiskussion Moderation: Prof. Dr. Axel Priebs 153
11 Workshop 5 stadtregionen ohne grenzen (kooperation über landes- und bundesgrenzen hinweg) Stadtregionen ohne Grenzen das Beispiel Bremen Dr. Ralph Baumheier 156 Gemeinschaftliche Regionalentwicklung in der Metropolregion Rhein-Neckar Ralph Schlusche 160 Eurodistrikt SaarMoselle die andere Metropolregion Peter Gillo 164 AG Charlemagne neue Perspektiven der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Euregio Maas-Rhein Markus Terodde 168 plenumsdiskussion Moderation: Barbara Thiel 170
12 ausblick Stadtregionale Organisationen heute und morgen Prof. Dr. Axel Priebs 172 abschlussdiskussion Moderation: Andreas Kuhnt 181 schlusswort 182
13 BEGRÜSSUNG Hauke Jagau, Regionspräsident Region Hannover Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Was bringt die Region der Region? Was erwarten wir heute? Wir als Region erwarten in erster Linie einen sehr spannenden Dialog, weil es bei uns zwar durchaus das Bewusstsein gibt, dass vieles, was für uns normal erscheint, für andere Regionen nicht normal ist. Aber gelegentlich merkt man selbst auch gar nicht mehr, dass sich in den letzten Jahren schon vieles zum Positiven verändert hat oder auf der anderen Seite auch noch besser gehen kann. Eine Veranstaltung wie diese kann daher auch für die eigene Organisation wichtige Fingerzeige geben. Die Region Hannover wird dieses Jahr zehn Jahre alt und das ist eine gute Gelegenheit zu betrachten, was sich verändert hat und wie das System Region Hannover funktioniert. Darüber wollten wir gerne in einen Fachaustausch kommen. Wir haben uns daher sehr über eine so tolle Resonanz mit 250 Anmeldungen gefreut. Es ist sehr schön, dass Sie sich heute mit uns in diesen Austausch begeben wollen. Ich bin deshalb sehr gespannt über den weiteren Verlauf. Einige teilnehmer möchte ich gesondert begrüßen: Ich begrüße besonders Herrn Verbandsdirektor Dr. Dieter Karlin aus Freiburg, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Regionalverbände in Ballungsräumen. Das ist natürlich hier eines unser zentralen themen, denn wir sind ein Ballungsraum und daher werden die damit zusammenhängenden Frage- und Problemstellungen ein zentraler Bestandteil dieser Veranstaltung sein. Ebenfalls begrüße ich ganz herzlich den Verbandsdirektor des Regionalverbandes Saarbrücken, Herrn Peter Gillo, mit dem schon unser Rechtsvorgänger der Kommunalverband Großraum Hannover eine sehr enge Zusammenarbeit verbunden hat. Auch hier bin ich sicher, dass wir einen spannenden Austausch haben werden. Eine Organisation möchte ich bei der Begrüßung ebenfalls hervorheben, die jetzt ähnlich der Region Hannover organisiert ist: Die Städteregion Aachen, die seit 2009 besteht und hier durch den Städteregionsrat Herrn Helmut Etschenberg vertreten ist. 12 BEGRÜSSUNG
14 Und natürlich ist auch die Dachorganisation der deutschen Städte hier heute vertreten und ich begrüße herzlich den Beigeordneten Herrn Folkert Kiepe vom Deutschen Städtetag. Gleichermaßen begrüße ich natürlich ganz herzlich die Herrn Professoren Dr. tomasz Kaczmarek und Dr. Rainer Danielzyk von der Universität Poznan und der Universität Hannover. Beide werden Sie im weiteren Verlauf noch als Referenten erleben. Bedanken möchte mich an dieser Stelle bei all den Kolleginnen und Kollegen, die diese Veranstaltung überhaupt ermöglicht haben. Allen vorweg Herrn Professor Dr. Axel Priebs, der einer der Akteure war, die entscheidend mit dazu beigetragen haben, dass die Region Hannover gebildet werden konnte. Und ganz besonders möchte ich auch dem gesamten Organisationsteam einen herzlichen Dank aussprechen. Ich freue mich, dass Sie da sind und hoffe, dass wir dann am Ende der Veranstaltung mit neuen Gedanken und neuen Erkenntnissen auseinander gehen. BEGRÜSSUNG 13
15 GRUSSWORt Dr. Dieter Karlin, Vorsitzender AG Regionalverbände in Ballungsräumen Für Ihre Einladung, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen, danke ich herzlich. Diesen Dank verbinde ich mit den allerbesten Glückwünschen der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in Ballungsräumen zum zehnjährigen Bestehen der Region Hannover. Zehn Jahre sind für einen Süddeutschen zu kurz, um einen Jubilar hochleben zu lassen. Bei uns in Baden gratulieren wir üblicherweise anlässlich eines 20-jährigen Bestehens, dass die betreffende Institution nun erwachsen geworden ist. Sie werden mir sicher zustimmen, dass ein derart salopp formulierter Glückwunsch für die Region Hannover völlig unangemessen wäre. Schließlich hatte die Region Hannover bereits bei ihrem Gründungsakt das Stadium des Erwachsenseins erreicht. Gleichwohl sind zehn Jahre eine zeitliche Zäsur, bei der es gut und richtig ist, das Erreichte zu reflektieren und neue Impulse für die künftige Entwicklung zu diskutieren. Vor diesem Hintergrund haben wir, das heißt die Kolleginnen und Kollegen unserer Arbeitsgemeinschaft, gerne die Einladung von Herrn Ersten Regionsrat Prof. Dr. Axel Priebs angenommen, mit Ihnen im Rahmen einer Fachtagung Best Practises aus den verschiedenen Regionen zu präsentieren und uns hierüber im Sinne einer trag-fähigen Weiterentwicklung der Region Hannover, aber natürlich auch der anderen hier vertretenen Regionen auszutauschen. Dies gilt umso mehr, als die Region Hannover und zuvor der Kommunalverband Großraum Hannover, vor allem in der Person unseres Kollegen Axel Priebs, der seit vielen Jahren engagiert in der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in Ballungsräumen mitarbeitet, eine der treibenden Kräfte der Arbeitsgemeinschaft ist. Der von uns gepflegte regelmäßige gegenseitige Austausch war, ist und wird auch in Zukunft ein Impulsgeber für unsere Regionen sein. Schließlich hat sich die Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in Ballungsräumen seit vielen Jahren auch die Aufgabe gestellt, die Anliegen der Stadtregionen beziehungsweise der Ballungsräume nach außen zu tragen. Unsere gemeinsame Broschüre hat jedenfalls in unserer Region eine breite Resonanz erfahren. In unserer Arbeitsgemeinschaft sind sehr verschiedene Organisationen vertreten. Neben einer eher informellen 14 GRUSSWORt
16 Organisationsstruktur im Raum um den Stadtstaat Bremen haben wir zahlreiche verfasste Regionen bei uns: Stadtregionale Planungsverbände finden sich beispielsweise in Frankfurt, Dresden, München und auch bei uns am Südlichen Oberrhein, mit der Schwarzwald-Hauptstadt Freiburg; ganz besonders zu erwähnen sind hier auch länderübergreifende Verbände wie der Verband Region Rhein-Neckar. Wir haben aber auch Verbände, die mehrere Aufgaben bündeln, die sinnvollerweise nur auf dieser überörtlichen Ebene bearbeitet werden können. So ist der Verband Region Stuttgart mit seiner Regionalversammlung neben der Regionalplanung unter anderem zuständig für den S-Bahn-Verkehr, die Wirtschaftsförderung und die Messe. Der traditionsreiche Regionalverband Ruhr ist neben der Regionalplanung verantwortlich für die Freizeitund Erholungsflächen sowie für das Standortmarketing. In der Gesamtschau bleibt festzuhalten: Die Regionen sind zwar unterschiedlich organisiert, der Umfang der zugewiesenen Aufgaben ist unterschiedlich definiert; dennoch ist allen gemein, dass sie ein breites Spektrum an raumrelevanten Aufgaben erfüllen und damit in unterschiedlicher Intensität raumrelevante Gesellschaftspolitik betreiben. Unserem Kollegen und Freund Axel Priebs darf ich gratulieren, dass es ihm gelungen ist, ein tagungsprogramm auf die Beine zu stellen, das in der tat das breite Spektrum der von den Regionen bearbeiteten themen abbildet. Ich bin mir sicher, dass Sie alle von der heutigen Veranstaltung viele wertvolle Anregungen und Impulse für Ihre eigene Arbeit mitnehmen werden. Kurzum: Wir werden alle vom heutigen tag profitieren. Und schließlich haben wir die stadtregionalen Gebietskörperschaften, bei denen für Kernstädte und Nachbarkommunen unter einem gemeinsamen Dach alle stadtregionalen Aufgaben konzipiert sind so beim Regionalverband Saarbrücken, bei der StädteRegion Aachen und bei Ihnen hier, der Region Hannover. GRUSSWORt 15
17 GRUSSWORt Helmut Etschenberg, Städteregionsrat, StädteRegion Aachen Sie feiern heute das zehnjährige Bestehen der Region Hannover. Dazu gratuliere ich Ihnen aus dem Aachener Dreiländereck von ganzem Herzen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass Sie sich heute mehr als Ihre zehnjährige Zusammenarbeit in der Region Hannover bewusst machen. Denn alles hat seine eigene Geschichte. Sie haben bereits vor Jahrzehnten verstanden, dass Kooperation die einzig richtige Antwort auf die immer wieder neu auf die kommunale und auf die regionale Ebene zukommenden Herausforderungen ist. Damit waren Sie anderen Regionen ein gutes, ein weites Stück voraus. Mit großem Interesse haben wir in der Aachener Region auf Ihre Entwicklungen geschaut. In einzelnen themenkreisen gab es auch bei uns im Dreiländereck von Deutschland, den Niederlanden und Belgien die Überzeugung, dass Zusammenarbeit notwendig und zielführend ist. So entstanden bei uns Kooperationen innerhalb der Aachener Region mit dem Ziel, den Anfang der 1970er Jahre aufgelösten Regierungsbezirk Aachen mit dem unbestritten bedeutenden Oberzentrum Aachen als Kraftzentrum auf andere Weise zusammenzuhalten. Zweckverbände oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Vereine wurden für einzelne Aufgaben gegründet, wie zum Beispiel Abfallentsorgung, berufsbildendes Schulwesen, tourismus, technologietransfer, Öffentlicher Personennahverkehr, Straßenverkehrsamt und so weiter. Da uns diese Entwicklung aber deutlich machte, dass damit immer mehr Aufgaben atomisiert und die direkte politische Kontrolle immer mehr reduziert wurde, haben wir uns im Jahr 2004 entschlossen, einen Zweckverband StädteRegion Aachen zwischen der Stadt Aachen und dem Kreis Aachen zu bilden. Dabei waren sowohl die Nachbarkreise des alten Regierungsbezirks als auch die niederländischen und belgischen Nachbarn mit Gaststatus eingeladen. Die Zusammenarbeit war erfolgreich, weil Vertrauen geschaffen wurde. Und es stieg die Einsichtsfähigkeit, den in der kreisfreien Stadt Aachen ansässigen Kreis Aachen als auch die Stadt Aachen bei teilweise gleichen Aufgaben (der Kreisstufe) enger zusammenzuführen. Daraus ist auf Wunsch aller kreisangehörigen Kommunen und der kreisfreien Stadt Aachen mit überzeugenden Ratsbeschlüssen über alle Parteien hinweg das 16 GRUSSWORt
18 sogenannte Aachen-Gesetz vom Landtag Nordrhein Westfalen beschlossen worden. Wir hatten zur Vorbereitung auf die neue Zeit also nur wenige Jahre, während Sie in der Region Hannover über Jahrzehnte hinweg bereits in schwierigen themenbereichen gemeinsam und erfolgreich unterwegs waren. Und Sie hatten ein das Gemeinschafts- und Wir- Gefühl enorm förderndes Megaprojekt vor Augen: die Weltausstellung EXPO Das war aus meiner Sicht als Außenstehender ein Glücksfall, der die Region Hannover von einem tag auf den anderen auf die Weltkarte der interessanten Metropolen brachte. Ein solch vergleichbares Megaprojekt gab und gibt es bei uns nicht. Neben der Kooperation steht wegen der finanziell bedrohlichen Situation der öffentlichen Haushalte daher auch die Hebung von Synergien im Vordergrund. Die vorgesehenen drei Millionen Euro Einsparungen pro Jahr werden wir ab dem kommenden Jahr auch nachweisen können. Momentan werden die fusionierten Ämter auch räumlich zusammengeführt, ein Muss, um die gewollten Effekte zu erreichen. Was uns fehlt, sind staatliche Kompetenzen, die Sie mit der Zuständigkeit der Regional- und Landesplanung für die Region Hannover zugewiesen bekommen haben. Dazu kann man ganz besonders gratulieren, denn damit kann die Region Hannover real, kraftvoll und angemessen auf ihre Gesamtentwicklung reagieren. Staatliche Kompetenzen wie die Landesplanung haben wir gefordert, aber nicht bekommen. Es gab auch keine Bereitschaft der Landesregierung, die schulformübergreifende Schulaufsicht als Modell auf unsere Region zu übertragen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass wir uns in unserem bald zweijährigen Gebilde Städte- Region Aachen noch ein Stück schwer tun. Zunächst auch mit uns selbst. Auf Seiten der StädteRegion Aachen mit dem Umgang der neuen Kompetenzen und Beschlüssen eines Städteregionstages. Dieser umfasst erstmals Ratsmitglieder aus der kreisfreien Stadt Aachen und bindet auch die regionsangehörige und kreisfreie Stadt Aachen. Und auf der anderen Seite mit der Situation einer kreisfreien Stadt mit rund Einwohnern im Verbund, mit neun weiteren regionsund kreisangehörigen Kommunen, die mit der Kreisordnung als Kommunalverfassung der StädteRegion vertraut sind. Wir schauen daher mit ganz besonderem Interesse auf den trendsetter Region Hannover und werden uns im direkten Austausch gute Ratschläge einholen. Denn meine Überzeugung ist, dass wir es uns in den kommenden Jahren beziehungsweise Jahrzehnten nicht mehr erlauben können, kleinkariert nebeneinander Ressourcen zu vergeuden. Wir werden dann nicht in der Lage sein, die Antworten als kommunale und regionale Ebene auf die Fragen zu geben, welche die Wirtschaft aus Gründen des Überlebens täglich geben muss: Effizienz, Bedeutungsgewinn und regionale Kooperation sind das Gebot der Stunde. Die Region Hannover hat dies bereits vor zehn Jahren final erkannt. Gerne erkennen wir Ihren Pioniergeist an und wünschen Ihnen weiter Erfolg. GRUSSWORt 17
19 GRUSSWORt Folkert Kiepe, Beigeordneter Deutscher Städtetag Zu Geburtstagen kommt man ja generell gerne, aber zum zehnjährigen Bestehen der Region Hannover bin ich mit besonderer Freude angereist: Zum einen, weil ich die schwierigen Vorarbeiten der Regionsbildung und die damit verbundenen politischen Kontroversen noch gut in Erinnerung habe und auch die Skepsis, die dem damaligen Hannoveraner Oberbürgermeister Schmalstieg im Präsidium des Deutschen Städtetages von Oberbürgermeistern anderer Großstädte entgegenschlug. Man sah nämlich bei den Großstädten weniger die Vorteile interkommunaler Zusammenarbeit, sondern mehr die Einkreisung der oberzentralen, kreisfreien Kernstadt. Heute aber können Sie und wir gemeinsam entgegen allen Unkenrufen auf zehn Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit in dieser Region zurückblicken; dazu möchte ich Ihnen gratulieren! Zum anderen freue ich mich, weil mit der Region Hannover ein gutes ich meine sehr gutes Beispiel regionaler Zusammenarbeit geschaffen wurde, und zwar durch die kommunalen Gebietskörperschaften selbst, nicht von Staats wegen. Ich hoffe, dass dieses Beispiel noch viele Nachahmer finden wird. Denn nach über zwanzigjähriger Befassung mit Prozessen interkommunaler Zusammenarbeit bin ich persönlich davon überzeugt: Sowohl die demographischen Veränderungen und die damit verbundene Stärkung der Städte und Gemeinden in verdichteten Räumen, als auch die Sparzwänge aufgrund der kommunalen Finanzlage und die Notwendigkeit, die verschiedenen bereits bestehenden Formen interkommunaler Zusammenarbeit in den jeweiligen Regionen über die Weidezäune der einzelnen Fachbereiche hinaus zu koordinieren und auf eine demokratisch legitimierte Grundlage zu stellen müssen mittelfristig in den Verdichtungsräumen Deutschlands und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu einer verstärkten Bildung von Städteregionen führen. 18 GRUSSWORt
20 Der Deutsche Städtetag begleitet diesen Diskussionsprozess seit Anfang der 1990er Jahre und wird auch in Zukunft alles dafür tun, dass der Erfahrungsaustausch, den Sie hierzu seit Jahren in der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in Ballungsräumen intensiv betreiben, auch in den Fachgremien des Deutschen Städtetages noch stärker aufgenommen und unterstützt wird. Die heutige Veranstaltung bietet mit Ihrem breiten themenspektrum eine hervorragende Grundlage, um die bisherige Arbeit und die Zielsetzung unseres gemeinsamen Anliegens auch öffentlich zu kommunizieren. In diesem Sinne wünsche ich der heutigen tagung und Ihnen allen vor Ort viel Erfolg! GRUSSWORt 19
21 KOOPERAtION IN DER StADtREGION Prof. Dr. Rainer Danielzyk, Leibniz Universität Hannover Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es in den Stadtregionen aufgrund des Bedeutungsgewinns der regionalen Ebene und der interkommunalen Kooperation ein breites Spektrum regionaler Kooperationsansätze. Die Gründe dafür sind gut bekannt: Global agierende Unternehmen und hochqualifizierte Arbeitskräfte beschränken sich bei ihrer Standortwahl längst nicht mehr auf das Gebiet einer Stadt. Es stehen nicht mehr einzelne Kommunen, sondern Standorträume miteinander in Konkurrenz. Attraktive Verkehrsangebote, die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie von Einzelhandels- und Freizeitangeboten, aber auch die Gestaltung der Kulturlandschaft sind nur in interkommunaler Arbeitsteilung möglich. Die Profilierung von Standorträumen für Arbeiten und Wohnen und ihre Positionierung im Wettbewerb erfordern daher nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Globalisierung eine regionale Kooperation. Des Weiteren sei die zunehmende Regionalisierung der Lebensweisen genannt. Sie ist eine bedeutsame Dimension des allgemeinen sozialen, kulturellen und demografischen Wandels.
22 Die Aktionsräume der Individuen und Haushalte dehnen sich ständig aus, die Mitglieder eines Haushaltes bewegen sich heutzutage in ihrem Alltag nicht nur innerhalb einer Kommune. Vielmehr liegen die Orte für das Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeitvergnügungen und so weiter in der Regel innerhalb einer Region. In den Stadtregionen sind in den vergangenen Jahrzehnten im so genannten Umland Zentren und Wachstumskerne entstanden, die zum teil eine eigenständige Dynamik aufweisen. Gerade eine wettbewerbsorientierte Gestaltung regionaler Standorträume wird deshalb auf eine interkommunale Zusammenarbeit in immer stärker polyzentrisch strukturierten Stadtregionen setzen. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Zunahme interkommunaler Kooperationen ist die ungünstige finanzielle Situation vieler Kommunen, die diese dazu zwingt, enger zusammenzuarbeiten, um Kosten zu sparen und qualitativ hochwertige Infrastrukturleistungen für eine differenzierte Nachfrage anbieten zu können. Gerade der demografische Wandel verschärft die Situation, da ein großer teil der kommunalen Einnahmen (Einkommensteueranteile, kommunaler Finanzausgleich) sehr stark von der Einwohnerzahl abhängig ist: Das heißt deren Rückgang wirkt sich unmittelbar ungünstig auf die kommunale Finanzsituation aus. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die funktionale Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung in den Stadtregionen weiter zunimmt. Kunzmann (2001) hat dafür die sehr treffende Metapher des funktionalen Archipels gefunden. Ohne hier auf die einzelnen Elemente dieses Archipels eingehen zu können, wird deutlich, dass es hier um vielfältige Entwicklungen zu patchworkartigen, heterogenen Siedlungsstrukturen und Verflechtungsmustern in den Stadtregionen geht. Diese entwickeln sich auch dann weiter fort, wenn sich ein teil der Haushalte im Sinne einer Reurbanisierung wieder stärker in Richtung innerstädtischer Quartiere orientieren sollte. Vor diesem Hintergrund werde ich in diesem Beitrag zunächst kurz auf die wichtigsten Handlungsfelder interkommunaler beziehungsweise regionaler Zusammenarbeit eingehen, danach eine typologie stadtregionaler Kooperations- und Organisationsformen mit Beispielen vorstellen und ein Fazit ziehen. handlungsfelder in der stadtregion traditionellerweise sind, aus einer eher planerischen Sicht, vor allem folgende Handlungsfelder für eine überörtliche Zusammenarbeit in Stadtregionen zu nennen: Steuerung der Flächennutzung durch entsprechende planerische Ausweisungen; Entwicklung von Flächen: Allein durch die planerische Ausweisung geschieht noch keine Umsetzung; vielmehr geht es darum, planerisch ausgewiesene Flächen zu entwickeln, was im Falle regional bedeutsamer Gewerbeflächen oder Wohnstandorte in regionaler Zusammenarbeit geschehen sollte; VORtRAG 21
23 Wichtige Infrastrukturen wie der Straßen- und öffentliche Personennahverkehr, aber auch Ver- und Entsorgung sowie Einrichtungen der Naherholung, der sozialen und der kulturellen Infrastruktur werden einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits aber auch wegen der durch Kooperation entstehenden Möglichkeit, Spezialisierungsvorteile zu nutzen, immer häufiger regional organisiert. In den letzten Jahren sind neben diesen klassischen themen regionaler Zusammenarbeit zunehmend Aufgaben der Wirtschaftsförderung, des Regionalmarketings und der regionalisierten Strukturpolitik getreten. Darüber hinaus gewinnt vor dem Hintergrund knapper öffentlicher Kassen der intraregionale Lastenausgleich an Bedeutung. So kann man insgesamt festhalten, dass Regionalisierung beziehungsweise regionale Kooperation in den Stadtregionen im Interesse ihrer Wettbewerbsfähigkeit, ihrer Lebensqualität und des Ressourcenschutzes ist. Bei der Betrachtung der praxisrelevanten Handlungsfelder interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit ist allerdings zu beachten, dass die empirisch begründbaren und politisch wünschenswerten Anforderungen an die Fähigkeit zur regionalen Steuerung in vielen Stadtregionen die real vorhandenen Kompetenzen der räumlichen Planung, aber auch einer regionalisierten Strukturpolitik deutlich überschreiten. Ein strukturelles Problem ist dabei, dass Funktionsräume, das heißt die Handlungsräume der Haushalte und Unternehmen sowie die funktionalen Verflechtungsräume, vielfach nicht mit politisch-administrativ abgegrenzten territorien übereinstimmen. Insoweit hat es in der Vergangenheit manche Ernüchterung hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der stadtregionalen Steuerung gegeben. kooperations- und organisationsformen in stadtregionen Ehe eine typologie regionaler Kooperations- und Organisationsformen mit Beispielen vorgestellt wird, seien zunächst einige Kriterien herausgearbeitet, die bei deren Erarbeitung leitend waren und generell bei der Betrachtung regionaler Kooperationen beachtet werden sollten. Die Kriterien sind: sektorale, das heißt einzelne themen und Aufgaben in den Mittelpunkt stellende Kooperationsformen versus eher integrative, querschnittsorientierte Ansätze, die darüber hinaus auch die Möglichkeit zu politischen Koppelgeschäften bieten; die (planungs-)rechtliche Verbindlichkeit der Entscheidungen und des Handelns der jeweiligen Organisationsform; eine gewisse eigenständige finanzielle Handlungsfähigkeit, die nicht allein von der Bereitstellung von Fördermitteln abhängen sollte; 22 VORtRAG
24 die politische Legitimation einer regionalen Kooperation, das heißt inwieweit es politisch verantwortete Entscheidungen gibt, die transparent und bestimmten Akteuren zurechenbar sind. Von besonderem Interesse ist dabei, ob es direkt gewählte politische Entscheidungsgremien oder vermittelt aus Wahlen abgeleitete Entscheidungsstrukturen (wie zum Beispiel Zweckverbandsversammlungen) oder rein informelle Abspracherunden der maßgeblichen Akteure gibt; die Möglichkeit zu einem intraregionalen finanziellen Lastenausgleich, da die Gruppe der Nutzer regionaler Infrastrukturen keineswegs immer mit derjenigen der Zahler identisch ist. Folgende Kooperations- und Organisationsformen lassen sich in Stadtregionen unterscheiden: Weiche Kooperationsformen wie etwa Regionalkonferenzen, Regionalagenturen und regionale Arbeitskreise können keine öffentlich-rechtlich verbindlichen Entscheidungen gegenüber Dritten treffen. Sie sind vielmehr auf konsensorientierte Diskussionen und Entscheidungen angewiesen und vielfach in finanzieller Hinsicht auch nur begrenzt eigenständig handlungsfähig, aber gerade im Hinblick auf eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit von Regionen sehr bedeutsam. Ihre politische Legitimation ist oft unklar, wobei sie aber maßgeblich zur Vernetzung relevanter Akteure beitragen. Eine interessante, sehr innovative regionale Kooperationsform sind sogenannte integrative Querschnittsansätze, wie die REGIONALEN in Nordrhein- Westfalen oder die Metropolregionen. Der Begriff REGIONALE setzt sich aus Region und Biennale zusammen. Bei den REGIONALEN handelt es sich nicht um administrativ abgegrenzte Räume, sondern vielmehr um freiwillig und von unten entstandene Kooperationsräume sehr unterschiedlicher Größe. REGIONALEN wollen Innovation durch Wettbewerbsorientierung auf drei Ebenen fördern: bei der Auswahl der REGIONALEN selbst, bei der Entscheidung über die einzelnen Projekte und bei deren Gestaltung. Dieser Entwicklungsansatz nutzt in gewisser Weise die Vorteile von Festivalisierungsstrategien : Alle Kräfte, das heißt finanzielle Mittel, personelle Kapazitäten und politische Entscheidungen, werden auf ein bestimmtes Präsentationsjahr konzentriert. Das führt zu einem außergewöhnlichen Engagement und ermöglicht Effekte, die im normalen Verwaltungs- und Planungshandeln nicht erreichbar wären. Allerdings stellt sich oft die Frage, wie es nach dem jeweiligen Präsentationsjahr weitergeht, das heißt nach der Nachhaltigkeit der regionalen Kooperationen. Dieser Ansatz wird an dieser Stelle erwähnt, weil er auch, etwa im Falle der REGIONALEN 2006 (Bergisches Städtedreieck) und 2010 (Südliches Rheinland um Köln und Bonn), ein Ausdruck gelungener stadtregionaler Kooperation ist. VORtRAG 23
25 Ein weiteres Beispiel für integrative Querschnittsansätze zur Entwicklung von Stadtregionen sind die Metropolregionen. Sie sind im Rahmen der Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland im Jahr 2006 durch die Ministerkonferenz für Raumordnung definiert worden. In gewisser Weise handelt es sich hier auch um stadtregionale Kooperationsformen. Gegenwärtig sind verschiedene Varianten der Institutionalisierung von Metropolregionen zu beobachten: von eher informellen Strukturen ohne öffentlich-rechtliche Bindungswirkung bis zu stärker an vorhandenen Planungsverbänden angelehnten Metropolregionen. Ein-themen-Zweckverbände sind eine traditionsreiche Form der interkommunalen Zusammenarbeit. Sie spielen in zahlreichen Handlungsfeldern eine bedeutende Rolle, von der Abfallwirtschaft über das Gesundheitswesen (zum Beispiel Krankenhäuser) bis zur Organisation und trägerschaft des öffentlichen Nahverkehrs. Angesicht der Vielfalt von Aufgaben, die in interkommunaler Zusammenarbeit zu bewältigen sind, ist die Gründung zahlloser thematisch-sektoral orientierter Zweckverbände erforderlich, was zu einer schwer überschaubaren Vielfalt von Organisationen führt. Diese Organisationsform ist zumindest für die Öffentlichkeit nicht besonders transparent und erschwert darüber hinaus politischen Ausgleich und Koppelgeschäfte. Regionale Planungsverbände sind ebenfalls ein bewährtes Instrument regionaler Zusammenarbeit bei der planerischen Gestaltung von Stadtregionen. Der erste Verband dieser Art war 24 VORtRAG
26 bekanntlich der Zweckverband Groß-Berlin, der im Jahr 1912 gegründet wurde. In den 1960er und 1970er Jahren gab es in der Bundesrepublik eine Wiederbelebung beziehungsweise Neugründung von zahlreichen regionalen Planungsverbänden in Stadtregionen, die vor allem der planerischen Bewältigung der klassischen Stadt-Umland- Probleme in Bereichen wie Flächennutzung und Verknüpfung von Verkehrs- und Siedlungssystemen galten. Planungsverbände schaffen verbindliches Planungsrecht und sind politisch legitimiert, indem in der Regel Mitglieder gewählter Vertretungsorgane von Gebietskörperschaften die Verbandsversammlungen bilden. Die meisten regionalen Planungsverbände sind mit Aufgaben der Regionalplanung befasst, es gibt aber auch Planungsverbände in Stadtregionen, die (wie in Baden-Württemberg) einen Gemeinsamen Flächennutzungsplan oder (wie im Rhein-Main-Gebiet) einen Regionalen Flächennutzungsplan aufstellen. Mit der Beplanung von Flächen ist nicht automatisch die Umsetzung der damit verbundenen Ziele verbunden. Deshalb sind reine Planungsverbände nur begrenzt wirksam. Wenn man regionale Planungsverbände um Aufgaben der Umsetzung, der trägerschaft und der Entwicklung anreichert, kann von regionalen Mehrzweckverbänden gesprochen werden. Diese sind angesichts der Fähigkeit zur integrativen Gestaltung einer Region und zur Umsetzung einzelner Maßnahmen überaus handlungsfähige Formen regionaler Zusammenarbeit. Besonders bekannt und vielfach gewürdigt ist das Beispiel des Verbandes Region Stuttgart, der neben der Regional- und Landschaftsrahmenplanung zahlreiche weitere Pflichtaufgaben der Planung und trägerschaft auf regionaler Ebene wahrnimmt, aber auch weitere freiwillige Aufgaben wie Kultur- und Sportförderung übernimmt. Gerade Aufgaben dieser Art sind besonders öffentlichkeitswirksam und tragen deutlich mehr zur Bewusstseinsbildung für regionale Zusammenhänge und letztlich insgesamt zur Identifikation mit einer Stadtregion bei als klassische planerische Aufgaben. Erwähnt werden muss an dieser Stelle auch der traditionsreiche Regionalverband Ruhr, der bekanntlich auf den bereits 1920 gegründeten Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk zurückgeht und nach einer mehr als dreieinhalb Jahrzehnte währenden Pause 2009 auch wieder die Kompetenz der (staatlichen) Regionalplanung übertragen bekommen hat. Darüber hinaus ist er kontinuierlich mit vielfältigen regionalen Planungs-, Dienstleistungs- und trägerschaftsaufgaben betraut. Die wohl weitgehendste Form regionaler Zusammenarbeit ist der Zusammenschluss von VORtRAG 25
27 Kommunen zu einer regionalen Gebietskörperschaft. Eine Gebietskörperschaft auf regionaler Ebene ein Regionalkreis ist politisch durch Direktwahl des Parlaments und des Regionspräsidenten legitimiert und überaus handlungsfähig. Der gemeinsame regionale Haushalt trägt auch zum intraregionalen Lastenausgleich bei. Sinnvoll ist die Verknüpfung von Planungs- und Umsetzungsaufgaben. Zweifellos ist hier die Region Hannover das bundesweit bekannteste und meist beachtete Beispiel einer regionalen Gebietskörperschaft. Vor zwei Jahren hat sich auch im Raum Aachen eine StädteRegion gebildet. Zudem sei auf den Stadtverband Saarbrücken hingewiesen. Fazit Die Vielfalt stadtregionaler Kooperations- und Organisationsformen ist ein Ausdruck davon, dass längst nicht mehr einzelne Kommunen miteinander im Wettbewerb stehen, sondern dass die Stadtregionen, die Standort- und Handlungsräume für Haushalte und Unternehmen sind, miteinander konkurrieren. Deshalb ist eine Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit unverzichtbar. Ansätze zur politisch-planerischen Gestaltung stadtregionaler Entwicklungen und zur besseren Kooperation in den Stadtregionen müssen gemeinsames Handeln bei voller Wahrung der kommunalen Autonomie ermöglichen. Dabei sollten rechtlich-formelle Organisations- und Handlungsansätze mit informellen und netzwerkförmigen verknüpft werden, um die Stärken beider Kooperationsformen nutzen zu können. Oft wird zunächst darüber diskutiert, wie eine Stadtregion optimal abzugrenzen sei. Gerade der Streit über eine geeignete territoriale Definition verhindert häufig eine überzeugende Organisationsform. Auf Grund des oben skizzierten Spannungsverhältnisses von funktionaler Logik der Verflechtungsmuster der Aktivitäten von Haushalten und Unternehmen und der eher starren territorialen Logik des Politik- und Verwaltungshandelns wird es kaum einen idealen Regionszuschnitt geben können. Das darf aber kein Anlass sein, die Intensivierung stadtregionaler Kooperation aufzuschieben oder gar zu verhindern. Hervorzuheben ist, dass es auf Grund der jeweils individuellen Kooperationskultur und Planungsgeschichte in jeder einzelnen Region kein Idealmodell gibt, das allen Stadtregionen zu empfehlen wäre. Besonders schwierig stellt sich dabei häufig die Situation in polyzentrischen Stadtregionen dar, wo es in der Regel in raumstruktureller Hinsicht und aus der Perspektive der politischen Machtverhältnisse kein eindeutiges Zentrum gibt. Daher kommt es auf individuelle, den jeweiligen Verhältnissen angepasste Lösungen an. Wichtig ist dabei, dass eine verfasste und politisch starke Stadtregion nicht gegen die Ebene der Städte und Gemeinden institutionalisiert werden kann. Die Bündelung überörtlicher Aufgaben, der Vorteils- und Lastenausgleich zwischen den Kommunen und die Schaffung einer starken stadtregionalen Politikebene zur Überwindung klassischer Stadt-Umland-Gegen- 26 VORtRAG
28 sätze wird umso besser gelingen, je leistungsfähiger und handlungsfähiger auch die Einheiten auf der gemeindlichen Ebene sind. Sicher ist es schwierig, verlässlich und genau vorherzusagen, wie sich die Diskussion über und die Implementierung von stadtregionalen Organisationsformen in Deutschland weiterentwickeln wird. Dass hier weitere Fortschritte aus sachlichen Gründen notwendig sind, ist angesichts der gegebenen Rahmenbedingungen und Entwicklungen schwer zu bestreiten. Die politische Wirklichkeit widerstreitende Kräfte gibt es aus unterschiedlichen Motiven auf der Ebene der Länder, der Kreise und der Gemeinden ist vielfach einer Intensivierung stadtregionaler Organisationen und Kooperationen nicht förderlich. Vor diesem Hintergrund ist umso beeindruckender, was in den 1990er Jahren in der Region Hannover konzipiert und im vergangenen Jahrzehnt umgesetzt und mit Leben erfüllt wurde. Es ist nicht übertrieben festzustellen, dass die Region Hannover, deren zehnjähriges Bestehen hier zu würdigen ist, in der Bundesrepublik und darüber hinaus bei allen Diskussionen über eine Verbesserung stadtregionaler Organisation und Kooperation ein zentraler Orientierungspunkt im Sinne eines Benchmarks beziehungsweise Best Practice ist. Zum Mut der Gründungsväter, zum Engagement und zur Handlungsfähigkeit der heute aktiven Akteure sowie zu den sichtbaren Resultaten kann man nur gratulieren! literatur Danielzyk, R. (2007): Städte im regionalen Kontext Strategien und Organisationsformen für Stadtregionen. In: H. Sinning (Hrsg.): Stadtmanagement Strategien zur Modernisierung der Stadt(-Region). Dortmund: Dortmunder Vertrieb 2006, S (2. aktualisierte Auflage: Dortmund: Verlag Dorothea Rohn, S ). Danielzyk, R. (2008): Stadt-Regionen. In: C. Reicher/S. Edelhoff/P. Kataikko/L. Niemann/t. Schauz/A. Uttke (Hrsg.): StadtPerspektiven Positionen und Projekte zur Zukunft von Stadt und Raum. Stuttgart/Zürich: Karl Krämer Verlag, S Danielzyk, R./J. Knieling (2011): Informelle Planungsansätze. In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Grundriss der Raumordnung und Raumentwicklung. Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, S Danielzyk, R./H. Kemming/M. Reimer (2011): Die REGIONALEN in NRW Impulse der IBA Em-scherpark. In: C. Reicher/L. Niemann/A. Uttke (Hrsg.): Internationale Bauausstellung Emscher-park: Impulse. Essen: Klartext Verlag, S Danielzyk, R./A. Priebs (2011): Suburbanisierung angesichts von Reurbanisierungstendenzen ein Phänomen von gestern? In: W. Schenk (Hrsg.): Suburbane Räume als Kulturlandschaften. Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (im Druck). Dittrich-Wesbuer, A./W. Knapp/F. Osterhage (Hrsg.) (2010): Postsuburbanisierung und die Renaissance der (Innen-)Städte. Neuentwicklungen in der Stadtregion. Detmold: Verlag Dorothea Rohn (= Metropolis und Region Band 6). Herfert, G./F. Osterhage (2011): Bevölkerungsentwicklung Schrumpfung im Westen angekommen. In: IfL Leibniz-Institut für Länderkunde (Hrsg.): Nationalatlas aktuell. ( Hesse, M. (2010): Reurbanisierung oder Metropolisierung? Entwicklungspfade, Kontexte, Interpretationsmuster zum aktuellen Wandel der Großstadtregionen. In: disp 180, S Knieling, J. (Hrsg.) (2009): Metropolregionen. Innovation, Wettbewerb und Handlungsfähigkeit. Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (= Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL, Bd. 231). Kunzmann, K. (2001): Welche Zukunft für Suburbia? Acht Inseln im Archipel der Stadtregionen. In: Brake, K./J. Dangschat/G. Herfert (Hrsg.): Suburbanisierung in Deutschland. Opladen, S Priebs, Axel (2005): Stadt-Umland-Problematik. In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover, S Priebs, A. (2010): Entwicklung, Stand und Perspektiven stadtregionaler Planungs- und Verwaltungsinstitutionen in Deutschland. In: Die öffentliche Verwaltung 63 (12), S Vallée, D. (2010): Die Region ist die Stadt von heute. In: R. Danielzyk/F. Pesch/H. Sahnen/S. trommer (Hrsg.): Perspektive Stadt. Essen: Klartext-Verlag, S VORtRAG 27
29 10 JAHRE REGION HANNOVER Nach meiner Begrüßung am Anfang der Veranstaltung möchte ich Ihnen nun einiges von dem vorstellen, was sich in den letzten zehn Jahre bei der Region Hannover getan hat und einen kurzen Ausblick in die nähere Zukunft wagen. Hauke Jagau, Regionspräsident Region Hannover Eine Vorbemerkung gestatten Sie mir noch, die mir persönlich sehr wichtig ist. Bevor ich Regionspräsident geworden bin, war ich zehn Jahre Bürgermeister der Stadt Laatzen. Die liegt südlich von Hannover, hat rund Einwohner und ist Teil der Region Hannover. Ich habe so die Phase vor und nach der Regionsgründung auch unmittelbar aus anderer Perspektive wahrgenommen. Lassen Sie mich zudem einige Punkte benennen, die ich nur kurz streifen werde. Ich werde nicht beziehungsweise nicht mehr als nötig auf die kommunale Finanzsituation eingehen. Wir alle wissen, wie sie ist. Auch die Frage nach den Synergien werde ich nicht in den Mittelpunkt stellen. Hierzu gibt es verständlicherweise auch sehr viele unterschiedliche Betrachtungs- und Sichtweisen. Auch eine an sich durchaus diskussionswürdige These werde ich nicht vertiefend behandeln, möchte sie aber dennoch zumindest ansprechen:
30 dene Brandschutzgesetze brauche. Ich habe noch nicht erlebt, dass es in Bayern anders brennt als in Niedersachsen. Von den Problemen im Bildungsbereich will ich gar nicht reden. Leistungsstarke Regionen sind zudem näher an den Bürgerinnen und Bürgern, als es Bundesländer sein können. Aber das wäre ein thema für eine eigene tagung. Was bedeutet die Bildung starker Regionen für die einzelnen Bundesländer und unsere bundesstaatliche Struktur? Die Länder sind, dass ist jedenfalls mein Eindruck, kein Freund von großen und starken Regionen. Ich erinnere mich noch gut, dass bei verschiedenen Veranstaltungen die nicht nur die Region Hannover betrafen von Länderseite immer sehr klar gesagt wurde, was alles nicht gehen würde und warum nicht. Die Bundesländer treibt natürlich bei der Verteilung der Kompetenzen und der Entwicklung in Europa die Befürchtung um, dass man sie vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr braucht, wenn überall große und leistungsstarke Regionalverwaltungen etabliert sind. Auch wenn das in unserer starken Fixierung auf föderale innerstaatliche Strukturen nicht überall gerne gehört wird: Es hat mir bis heute keiner erklären können, warum ich 16 Bauministerien, warum ich 16 verschie- Nach diesen Vorbemerkungen: Was bringt die Region der Region? Die Bildung einer Region ist nie eine Liebesheirat. Ein solches Projekt hat nur dann Chancen, wenn Verstand und Rationalität bei den an einer solchen Gründung Beteiligten immer wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Denn im Zweifel steht bei einer solchen Idee die Fragestellung im Mittelpunkt, welche Chancen man gemeinsam hat und wie sich die Machtverteilung gestaltet. Und diese Frage muss dann obwohl einzelne Aspekte selbst natürlich jeweils sehr emotional besetzt sind gemeinsam rational beantwortet werden und eine für die Beteiligten gemeinsam vertretbare Lösung herausgearbeitet werden. Das verhindert zum einen sicher eine Maximallösung zugunsten nur einer der betroffenen Seiten, stellt aber auch sicher, dass nicht zu viele Kompromisse die Chancen der neuen Organisationsform von vornherein verhindern. Aber auch nach einer solchen Regionsbildung ist die Vorstellung illusorisch, dass sie konfliktfrei funktioniert, weil es auch dann immer um Verteilung und Zukunftschancen geht. Man muss deshalb immer auch dazu VORtRAG 29
31 bereit sein, auf einander zuzugehen und sich immer wieder mit den unterschiedlichsten Partnern intensiv auseinander zu setzen. Das kann mitunter sehr anstrengend sein. Es ist übrigens auch nicht leichter, wenn man wie wir immer noch relativ einmalig ist und gelegentlich zwischen allen Fronten steht. im einzelnen Die Region besteht geographisch gesehen aus 21 Städten und Gemeinden. Wir haben insgesamt 1,1 Millionen Einwohner auf einer Fläche von Quadratkilometern und verweisen an dieser Stelle immer gerne darauf, dass wir ungefähr so groß wie das Saarland sind aber leider kein Stimmrecht im Bundesrat haben. Die Region ist eine kommunale Gebietskörperschaft, hat weitreichende Kompetenzen, die bundesweit in dieser Form immer noch einmalig sind. Die Landeshauptstadt Hannover ist teil der Region und außerhalb der Zuständigkeiten der Region selbstständig. Das ist der Kompromiss, der damals gefunden wurde. Es ist ausführlich beschrieben worden, dass der damalige Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Herr Schmalstieg, sehr dafür kritisiert wurde, dass er sich überhaupt auf die Bildung der Region eingelassen hat. Insgesamt können nach meiner Beobachtung aber mit dem jetzigen Status mittlerweile alle Betroffenen gut leben. Als einen wesentlichen Faktor sehe ich dabei an, dass bei der Regionsgründung auch der Aspekt der Stärkung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden konsequent mitgedacht worden ist. So wurden Aufgaben des ehemaligen Landkreises an die Städte und Gemeinden abgegeben. Aus unserer Sicht gibt es aktuell aber keinerlei Interessenlagen, Veränderungen vorzunehmen oder gar das Rad wieder zurück zu drehen. meilensteine seit der regionsgründung Auf einige Meilensteine in der bisherigen noch nicht so langen Geschichte der Region seit ihrer Gründung möchte ich im Folgenden kurz eingehen: Wir haben die Fusion der Berufsschulen erreicht und ein einheitliches Berufsschulkonzept implementiert, in dem wir Schwerpunkte nach Ausbildungsberufen gebildet haben. Dies hat dazu geführt, dass wir deutlich qualifizierter arbeiten können. Es gab viele Widerstände, die aber überwunden wurden. Nachdem das Berufsschulkonzept nun eingeführt ist, herrscht ein breiter Konsens, dass dies ein richtiger und guter Schritt war. Wir haben die Umweltverwaltung gebündelt. Da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Landeshauptstadt, aus dem alten Landkreis und aus der damals noch existierenden Bezirksregierung zusammen gekommen. Wir sind in diesem Bereich eine Bündelungsbehörde in den Umweltfragen geworden. Wir haben die Fusion der Gesundheitsämter in Angriff genommen. Auch da sind die Mitarbeiterinnen und Mit- 30 VORtRAG
32 arbeiter aus der Landeshauptstadt und dem ehemaligen Landkreises zusammen gekommen. Es gibt also nur noch ein Gesundheitsamt für die gesamte Region Hannover. Mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover gibt es nun einen Abfallbetrieb für die gesamte Region. Diese Rechtsform wurde gewählt, damit wir als Region für das gesamte Regionsgebiet die Richtlinien für die Abfallwirtschaft vorgeben können und die Landeshauptstadt für ihr Gebiet die Richtlinien bei der Straßenreinigung. Wir haben die beiden Kliniken der Landeshauptstadt und des Landkreises, die in unterschiedlicher Rechtsform existierten, als GmbH Klinikum Region Hannover zusammengeführt. Als die Landesregierung die Psychiatrie privatisiert hat, haben wir das alte Landeskrankenhaus Wunstorf erwerben können, so dass es in öffentlicher trägerschaft geblieben ist. Im Jahr 2003 haben die Stadtsparkasse Hannover und der Kreissparkasse Hannover fusioniert. Wir haben mit der Landeshauptstadt in mehreren Schritten eine gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft gegründet und die vorher existierenden unterschiedlichsten Unternehmungen in den Bereichen Wirtschaftsund tourismusförderung sowie Marketing in einem längeren Prozess zusammengeführt und organisatorisch sinnvoll neu aufgestellt. So haben wir es geschafft, dort gebündelt und passgenau arbeiten zu können und sind auf dem guten Weg des Miteinanders statt des Nebeneinander her. Im Marketingbereich haben wir zudem wesentliche Akteure der (Privat-)Wirtschaft mit eingebunden. Wir haben 2005 ein Unternehmerbüro gegründet, das neben und ergänzend zu den Aufgaben der Städte und Gemeinden für die Förderung der lokalen Wirtschaft die übergeordnet notwendigen Hilfestellungen garantiert und sichert, zum Beispiel bei drohenden Insolvenzen. Auch dies stieß am Anfang durchaus auf Skepsis, weil in diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen wurde, ob den Städten und Gemeinden etwas weggenommen werden sollte. Wir sind diesen Prozess dann gemeinsam strukturiert angegangen, angefangen damit, dass wir alle Ängste und Sorgen aufgeschrieben haben und sie dann der Reihe nach abgearbeitet haben. Und das Ergebnis: Dieses Unternehmerbüro funktioniert und erfährt bei allen befragten Unternehmen immer Bestbeurteilungen. Dies ist ein Beispiel für das Bemühen, ergebnisorientiert zu arbeiten. Idealerweise ist dabei die klassische Verwaltungsfrage Bin ich zuständig? nicht mehr die erste Frage. Selbstverständlich ist dies auch immer noch eine Frage und bedarf der Verständigung aber das gewünschte Ergebnis und der Weg, wie es erreicht werden kann, rückt vermehrt in den Vordergrund der Betrachtung. Ich bin im Übrigen überzeugt, dass es den Bürgerinnen und Bürgern häufig egal ist, wer zuständig für etwas ist. Sie wollen in erster Linie eine gute und kompetente Dienstleistung. Ich glaube, dass dies ein wichtiger Punkt ist, der innerhalb des politischen VORtRAG 31
33 Raums bei der Frage von Zuständigkeiten noch nicht so angekommen ist. Ebenfalls möchte ich noch kurz auf die Zusammenführung der Leitstellen im Bereich des Rettungsdienstes eingehen. Das ist nach wie vor ein schwieriges thema, weil hier sehr unterschiedliche Strukturen zusammen gebracht werden müssen. Wir haben eine Berufsfeuerwehr in der Landeshauptstadt und daneben natürlich die Freiwilligen Feuerwehren in den 20 anderen Städten und Gemeinden. Das thema ist noch immer nicht konfliktfrei und ist sicherlich noch optimierungsfähig. Im Jahr 2011 haben wir zusammen mit den regionsangehörigen Städten und den bisher bei der Region Hannover als Eigenbetrieb geführten It-Dienstleister HannIt als Anstalt öffentlichen Rechts neu gegründet. HannIt hatte auch schon als Eigenbetrieb Kundenbeziehungen zu den regionsangehörigen Städten und Gemeinden. Ziel war es, unter anderem wegen der strengeren vergabe-rechtlichen Rahmenbedingungen einen auf Dauer leistungsfähigen kommunalen It-Dienstleister zu schaffen und damit auf Sicht Wertschöpfung in der Region zu erhalten. Dabei hat die Region einen teil ihres Einflusses und ihrer Steuerungshoheit aufgegeben, dafür wurde aber das kommunale It-Geschäft auf eine breitere und zukunftssicherere Grundlage gestellt. Das ist ein spannender Prozess gewesen, den alle 21 Städte und Gemeinden begleitet und mitgemacht haben. Die Anstalt steht, jetzt ist die gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten, diese Anstalt weiter zu entwickeln. strategische ziele der region An dieser Stelle möchte ich die strategischen Ziele der Region ansprechen. Wir haben vorweg unseren Anspruch formuliert, um deutlich zu machen, was wir eigentlich für ein Selbstverständnis haben und an welchen themen wir künftig verstärkt arbeiten wollen. Und da haben wir durchaus forsch den Anspruch festgeschrieben, dass wir Modell für Stadtregionen in Deutschland sein wollen. Ein weiterer Anspruch ist es, zu den Gewinnern des demographischen Wandels zu gehören. Der demographische Wandel ist eine zentrale Aufgabe, die wir meistern müssen, denn wir wissen, dass es massive Wanderungen geben und die Bevölkerung insgesamt abnehmen wird. Wir wollen nicht in die Negativ-Spirale geraten, die zwangsläufig entsteht, wenn durch massive Einwohnerverluste die Infrastruktur nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Wir wollen darüber hinaus die öffentliche Steuerungsfähigkeit erhalten. Wir sind eine Region, die sich ganz massiv oft in privater Rechtsform, aber in kommunaler trägerschaft das thema der Daseinsvorsorge auf die Fahnen geschrieben hat. Ich habe beispielhaft bereits einige Bereiche angesprochen und werde auch später noch darauf zurückkommen. Ich möchte Ihnen die sieben Handlungsfelder, von denen wir glauben, dass sie zwingend notwendig sind, um zukunftsfähig zu bleiben, an dieser Stelle kurz nennen: Vorbildfunktion für Klimaschutz und nachhaltiges Handeln 32 VORtRAG
34 Gesellschaftliche teilhabe und unterschiedliche Lebensentwürfe ermöglichen Bildungschancen und Bildungsniveaus erhöhen aussehen können und was eigentlich die Schwerpunktsetzung auch für unsere Haushalte bedeuten. Aber es ist selbstverständlich noch ein gutes Stück Weg vor uns, bis wir auch das konsequent umgesetzt haben. Beschäftigung und Wertschöpfung sichern und erhöhen Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern Öffentliche Daseinsvorsorge sichern Dienstleistungsqualität stärken Das sind die Ziele, die wir in der Regionsversammlung beschlossen haben. Aktuell führen wir einen konstruktiven Dialog mit den Mitgliedern der Regionsversammlung darüber, wie die nächsten Umsetzungsschritte erwartungen an die region Bereits bei der Gründung der Region gab es natürlich wenn auch nicht in der eben geschilderten Art und Weise Ziele und Erwartungen. Was haben wir davon erreicht? Einiges, wie Sie sogleich sehen werden. Es war das Ziel, Politik aus einem Guss zu haben. Dies wird im bereits dargestellten Bereich der Wirtschaftsförderung weitgehend erreicht, hier haben wir ein starkes Angebot geschaffen. Im Bereich der Bildung sind wir träger der Berufsschulen und der Förderschulen. Hier haben wir eine klare Profilierung vorgenommen: Mit einem Angebot von mehr als 300 Bildungsgängen ist die Region Hannover der größte Bildungsträger VORtRAG 33
35 in Niedersachsen. An ihren aktuell 15 Berufsschulen erhalten Jahr für Jahr rund Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich in modernen und gut ausgestatteten Lernumfeldern auf den Einstieg ins Berufsleben vorzubereiten. Möglich ist dies auch deshalb, weil im Prozess der Regionsbildung schwierige Entscheidungen nicht ausgespart blieben. Während vier der seinerzeit bestehenden Berufsschulstandorte aufgegeben wurden, konnten die übrigen Schulen zu branchenorientierten Kompetenzzentren zum Beispiel für die Berufsfelder Informations- und Medientechnik, Fahrzeugtechnik oder Gesundheit und Soziales aufgewertet werden. Das auf der Grundlage dieser Schwerpunktsetzungen basierende Berufsschulkonzept führte zu einer nachhaltigen Entlastung des Regionshaushaltes. Vor allem aber garantiert es den Schülerinnen und Schülern auch durch innovative Kooperations -ansätze wie das deutschlandweit beachtete Neustädter Modell optimale Rahmenbedingungen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Im Bereich der Naherholung möchte ich noch erwähnen, dass wir auch träger des Erlebniszoos Hannover sind. Der Zoo war ursprünglich mal eine städtische Einrichtung, wir haben ihn nachhaltig verändert und zu einem großen Publikumsmagneten geformt. der konzern region hannover Als nächstes möchte ich ihnen aufzeigen, mit welchen Partnern wir verbunden sind oder welche Unternehmungen zum Konzern Region Hannover gehören. Sie werden sehen, es ist ein buntes Portfolio auch wenn ich an dieser Stelle nur auf einige dieser Unternehmungen eingehen werde. Wir sind zusammen mit der Landeshauptstadt träger der Sparkasse Hannover. Die Zeiten einer Kreis- und einer Stadtsparkasse sind damit Vergangenheit. Die Sparkasse Hannover gehört durch die gelungene Fusion in Deutschland zu den fünf wirtschaftlich stärksten Sparkassen. Wir sind sehr froh, dass wir so auch gewährleisten können, dass es bei vernünftigen mittelständisch orientierten Investitionskonzepten keine Kreditklemme der Wirtschaft vor Ort gibt. Gerade das ist ja auch einer der wichtigsten Zwecke einer Sparkasse. Wir sind daher sehr stolz, eine gut aufgestellte und sehr leistungsstarke Sparkasse zu besitzen ein wichtiger Erfolgsfaktor auch und gerade für die mittelständische Wirtschaft in der Region. Als trägerin des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) schafft die Region Hannover in der Zusammenarbeit mit den Beteiligungsunternehmen üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG und RegioBus Hannover GmbH die Grundlagen für ein umfassendes und umweltgerechtes Mobilitätsangebot für die Menschen in der Region. Mehr als 300 Stadtbahnwagen und weit über 500 Busse sind im Einsatz, um die zusammen genommen rund 200 Millionen Fahrgäste pro Jahr sicher und komfortabel an ihr Ziel zu bringen. Um dieses auch im nationalen Vergleich hervorragende ÖPNV-Angebot dauerhaft abzusichern, mussten Regi- 34 VORtRAG
36 on und Verkehrsunternehmen auch auf diesem Sektor erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die eigene Wirtschaftlichkeit nachhaltig zu erhöhen. Beispielhaft hierfür steht der im Jahr 2008 abgeschlossene Partnerschaftsvertrag zwischen Region und üstra. Mit dem Partnerschaftsvertrag garantiert die Region einen verlässlichen Handlungsrahmen bis zum Jahr 2020, im Gegenzug verpflichtet sich das Unternehmen zu einem attraktiven Angebot für die Kunden sowie zur Einhaltung marktgerechter Kostenstrukturen. Im Ergebnis konnten auf diese Weise dauerhafte Einspareffekte in zweistelliger Millionenhöhe erreicht werden. Eine der nachhaltigen und segensreichen Folgen der Weltausstellung Expo 2000 ist, dass wir ein S-Bahn- Netz bekommen haben. Dieses ist ein großes Erfolgsmodell: Viele Menschen nutzen mittlerweile dieses sichere und zuverlässige Verkehrsmittel. Unsere größte Beteiligung ist die Klinikum Region Hannover GmbH. Nach der Übernahme der Krankenhäuser der Landeshauptstadt (2003) und der zwei Jahre später erfolgenden Gründung des Klinikums Region Hannover ist die Region inzwischen einer der größten kommunalen Krankenhausträger der Republik. Durch umfangreiche Restrukturierungen ist es gelungen, einerseits mit den über das gesamte Regionsgebiet verteilten 13 Krankenhausstandorten auch in der Fläche eine wohnortnahe Versorgung für jährlich rund Patienten zu sichern, anderseits aber auch ganz erhebliche Konsolidierungserfolge zu erzielen. Betrug das Defizit der regionseigenen Krankenhäuser noch im Jahr 2004 mehr als 20 Millionen Euro, so weist das Klinikum seit dem Jahr 2009 eine schwarze Null als Jahresergebnis aus. Durch eine am Gesamtziel der Erreichung eines Höchstmaßes an Wirtschaftlichkeit orientierte Etablierung professioneller Management- und Organisationsstrukturen konnten mittlerweile auch zentrale Zukunftsinvestitionen wie aktuell der 180 Millionen Euro teure Neubau des Krankenhaus Siloah angeschoben und so insgesamt die Region Hannover als wichtiger Standort der Gesundheitswirtschaft gestärkt werden. Im Bereich der Abfallwirtschaft ist der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover tätig. Er steht als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger mit einem zuverlässigen Angebot für Lebensqualität in der Region Hannover. Das regionsübergreifende Konzept ist zukunftsweisend und bietet eine gute Basis für Entsorgungssicherheit. Mit 13 Betriebsstätten, 20 Wertstoffhöfen und drei Deponien wird in einem wichtigen Bereich Daseinsvorsorge für die Menschen in der Region gewährleistet. Der Zweckverband ist gut aufgestellt für die Zukunft der Abfallentsorgung. Entscheidend sind hier wie auch in anderen Bereichen natürlich die europa-, bundes- und/oder landesrechtlichen Regelungen. Wir schauen hier genau auf die Bestrebungen des Bundesgesetzgebers zur Novellierung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. VORtRAG 35
37 Eine Besonderheit möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen: Wir haben in der Region unterschiedliche Entsorgungssysteme. Im klassischen Einfamilienhausbereich, also überwiegend im Umland der Region, gibt es eine Sackabfuhr, während es sonst natürlich in den Großwohnanlagen und auch in der Landeshauptstadt eine tonnenabfuhr gibt. Die Frage Sack oder tonne ist ein Dauerthema seit Regionsgründung und kehrt in mehr oder minder regelmäßigen Abständen immer wieder auf die politische Agenda zurück. Gelegentlich erhält man dabei den Eindruck, dies sei die wahrhaft existenzielle Frage. Ich persönlich habe mal in der Landeshauptstadt gewohnt und wohne jetzt im Umland in Laatzen. Ich kenne deshalb beide Systeme und ich kann daher aus eigener Erfahrung jedem versichern: Man überlebt, egal welches System zur Anwendung kommt. Der Erlebniszoo Hannover ist ein Leuchtturm der gesamten Region Hannover auch über die Regionsgrenzen hinweg und setzt Maßstäbe im Bereich der Naherholung. Er ist immer einen Besuch wert. Ich möchte hier nur kurz es ist ja schließlich ein Fachvortrag und keine tourismus-werbeveranstaltung, sonst würde ich Ihnen natürlich auch noch etwas ausführlicher über die wunderschönen Naturlandschaften des Deisters und des Steinhuder Meers berichten auf die verschiedenen themenlandschaften hinweisen. Es gibt eine Sambesi-Landschaft, hier können Sie vom Boot aus afrikanische tiere bewundern. thematisch an die indische tierwelt angelegt ist der Dschungel-Palast. Zuletzt entstanden ist Yukon Bay, eine Kanada-Landschaft, die sehr großen Erfolg hat. Die Konzepte hatten immer die Funktion, die Lebensbedingungen für die tiere zu verbessern und zeitgleich natürlich auch die Attraktion für die Besucher zu erhöhen. Daneben ist der Erlebniszoo auch im Artenschutz aktiv. Dieser große Konzern Region Hannover bedeutet natürlich auch einen großen Koordinationsaufwand, weil wir den Anspruch haben, dass die großen Leitlinien politisch vorgegeben werden. Zum Stichwort Koordinierungsaufwand passt im Zusammenhang auch gut unser Jobcenter. Es ist eines der größten in Deutschland. Und auch dieser Bereich ist natürlich einer, der immer wieder intensivster Arbeit bedarf, weil es durchaus unterschiedliche Interessenlagen zwischen den Kostenträgern, dem Bund einer- und uns als Kommune andererseits, gibt. Welche Bereiche sollen verstärkt gefördert werden, welche Ziele werden gesetzt, welche Maßnahmen sind wirtschaftlich sinnvoll all dieses sind Fragen, die unterschiedlich bewertet werden. Wie geht es weiter? Zum Abschluss erlauben Sie mir ein paar Worte zu der Frage Wie geht es weiter?, gerade vor dem Hintergrund der finanziellen Entwicklung. Im Jahr 2009 haben wir erstmals seit Gründung der Region über Synergien und Veränderungen einen positiven Haushaltsabschluss gehabt. Dann folgten die Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen. 36 VORtRAG
38 Im Jahr 2010 weisen wir ein Defizit von 67 Millionen Euro aus. Wer diese Zahlen nun als schlagenden Beweis dafür ins Feld führen will, dass das Regionsmodell ja finanziell nicht die große Nummer gewesen sein kann, verkennt einen nicht unwesentlichen Fakt: Wir sind der träger aller Sozialkosten in der Region. In unserem 1,4 Milliarden-Haushalt reden wir hier von einem Block von etwa 900 Millionen Euro. Jede Wirtschaftskrise schlägt bei uns voll durch, weil wir nicht nur über die Umlagefinanzierung die reduzierten Einnahmen im Gewerbe- und im Einkommenssteuerbereich haben, sondern von negativen Entwicklungen im Bereich der Sozialkosten beeinflusst werden. Sie sehen im Übrigen parallel dazu, dass es uns gelungen ist ungeachtet der deutlichen Abrechnungsschwankungen den Öffentlichen Personennahverkehr trotz deutlicher Qualitätsverbesserungen und Ausbauten in einer ähnlichen finanziellen Dimension zu halten. Wir haben Grund zur Annahme, dass bessere Zeiten vor uns liegen. Sie sehen hier die Planungszahlen: 2011 werden wir sicher besser abschneiden, für 2012 streben wir sehr deutlich an, wieder ausgeglichen abzuschließen. Die Perspektive stimmt also. Und sie stimmt auch deshalb, weil wir an vielen Stellen natürlich erst schrittweise Synergien heben und Hausaufgaben machen mussten, so leisteten wir fusionsbedingt auch Ausgleichzahlungen an Versorgungskassen. Wir gelangen mehr und mehr in den Bereich, wo diese Effekte sich auszuzahlen beginnen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Zur Illustration des gerade Erwähnten: Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfekosten ist der Zuschussbedarf der Region bitte nicht mit den gerade genannten Gesamtkosten verwechseln von 327 Millionen Euro im Jahr 2002 auf 550 Millionen Euro im Jahr 2011 gestiegen. Ich sage es durchaus provokant: Land und Bund haben sich in der Zwischenzeit einen schlanken Fuß gemacht und die Last auf uns abgeladen. Das wird bei Ihnen nicht anders sein, deshalb muss ich es an dieser Stelle nicht vertiefen. Aber das macht deutlich, woher die angesprochene Finanzierungsproblematik kommt. VORtRAG 37
39 STADTREGIonALE KooPERATIon im GroSSRAUm Poznań Erfahrungen aus Deutschland, die mit der Koordination der Raumplanung und Verwaltung öffentlicher Dienstleistungen innerhalb von Regionen zusammenhängen, sind besonders wertvoll. Charakteristisch für Deutschland ist die Bandbreite der angewandten Systemlösungen, was einerseits aus der polyzentrischen Siedlungsstruktur des Landes resultiert und andererseits mit dem Föderalismus verbunden ist. Die Regelung des territorialen Selbstverwaltungssystems liegt im Zuständigkeitsbereich der einzelnen Bundesländer, die auch einen großen Einfluss auf die Raumplanung haben. Die Regionen Deutschlands werden also nicht, wie es oft in zentralistischen Staaten der Fall ist, im ganzen Staat gleich behandelt. In der Regel nehmen sie eine besondere Stellung innerhalb ihres Landes ein. Prof. Dr. Tomasz Kaczmarek, Adam-Mickiewicz-Universität zu Poznań Aus der polnischen Sicht ergibt sich der zusätzliche Wert der Lösungen, die in deutschen Großräumen erarbeitet wurden, aus einer großen Ähnlichkeit ihrer territorialen Verwaltungsstruktur zu polnischen Großräumen. Trotz der Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es sowohl in Deutschland als auch in Polen in der territorialen Gliederung auf der Kreisebene eine Einteilung in Landkreise und kreisfreie Städte.
40 In der Diskussion über die territoriale Verwaltungsstruktur der städtischen Großräume in Deutschland ist zunehmend festzustellen, dass die Einteilung in Stadt- und Landkreise immer anachronistischer wird. neue Vorschläge führen in die Richtung von großen Verwaltungsregionen um die großen Städte. Bisher wurde diese Lösung allerdings nur in wenigen Fällen, insbesondere im Großraum Hannover, eingeführt. Angesichts der immer noch vorhandenen administrativen Zersplitterung auf der Kreisebene bleiben die traditionelleren Ein- oder mehrzweck-selbstverwaltungsverbände, deren Aktivitäten in einem unterschiedlichen Grad koordiniert sind, die dominierenden organisationsformen für die Raumplanung und bestimmte Verwaltungsaufgaben in den Regionen Deutschlands. Eine solche Lösung wird vor allem von lokalen Selbstverwaltungen bevorzugt, die der Entstehung eines von ihnen unabhängigen Entscheidungsgremiums auf der Ebene der Region entgegenwirken wollen. Die Region Hannover ist für Poznań ein Beispiel der modellhaften Integration der Verwaltung der Kernstadt und der Umlandkommunen. Aus ihren Erfahrungen schöpfen wir in Poznań Inspiration, wie man heute interkommunale Kooperation verwirklichen und in Zukunft eine vollständige regionale Selbstverwaltung aufbauen kann. Forschungsinstitute, die durch ihre wissenschaftliche Tätigkeit, sowie international geschätzte kulturelle Institutionen bekannt sind, haben ihren Sitz in Poznań und Hannover. Die beiden Städte sind auch für weltweit anerkannte internationale messen berühmt. Diese Ähnlichkeiten haben mit Sicherheit die Unterzeichnung des Vertrags über die Partnerschaft zwischen den Städten Hannover und Poznań im Jahre 1979 erleichtert. Dieser Vertrag wurde 1999 erneuert, und bei dieser Gelegenheit wurden neue Bereiche der Kooperation zwischen den Städten bestimmt. Im Jahre 2000 wurde ein Partnerschaftsvertrag zwischen dem Kreis Poznań und dem damaligen Landkreis Hannover unterzeichnet. Derzeit erstreckt sich die von der Region Hannover fortgeführte Zusammenarbeit auf mehrere Bereiche, unter denen Kultur, Sport, Transport und Umweltschutz einen wichtigen Platz einnehmen. Vor allem sollen aber die gegenseitigen Beziehungen dem Austausch von Erfahrungen im Bereich der Verwaltung und der Anbahnung von Kontakten zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern der beiden Stadtregionen dienen. Poznań und Hannover sind Städte, die viele Ähnlichkeiten aufweisen. Beide Städte erfüllen Funktionen von überregionaler Bedeutung und sind wichtige Industrie-, Handels-, Wissenschafts- und Kulturzentren. Zahlreiche Industriebetriebe, Hochschulen und VORtRAG 39
41 Szamotuly Buk Suchy Las Rokietnica Tarnowo Podgórne Dopiewo Stęszew Oborniki Luboń Komorniki Puszcykowo Kreisgrenze Gemeindegrenze Stadtgemeinde Stadt-Landgemeinde Landgemeinde Poznań Mosina Murowana Goślina Czerwonak Śrem Swarzędz Kórnik Skoki Kleszczewo Pobiedziska Kostryzn Kommunale Mitglieder des Vereins Metropole Poznań Auch die Basisstatistiken der Regionen Hannover und Poznań, wie beispielsweise die Einwohnerzahl, das Verhältnis zwischen der Bevölkerung des Umlands und der Kernstadt sowie die Bevölkerungsdichte, weisen viele Ähnlichkeiten auf. Die beiden Stadtregionen sind heute gute Beispiele von mittelgroßen europäischen metropolen. Im Folgenden wird der komplizierte und mühsame Weg des Großraums Poznań im Bereich stadtregionaler Kooperation anhand von Beispielen gezeigt. Heute kann dieses Gebiet schon auf einige Erfolge stolz sein und ist zu einem Vorbild der Kooperation in Polen geworden. Immer häufiger spricht man vom spezifischen Poznań-Weg zur stadtregionalen Kooperation. Integrationsmaßnahmen im Großraum Poznań Das gegenwärtige modell der territorialen Verwaltung im Großraum Poznań hat sich infolge der Verwaltungsreform aus dem Jahr 1990 entwickelt, in deren Rahmen die territoriale Selbstverwaltung auf Gemeindeebene wiederhergestellt wurde. Die Verwaltungsreform, die eine der wichtigsten Errungenschaften der polnischen Systemwende war, hat dazu beigetragen, dass lokale Gemeinschaften zu mehr Selbstbestimmung befähigt wurden und die Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten auf lokaler Ebene demokratisiert wurde. Der Bruch von manchen früheren funktionalen Verwaltungsverbindungen zwischen den Großstädten und ihren nachbarkommunen wurde jedoch zum nebeneffekt der Verwaltungsreform. In der Volksrepublik Polen waren sie zwar nicht auf die Grundsätze der lokalen Demokratie und Selbstverwaltung gestützt (zum Beispiel im Bereich der kommunalen Wirtschaft und des öffentlichen Verkehrs waren staatliche Unternehmen tätig), sie stellten aber ein gewisses minimum für ein kohärentes Funktionieren des Großraums Poznań sicher. Ein nebeneffekt der Reform war die Desintegration der Raumplanung, des öffentlichen Verkehrssystems und mancher öffentlichen Dienstleistungen auf dem Territorium des Großraums. 40 VORtRAG
42 Am 1. Januar 1999 wurden infolge der territorialen Verwaltungsreform zwei weitere Selbstverwaltungsebenen eingeführt: die Kreisebene und die Woiwodschaftsebene. So wurde im Großraum Poznań eine neue territoriale Einheit gebildet: der Kreis Poznań, dessen Grenzen dem Bereich des Großraums jedoch unter Ausschluss der Stadt Poznań entsprechen. Die Kreisreform war eine sehr gute Gelegenheit für die Einführung von neuen, integrierten Verwaltungsstrukturen in städtischen Großräumen. Es ist aber nicht zu einer Entstehung von metropolkreisen gekommen. Der verwaltungsrechtliche Status von Großstädten und ihrem Umland wurde durch die Schaffung von zwei Kreiskategorien (kreisfreie Städte und Landkreise) geregelt. Die damals entstandene administrative Gebietsgliederung hat sich bis heute nicht wesentlich verändert und die von der zentralen Verwaltung mehrfach angekündigte Einführung von integrierten Verwaltungseinheiten auf der Großraumebene ist nie zustande gekommen. Daher spielt in der aktuellen administrativen Gebietsgliederung die freiwillige Bottom-up-Kooperation zwischen Städten und Gemeinden sowie die Zusammenarbeit des Landkreises Poznań mit der Stadt Poznań als kreisfreie Stadt eine Schlüsselrolle für die Integration der Verwaltung im Großraum Poznań. Diese Kooperation, die öffentlich-rechtlichen (in der gesetzlich zulässigen Form eines Verbands, einer Vereinigung oder einer Gemeinschaft) oder informellen Charakter einnimmt, hat sowohl eine politisch-strategische als auch eine sektorale Dimension. Unterzeichnung der Vereinbarung über die Kooperation zwischen den Selbstverwaltungen des Großraums Poznań und Gründung des Rats des Großraums Poznań als Forum für Informationsaustausch und Abstimmungen (2007) Politisch-strategische Kooperation Am 15. mai 2007 haben der Präsident der Stadt Poznań, der Landrat des Kreises Poznań sowie die Verwaltungsspitzen von 17 Gemeinden des Kreises Poznań die Vereinbarung über die Kooperation zwischen Selbstverwaltungen des Großraums Poznań unterzeichnet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vereinbarung haben den Rat des Großraums Poznań als Forum zum Informationsaustausch zwischen den Selbstverwaltungseinheiten und Plattform für die Abstimmung der Themen der Zusammenarbeit, die in Zukunft rechtlich verbindlich sein soll, gegründet. Im Jahre 2008 sind drei Gemeinden außerhalb des Kreises Poznań der Vereinbarung beigetreten: Śrem, Szamotuły und Skoki sowie im Jahre 2011 die Stadt oborniki. Die Vereinbarung über die Kooperation zwischen den Selbstverwaltungen des Großraums Poznań vom 15. mai 2007 hat einen neuen VORtRAG 41
43 Impuls für die Vertiefung und Verbesserung der Kooperation im Großraum gegeben. In der Vereinbarung sind Themen genannt, denen im Rahmen der Kooperation Vorrang eingeräumt wird: Wirtschaftsförderung marketing und Öffentlichkeitsarbeit Kommunale Wirtschaft Öffentlicher Verkehr Bildung Raumordnung Gesundheitsversorgung Fremdenverkehr und Ökologie Lösung von Problemen, die die Einwohnerinnen und Einwohner des Großraums betreffen Zwecks Umsetzung der Vereinbarung hat der Rat des Großraums Poznań weitere Integrationsmaßnahmen getroffen. In der Sitzung am 28. november 2008 in murowana Goślina hat der Rat das Projekt Funktionen und Entwicklungsrichtungen des Großraums Poznań beschlossen. Das Hauptziel des Projekts ist die Ausarbeitung einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie für die nächsten zehn Jahre. mit dieser Aufgabe wurde ein Expertenteam von den größten vier Hochschulen der Stadt Poznań betraut, dessen Tätigkeit vom Zentrum für metropolforschung der Adam-mickiewicz-Universität koordiniert wurde. Das Ergebnis der Arbeit des Konsortiums sind zwei strategische Dokumente: Das Grüne Buch des Großraums Poznań als Vorstrategie für breite politische und soziale Konsultationen und die endgültige Entwicklungsstrategie des Großraums metropole Poznań Die Dokumente wurden im Rahmen von zwei Tagungen der Selbstverwaltungen des Großraums Poznań am 1. Juni 2010 und am 15. Juni 2011 öffentlich präsentiert. In der Sitzung des Rats des Großraums Poznań am 26. Februar 2010 in der Stadt Kórnik wurden wichtige Entscheidungen für die Zukunft des Großraums getroffen. Seine mitglieder haben sich gemeinsam für die Umwandlung der bisherigen informellen Kooperationsform des Rates in eine rechtlich geregelte Kooperationsform eines Vereins ausgesprochen und als Bezeichnung für den Großraum Poznań wurde metropole Poznań gewählt. Der Verein metropole Poznań wurde im April 2011 eingetragen. Alle bisher im Rahmen des Rats des Großraums Poznań tätigen Einheiten mit Ausnahme der Gemeinde Czerwonak haben sich dem Verein angeschlossen. Der Gemeinderat dieser Gemeinde hat gegen den Beitritt zum Verein gestimmt, wobei als Argument die schlechten Beziehungen zur 42 VORtRAG
44 Wirtschaftsforum des Großraums Poznań: Starker Großraum moderne Metropole ; Präsentation des Grünen Buches des Großraums Poznań (2010) Stadt Poznań genannt wurden. Im Juni 2011 wurde die Stadt oborniki in den Verein aufgenommen. Derzeit hat der Verein 22 mitglieder. Zu den satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins metropole Poznań gehören unter anderem: Entwicklung von maßnahmen zur Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Entwicklungsstrategie des Großraums Poznań Initiierung und Begutachtung von Gesetzesentwürfen, die territoriale Selbstverwaltungen und Großräume betreffen Förderung des Erfahrungsaustauschs über die Aufgaben der Selbstverwaltungen Impulse für gemeinsame wirtschaftliche, kulturelle und soziale Initiativen und ihre Umsetzung Impulse für maßnahmen, die eine effektive und wirksame Verwaltung des Großraums ermöglichen Vertretung der Interessen der Vereinsmitglieder in allen gemeinsamen Angelegenheiten Informations- und Beratungstätigkeit sowie Strategieentwicklung Initiierung und Unterstützung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, die das Funktionieren und die Entwicklung des Großraums betreffen VORtRAG 43
45 Überwachung von sozial-wirtschaftlichen Aktivitäten und Umweltaktivitäten im Großraum Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildung zur Umsetzung der Ziele des Vereins Ein langfristiges Ziel des Vereins ist zudem die Förderung der maßnahmen zur Gründung eines Selbstverwaltungsverbandes, in dem sich territoriale Einheiten, die den Großraum bilden, zusammenschließen. Präsident des Vereins ist der Stadtpräsident von Poznań, einer der zwei Vize-Präsidenten ist der Landrat. Zum Vorstand, der im Rahmen der Gründungsversammlung im Februar 2011 ernannt worden ist, gehören darüber hinaus drei kommunale Vertreterinnen beziehungsweise Vertreter. Im Juli 2011 wurde die Leitungsstelle des Vereinsbüros ausgeschrieben. Am 1. Dezember 2011 wird er seine Arbeit aufnehmen. Sektorale (kommunale) Kooperation Außer in der politisch-strategischen Dimension zeigt sich die Selbstverwaltungskooperation im Großraum Poznań in einzelnen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, vor allem in der kommunalen Wirtschaft: Die Wasserversorgungs- und Kanalisationsinfrastruktur des Großraums wird zum großen Teil von der Aktiengesellschaft Aquanet verwaltet, die sich im Eigentum der Stadt Poznań (als mehrheitseigentümerin) und von neun Gemeinden des Vorstadtbereichs befindet. Aufgrund einer interkommunalen Vereinbarung hat die Stadt Poznań die Zuständigkeiten von sonstigen gemeindlichen Aktionären im Bereich der Wasserversorgungsund Kanalisationswirtschaft übernommen (unter anderem Beschlussfassung über das mehrjahresprogramm zur Entwicklung der Wasserversorgungs- und Kanalisationsinfrastruktur sowie Genehmigung der Tarife für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung). Aufgrund der Konsequenzen aktueller Urteile der Verwaltungsgerichte und der Kontroversen um die Höhe der Tarife in einzelnen Gemeinden ist der Fortbestand der Vereinbarung in der jetzigen Form allerdings höchst ungewiss. Einige Gemeinden des Großraums haben sich auch dem im Jahre 2000 eingetragenen Gemeindeverband Puszcza Zielonka ( Urwald Zielonka ) mit Sitz in murowana Goślina angeschlossen, der mit Hilfe von Fördermitteln der Europäischen Union den Bau der Kanalisationsinfrastruktur in den Gebieten innerhalb und in der Umgebung des Landschaftsparks Puszcza Zielonka realisiert. Im Bereich der Abfallwirtschaft wurde im September 2010 der Gemeindeverband Abfallwirtschaft des Großraums Poznań mit Sitz in Poznań eingetragen. Es ist der erste kommunale Verband, dem sich die Stadt Poznań nach der territorialen Verwaltungsreform im Jahr 1990 angeschlossen hat. Außer der Stadt Poznań sind dem Verband 44 VORtRAG
46 neun Gemeinden des Vorstadtbereichs beigetreten, vor allem aus dem nördlichen und östlichen Teil des Großraums. Der Aufgabenbereich des Verbands umfasst unter anderem die Entwicklung eines gemeinsamen Abfallwirtschaftsplans, die selektive Sammlung und Entsorgung der kommunalen Abfälle, die Schaffung der Voraussetzungen für Bau, Instandhaltung und Betrieb der Anlagen für die Verwertung von kommunalen Abfällen durch Unternehmen, die Schaffung der Voraussetzungen für die Reduzierung von kommunalen Abfällen sowie die Umweltbildung. mit der Abfallwirtschaft befasst sich auch der Gemeindeverband Zentrum für Abfallbewirtschaftung SELEKT mit Sitz in Czempin, der 2004 eingetragen wurde. Er setzt sich aus sechs Gemeinden des südwestlichen Teils des Großraums zusammen, aber seine Tätigkeit erstreckt sich auf ein weit größeres Gebiet und umfasst auch einige benachbarte Kreise. Aufgaben, die für einen Großraum typisch sind, erfüllt der im mai 2010 eingetragene Gemeindeverband Schronisko dla Zwierząt ( Tierheim ) mit Sitz in Kostrzyn, der von elf Gemeinden des Kreises Poznań gegründet wurde. Sein Ziel ist unter anderem die Sorge für obdachlose Tiere sowie der Bau und Betrieb eines Tierheims. Die Stadt Poznań und die Gemeinden aus dem westlichen Teil des Großraums sind nicht mitglieder des Verbands. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs wurden seit 2007 mehrere Vereinbarungen zwischen der Stadt Poznań und den benachbarten Gemeinden geschlossen. Die Kooperation in diesem Bereich beruht darauf, dass die Gemeinde des Vorstadtbereichs die Stadt Poznań mit der Beförderung von Personen auf einer bestimmten Linie beauftragt, die Stadt Poznań den Auftrag akzeptiert und ihn über die städtische Verkehrsverwaltung erfüllt. Die Vereinbarungen ermöglichen die Aufnahme von außerstädtischen Linien in das kollektive Verkehrssystem von Poznań. Das hat zur Folge, dass die Passagiere während der Fahrt nach und aus Poznań sowie innerhalb der Stadt ein und dieselbe Fahrkarte benutzen können. Eine weitere Etappe des Kooperationsprozesses ist die Gründung des Gemeindeverbandes Verkehr des Großraums Poznań durch die Städte Poznań und Luboń im november Im Jahre 2011 ist dem Verband auch die Gemeinde Dopiewo beigetreten, und auch die Gemeinden mosina und Puszczykowo beabsichtigen mitglied im Verband zu werden. Der Verband ist der neue Träger des öffentlichen Personenverkehrs auf dem Gebiet der Gemeinden, aus denen er sich zusammensetzt. Relativ gut entwickelt ist die Großraum-Kooperation im Bereich Fremdenverkehr. Zur Poznań Lokalen Fremdenverkehrsorganisation (PLoT), die im Jahre 2003 als Verein gegründet wurde, VORtRAG 45
47 gehören die Stadt Poznań, der Kreis Poznań und elf Gemeinden des Großraums. Außer den Selbstverwaltungseinheiten gehören zur PLoT auch die Kammern der wirtschaftlichen Selbstverwaltung, kulturelle Institutionen, Touristikunternehmen (unter anderem Hotels) sowie Unternehmen (beispielsweise die Internationale messe Poznań und Flughafen Poznań-Ławica). Zur Kooperation im Bereich Fremdenverkehr gehören auch die Gemeinden, in denen die größten naturräume des Großraums Poznań, der Landschaftsparks Puszcza Zielonka und der Großpolnische nationalpark (2008 von sieben Gemeinden als Verein mit Sitz in Puszczykowo gegründet), liegen. unter anderem die Aufgaben im Bereich Kindergärten und Kinderkrippen. Die Vereinbarungen werden auch auf der Kreisebene geschlossen. Der Kreis Poznań hat die Aufgaben auf die Stadt Poznań übertragen, die von den Facheinrichtungen (Adoptions- und Vormundschaftsstellen und psychologisch-pädagogische Beratungsstellen für Kinder) erfüllt werden. Die Stadt Poznań hat dagegen die Beschäftigungspolitik und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auf den Kreis Poznań übertragen. Das Kreisarbeitsamt ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten des lokalen Arbeitsmarktes für den ganzen Großraum zuständig. Im Bereich der Sozialdienstleistungen betreffen interkommunale Vereinbarungen der Stadt Poznań mit den benachbarten Gemeinden Auch die im Bereich der öffentlichen Sicherheit wichtigen Aufgaben werden kooperativ verwaltet. Die Zuständigkeit der städtischen Polizei- Einführung des Projekts Funktionen und Entwicklungsrichtungen des Großraums Poznań (2009) 46 VORtRAG
48 und Feuerwehrkommandanturen erstreckt sich sowohl auf die Stadt Poznań als auch auf den gesamten Kreis Poznań. Fazit Aus der Perspektive von 21 Jahren nach der Gründung von kommunalen Selbstverwaltungen und 13 Jahren seit der Entstehung von Kreisen ist der Umfang der interkommunalen Kooperationen auf dem Gebiet des Großraums Poznań relativ umfangreich. Die größten Defizite der bisherigen Integrationsmaßnahmen sind die Vielfalt von Kooperationsformen für einen Zweck und die begrenzten räumlichen Wirkungen, die sich bei keiner Kooperation auf den ganzen Großraum Poznań erstreckt. Einer engeren Koordinierung bedarf nach wie vor die Lösung von Problemen in den für die Entwicklung und für das Funktionieren des Großraums wichtigen Bereichen: zum Beispiel gemeinsame Strategieentwicklung, Raumordnung, Verwaltung der Straßeninfrastruktur, Ausbau der Eisenbahn im Großraum, Integration des öffentlichen Verkehrs sowie Zusammenarbeit im Bereich der Sozialdienstleistungen (unter anderem Gesundheitsversorgung, Kultur, Bildung, Sport, Fremdenverkehr). Die wachsenden funktionellen Probleme von stark urbanisierten Gebieten haben die polnische Staatsverwaltung dazu veranlasst, einen Entwurf zur gesetzlichen Regelung der Form und des Umfangs der Kooperation von Selbstverwaltungen in großstädtischen Gebieten zu präsentieren. Das sogenannte metropolgesetz als ein Instrument für Top-down-metropolintegration befindet sich derzeit in der Phase der Diskussionen und Abstimmungen. Unabhängig von ihrem Ergebnis sind jedoch Bottom-up-Formen der metropolzusammenarbeit erforderlich. Hinsichtlich ihrer Initiierung ist der Großraum Poznań landesweit führend. VORtRAG 47
49 PLENUMSDISKUSSION Moderation: Andreas Kuhnt, Hannover optimale kombination von harten und weichen kooperationsformen Bei den Kooperationsformen lässt sich bundesweit keine klare tendenz zu einem der verschiedenen Ansätze feststellen. Es hat sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass es notwendig ist harte und weiche Instrumente zu verknüpfen. Eine optimal organisierte Stadtregion besteht nach Einschätzung von Prof. Dr. Rainer Danielzyk (Leibniz Universität Hannover) aus einer formell verbindlichen Einheit, die beispielsweise Planungsrechte und ähnliches schafft, sowie aus einer informellen netzwerkartigen Kooperation, die unter anderem in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen mit den Akteuren agiert. Wichtig seien dabei die geschickte Anwendung der verschiedenen Instrumente und die Intensitätssteigerung der interkommunalen Zusammenarbeit. Jede Region habe dabei jedoch ihre eigene Planungstradition und Kooperationskultur und entwickle somit ein individuelles Kooperationsmodell. Dies sei an den verschiedenen Modellen, zum Beispiel in den Regionen Stuttgart und Hannover, gut zu erkennen. Folkert Kiepe vom Deutschen Städtetag weist ergänzend darauf hin, dass bei informellen Zusammenarbeitsformen, die zentrale Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung zum Gegenstand hätten, anzustreben sei, dass diese langfristig in formelle Formen übergingen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass der Zusammenhang von kommunaler Selbstverwaltung und demokratischer Legitimation verloren gehe. Das Ziel müsse in diesen Fällen auch die Schaffung neuer Verwaltungsstrukturen sein. hemmnisse bei der bildung von regionalen gebietskörperschaften Es stellt sich die Frage, warum die Bildung einer Region als Gebietskörperschaft bisher nur in der Region Hannover und in der Städteregion Aachen gelungen ist. Ein Grund liegt nach Einschätzung einiger teilnehmerinnen und teilnehmer im Organisationsrecht der Länder. Auch die Landkreise sähen in der Bildung solcher Regionen häufig einen Angriff auf vorhandene Strukturen. Im öffentlichen Sektor seien die Zuständigkeiten klar verteilt, sowohl auf kommunaler wie auch auf Landesebene. Und diese Zuständigkeiten seien, ob sinnvoll oder nicht, immer mit Kompetenzen und 48 PLENUMSDISKUSSION
50 Macht verbunden. Bei der Regionsbildung müsse daher für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation bei der Neuordnung von Zuständigkeiten hergestellt werden. Dies sei in den Regionen Hannover und Aachen gelungen. Polyzentrische Stadtregionen seien von dem Problem der Machtverteilung besonders betroffen, so Prof. Dr. Rainer Danielzyk. Der Aufbau einer gemeinsamen Organisationsform gestalte sich hier erfahrungsgemäß schwierig. Regionspräsident Hauke Jagau von der Region Hannover ergänzt, dass aber auch bei monozentrischen Regionen Probleme auftreten würden, sofern die Verwaltungsspitzen der Region und der Großstadt grundsätzlich unterschiedliche Zielvorstellungen hätten. Weiteren Einfluss auf eine Regionsbildung könne auch die Größe der Räume haben, vermutet Christian Breu vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München. Eine Region wie München, die sowohl von der Fläche wie auch von der Einwohnerzahl doppelt so groß wie die Region Hannover ist, sei zu groß, um daraus eine Gebietskörperschaft bilden zu können. Zudem lägen nur wenige Landkreise optimal ringförmig um eine größere Stadt verteilt. belebung und erweiterung der (stadt-)regionalen kooperation durch metropolregionen Metropolregionen könnten als erweitertes Instrument der regionalen Kooperation angesehen werden, meint Folkert Kiepe. Die Kooperationsbeziehungen reichten häufig sogar über Landesgrenzen hinweg. Dies kom- PLENUMSDISKUSSION 49
51 me der Sichtweise von Wirtschaftspartnern entgegen, deren Aktionsfeld inzwischen nicht nur die Stadtregion, sondern die Welt sei. So spielten bei den Metropolregionen informelle Kooperationen eine große Rolle, bei denen Verwaltung und Politik auch Wirtschaft und Gesellschaft mit einbezögen. Die Metropolregionen als integrativer Querschnittsansatz nehmen allerdings unter den Kooperationsformen eine besondere Stellung ein. Kernaufgabe einer Metropolregion sei nicht primär die Förderung stadtregionaler Zusammenarbeit, betont Prof. Dr. Rainer Danielzyk, auch wenn es gute Beispiele wie die Region Rhein-Neckar gebe, in der die Bildung einer Metropolregion zur Belebung der Kooperation geführt hätte. region hannover aufgaben dort erfüllen, wo es sinnvoll ist Die Bildung der Region Hannover brachte auch eine Übertragung von Aufgaben aus der Region an die Kommunen mit sich. Regionspräsident Hauke Jagau führt aus, dass der konzeptionelle Ansatz darin bestände, die beratungsintensiven Bereiche auf lokaler Ebene anzusiedeln. Ziel sei es also gewesen, möglichst viele der Aufgaben vor Ort erledigen zu lassen. Mit dieser neuen Aufgabenteilung gehe eine engere Zusammenarbeit, ein verbesserter Kontakt sowie neue Kooperationen zwischen der Landeshauptstadt und den Nachbarkommunen einher. So ist in einigen Städten eine Straßenverkehrsbehörde gebildet worden, die Zulassung von Kraftfahrzeugen erfolgt nun in 17 der 21 Städte und Gemeinden. Städte mit mehr als Einwohnerinnen und Einwohnern sind dazu verpflichtet, die Aufgabe als Bauaufsicht zu übernehmen, Gemeinden ab Einwohnerinnen und Einwohnern war diese Entscheidung selbst überlassen. Ebenso konnten Städte mit mehr als Einwohnerinnen und Einwohnern einen Antrag auf Aufgabenübertragung in der Jugendhilfe stellen. Dies hatte aber zur Folge, dass die Situation jetzt für Außenstehende schwieriger verständlich ist, da sechs Jugendämter plus das Jugendamt der Region existieren. Im Bereich der Schulträgerschaft bestand die Lösung darin, dass die allgemeinbildenden Schulen in die örtliche trägerschaft übergegangen sind. Darüber hinaus erläutert Regionspräsident Hauke Jagau, dass die Wirtschaftsförderung ein sensibles Feld in der interkommunalen Kooperation sei. Die Anforderungen und Probleme der Umlandkommunen unterschieden sich zum teil erheblich von denen der Großstadt. Daher ist entschieden worden, die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Region organisatorisch getrennt zu lassen. Es wird allerdings auf eigene Profile der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Hannover, der regionalen Wirtschaftsförderung sowie der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls geachtet, die 2003 von der Landeshauptstadt und der Region Hannover gegründet wurde und für die Arbeitsfelder Gründung, Wachstum und Ansiedlung, konzen- 50 PLENUMSDISKUSSION
52 triert auf Fokusbranchen, zuständig ist. Um Barrieren zu verringern und die Kooperation zu fördern, sind im Jahr 2011 die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Region in das Haus der Wirtschaftsförderung räumlich zusammengelegt worden. Fachlicher diskurs zur region hannover in der presse und in der regionsversammlung In den Medien ist der Prozess der Regionsbildung sehr stark unterstützt worden. Damit hat die Presse den Prozess mit vorangetrieben, denn es gab in der Politik immer mal wieder den einen oder anderen, der ein bisschen kalte Füsse bekommen hat, schätzt Regionspräsident Hauke Jagau ein. Bei der Bevölkerung seien dadurch große Erwartungen an die Region entstanden, die gar nicht alle einzulösen gewesen seien. Aber auch heute noch ist die Region Hannover in der lokalen Presse häufig präsent. Meist greift die Presse themen und Zuständigkeiten der Region auf, die den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Alltagswelt begegnen beispielsweise Aktuelles zum öffentlichen Personennahverkehr oder zur Altlastenbeseitigung. Laut Regionspräsident Hauke Jaugau ist der politische Alltag in der Regionsversammlung erfreulich wenig vom Kirchturmdenken bestimmt, Fachauseinandersetzungen dominierten. Nur wenn es zum Beispiel um Standortfragen ginge, spielten örtliche Interessen eine Rolle. Eine solche Entwicklung sei nicht unbedingt zu erwarten gewesen: Als es um die Auflösung des Landkreises und die Regionsgründung ginge, hätten die Umlandkommunen befürchtet, dass die Landeshauptstadt zu stark die themen bestimmen und die Richtung vorgeben würde. region als dach über einem gemeinsamen lebensraum Auch wenn die Bewohnerinnen und Bewohner der Region Hannover grundsätzlich positiv gegenüberständen, hätte für sie nach wie vor ihre Stadt beziehungsweise ihre Gemeinde Priorität auch wenn der Handlungsraum der Menschen und der Aktionsraum von Unternehmen die Stadtregion, wenn nicht gar die Welt sei. Die Region sei zu groß, zu abstrakt, häufig auch zu entfernt vom alltäglichen Leben und der Identität. Die Region könne aber als Dach über einem gemeinsamen Lebensraum angesehen werden, so die Meinung einiger teilnehmerinnen und teilnehmer. PLENUMSDISKUSSION 51
53 Anhand der Wahlbeteiligung lasse sich die regionale Identität nicht messen, führt Regionspräsident Hauke Jagau aus. Die Beteiligung an der Wahl zur Regionsversammlung sei nicht signifikant anders als im Vergleich zu anderen Kommunalwahlen. Wie auch bei den Landkreisen sei davon auszugehen, dass die Aufgaben der Region Hannover im Vergleich zur Gemeinde oder Stadt für den einzelnen Bürgerinnen und Bürger schwieriger zu durchschauen sind. Eine regionale Lebensweise könne allerdings initiiert werden, erläutert Prof. Dr. Rainer Danielzyk. Ein Beispiel dafür sei die REGIONALE 2010 im Köln-Bonner- Raum. Dort erfolge durch eine bewusste Inszenierung wie den langen tag der Region ein bemerkenswerter Fortschritt an regionaler Bewusstseinsbildung. Das Regionsgefühl werde erlebbar gemacht, medial präsentiert ein gelungenes Beispiel für Regionalmarketing. 52 PLENUMSDISKUSSION
54 Workshop 1: FREIRAUM UND ERHOLUNG
55 LANDSCHAFtSPARK REGION StuttGARt NEUE WEGE DER FREIRAUMENtWICKLUNG Silvia Weidenbacher, Verband Region Stuttgart Die Region Stuttgart ist geprägt durch eine hohe wirtschaftliche Dynamik und mit einer Bevölkerungsdichte von 732 Einwohnern/Quadratkilometer eine der am stärksten verdichteten Regionen in Deutschland. Vor diesem Hintergrund ist es für den Verband Region Stuttgart ein wichtiges Ziel, zur Sicherung der Lebensqualität die vielfältigen Freiräume in ihrem Umfang und ihrer Qualität zu erhalten und, wo notwendig, aufzuwerten. Für die rund 2,7 Millionen in der Region Stuttgart lebenden Menschen soll ein Angebot für eine naturnahe, umweltfreundliche Erholung geschaffen werden. Daneben soll der Bevölkerung der Wert und die Einmaligkeit der regionalen Landschaft bewusst gemacht werden. Aufbauend auf eine stringente formale Regionalplanung, die Freiräume in ihrem Zusammenhang sichert, dient vor allem das informelle Instrument des Landschaftsparks Region Stuttgart dazu, diesem Anliegen Rechnung zu tragen. Konzeption und Umsetzung des Landschaftsparks gehören dabei ebenfalls zu den gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben des Verbands Region Stuttgart.
56 Glemspark mit Grünem Strohgäu Landschaftspark Schönbuch Filderpark Landschaftspark Murr-Bottwartal Stand der Entwicklung von Masterplänen Landschaftspark Limes Abgeschlossene Masterpläne Masterpläne in Arbeit Masterpläne in Arbeit (in Auftrag der Kommune) Masterpläne beantragt Rahmenkonzept vor 2004 entwickelt Landschaftspark Rems Landschaftspark Fils Landschaftspark Albtrauf Die Region Stuttgart ist landschaftlich äußerst vielgestaltig. Dies reicht von großen landwirtschaftlich geprägten Flächen mit hervorragenden Böden über ausgedehnte Waldlandschaften bis zu idyllischen Wein- und Streuobsthängen mit höchster ökologischer Wertigkeit. Im Ballungsraum zeigt sich aber auch die Kehrseite des wirtschaftlichen Wachstums, mit von Verkehrstrassen zerschnittenen Restlandschaften und kanalisierten und verbauten Flussläufen. Auf diesen vielfältigen Voraussetzungen baut die Konzeption des Landschaftsparks Region Stuttgart auf und definiert den planerischen Rahmen für die Weiterentwicklung und Gestaltung der grünen Infrastruktur. Um den unterschiedlichen Voraussetzungen der teilräume in der Region Rechnung zu tragen, setzt sich der regionale Landschaftspark aus teilparks zusammen, die auf Naturraumebene abgegrenzt werden. Für diese werden sogenannte Masterpläne erarbeitet, die stark umsetzungsorientiert sind. Sie dienen als Leitschnur für eine interkommunal abgestimmte Landschaftsentwicklung. Inhaltliche Schwerpunkte der Masterpläne können neben Naherholung, Naturschutz und Landschaftsgestaltung auch tourismus und regionale Vermarktung sein. Derzeit liegen Masterpläne für Flusstäler wie das Neckar-, das Fils- und das Remstal, aber auch für großräumige Kulturlandschaften im Bereich des Limes im Schwäbischen Wald oder der Schwäbischen Alb vor. Jedes teilkonzept ist auf die charakteristischen Gegebenheiten abgestimmt. Steht beim Masterplan Neckar die Zugänglichkeit und Aufwertung des Flusses im Vordergrund, so richtet sich beim Masterplan Albtrauf das Augenmerk auf die Entwicklung und Erlebbarkeit der Kultur- und Naturlandschaft. gemeinsam entwickeln und umsetzen eine strategie mit zwei säulen Mit der Erarbeitung von Masterplänen zusammen mit den Kommunen eines regionalen teilraumes werden maßgeschneiderte Konzepte zur Freiraumentwicklung bereitgestellt. Die Konzepterstellung für einzelne teilräume erfolgt in der Regel durch externe Planungsbüros im Auftrag der Region und in enger Kooperation und Abstimmung mit den beteiligten Städten und Gemeinden. Am Masterplan für den Albtrauf haben beispielsweise 25 Städte und Gemeinden mitgearbeitet. Insgesamt gibt es bisher für mehr als die Hälfte aller 179 Städte und Gemeinden in der WORKSHOP 1 55
57 Region Stuttgart solche planerischen Konzepte zur Landschaftsgestaltung. Weitere teilbereiche werden folgen. Im Bottom-up -Prinzip erarbeiten Planungsexperten, kommunale Entscheidungsträger und lokale Akteure die Konzeption sowie die konkreten Projekte und Maßnahmen. Am Ende jedes Masterplanes steht ein Bündel an umsetzungsreifen sogenannten Starterprojekten. Das können Aufenthaltsbereiche am Fluss, Uferrenaturierungen, Radwegeverbindungen oder auch besondere Landmarken sein. Die Umsetzung der konkreten Maßnahmen erfolgt ebenfalls zusammen mit den Kommunen. Dank einer breiten politischen Unterstützung kann der Verband Region Stuttgart im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten bis zu 50 Prozent der Kosten der kommunalen Projekte übernehmen. Der Rest wird von den Kommunen selbst finanziert. Aber auch die Zuwendung aus Förderprogrammen der Gebietskulisse für den Masterplan Albtrauf Leutenbach Höllachaue Europäischen Union, des Bundes oder des Landes sowie die Beteiligung weiterer Partner spielen eine Rolle. In einem jährlich stattfindenden Wettbewerb, den der Verband Region Stuttgart auslobt, können alle Städte und Gemeinden in der Region Projektideen zur Freiraumgestaltung einreichen. Damit erhalten nicht nur Kommunen, die an einem Masterplan beteiligt sind, die Chance, gute Ideen zu verwirklichen, sondern alle 179 Städte und Gemeinden. Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Regionalparlamentes, wählt die förderfähigen Projekte aus. Seit 2005 hat der Verband Region Stuttgart rund 8,5 Millionen Euro bereitgestellt: Damit wurden Gesamtinvestitionen von nahezu 23 Millionen Euro ausgelöst, mit denen über 100 Projekte finanziert wurden. 56 WORKSHOP 1
58 Der Verband Region Stuttgart engagiert sich darüber hinaus in verschiedenen Projekten der Europäischen Union, die ebenfalls zur Realisierung des Landschaftsparks beitragen. So konnten bislang rund zwei Millionen Euro aus den europäischen Programmen INtERREG und Life+ in mehrere Maßnahmen im Bereich des Landschaftspark Neckar investiert werden. Damit konnten beispielsweise die Wiederherstellung eines Neckar-Altarms, eine Verbesserung der Neckarufer in mehreren Kommunen sowie der Ausbau des Neckarradwegs verwirklicht werden. landschaftspark als impuls zur Weiterentwicklung bestehender instrumente Während der Arbeiten am Masterplan Landschaftspark Rems ist die Idee entstanden, diesen im Rahmen einer Landesgartenschau weiterzuführen und umzusetzen. Unter Federführung des Verbands Region Stuttgart haben sich 15 Städte und Gemeinden beim Land Baden- Württemberg dafür eingesetzt. Mit seiner räumlichen Dimension, dem ganzheitlichen Ansatz zur Landschaftsentwicklung und dem interkommunalen Ansatz sprengt das Projekt allerdings die Dimensionen bisheriger Gartenschauen. Das Land hat den Modellcharakter des Projekts und die Chance, die darin für Baden-Württemberg liegt, erkannt und den Zuschlag für eine interkommunale Gartenschau mit Zieljahr 2019 erteilt. Dem Landschaftspark ist es hier gelungen, den Impuls zur Weiterentwicklung eines etablierten Landesprogramms zu setzen und eine Verknüpfung von Strukturpolitik und Regionalentwicklung herzustellen. Radweg Nürtingen Regionale Landschaftsparkkonzepte, die auf freiwilliger Basis eine Zusammenarbeit zwischen kommunaler und regionaler Ebene in Gang setzen, spannen den Bogen zwischen regionaler Strategie und lokaler Umsetzung. Sie zeigen sich damit als zukunftsfähiges Instrument, das den Kanon der klassischen Instrumente der Raumplanung um eine umsetzungsorientierte Komponente bereichert. WORKSHOP 1 57
59 GARtENREGION HANNOVER BAUStEIN DER REGIONALEN NAHERHOLUNG Astrid Eblenkamp, Region Hannover Naherholung, das ist das Glück, vor der eigenen Haustür gleichzeitig Entspannung und erholsame Anregungen zu finden. Und wo kann dies besser gelingen als an duftenden, farbenfrohen, Licht umspielten, luftigen, sinnlichen, romantischen, Baum bestandenen, Wind umwehten, barfuss freundlichen, vom Himmel umspannten Orten, kurz: im Grünen? Sind Sie schon mal durch das beeindruckende Grüne Gewölbe, dem uralten Laubengang im Amtsgarten von Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge geschlendert? Standen Sie schon mal inmitten der herrlichen Blütenpracht der Hortensienbeete in Wennigsen? Haben Sie schon mal vom Berggasthaus Niedersachsen auf dem Gehrdener Berg den weiten Blick über das Calenberger Land schweifen lassen? Oder hatten Sie schon mal das lehrreiche Vergnügen einer Führung durch den Schulbiologiegarten in Hannover-Burg?
60 Die Region Hannover ist wunderbar entspannend und anregend zugleich, denn sie bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern mal abgesehen von den weltweit bekannten Herrenhäuser Gärten und den klassischen Naherholungsgebieten Steinhuder Meer und Deister eine wahre Fülle von kleiner und größerer Gärten, Parks und Grünflächen gleich um die Ecke. investitionen für mehr lebensqualität So manche grüne Oase existierte in der Vergangenheit weitgehend im Verborgenen, einige wurden über die Jahre hinweg vernachlässigt, viele unterschätzt. Die Gartenregion Hannover möchte dies ändern. Sie präsentiert die vielfältigen Potenziale der Gärten, Parks und Landschaften offensiv, indem sie sie kulturell bespielt und durch ihre Inszenierung die öffentliche Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Damit will die Gartenregion die gartenkulturellen Qualitäten der Region Hannover stärken und weiterentwickeln sowie die kulturtouristischen Potenziale der Region ausweiten und ausschöpfen. Die Gartenregion will grünes Bewusstsein schaffen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden und die Region Hannover so sympathisch und attraktiv machen, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Region mit ihr identifizieren. Ihr Ziel: Die vorhandene hohe Lebensqualität für die rund 1,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Region nicht nur sichern, sondern ausbauen. Von der Geburtsstunde der Gartenregion Hannover in den Jahren 2003/2004 bis Ende 2010 konnten bereits mehr als 60 Ensembles, Einzelgärten, Erlebnispunkte und besondere Orte identifiziert werden, die wiederentdeckt, zugänglich gemacht, aufgewertet und entwickelt wurden. Zu diesen Grünen Orten gehören unter anderem der Zechenpark in Barsinghausen, die Leutnantswiesen in Neustadt am Rübenberge, der Geologische Erlebnispfad Brelinger Berge, der Amtsgarten in Burgdorf, der Erlebnisturm Waldstation Eilenriede in Hannover, der Bürgerpark Arnum, der Bürgerpark Junkernwiese in Seelze, der Ottomar-von-Reden- Park in Gehrden und mehrere Gesundheitsgärten an verschiedenen Krankenhausstandorten des Klinikums Region Hannover. Heute kann ein breites Publikum die Schönheit und Vielfalt dieser Grünen Orte erleben. Die Region Hannover beteiligte sich zwischen 2004 und 2010 an den dafür nötigen Qualifizierungsmaßnahmen mit rund 2,2 Millionen Euro. Die Eigenanteile der Städte und Gemeinden sowie privater Gartenbesitzer und Sponsorenmittel vervierfachten diese Summe fast. Insgesamt führte die Gartenregion innerhalb der sechs Jahre zu Investitionen in Höhe von circa 8,7 Millionen Euro. Diese kamen vornehmlich dem örtlichen beziehungsweise regionalen Handwerk und Gewerbe zu Gute. Einen Überblick und eine Beschreibung der Parks und Gärten, deren Qualifizierung die Gartenregion gefördert beziehungsweise als eigene Maßnahme vorangetrieben hat, bietet die Broschüre Grüne Orte Ensembles, Gärten & Parks, Erlebnistouren, Besondere Orte (Gartenregion Hannover 2009). WORKSHOP 1 59
61 vom projekt zur kontinuierlichen aufgabe Zunächst startete die Gartenregion Hannover als zeitlich befristetes Projekt mit dem Ziel der Durchführung eines Aktionsjahres. Das Gartenjahr lockte die heimische Bevölkerung sowie Gäste von auswärts von Januar bis Dezember 2009 mit einem Feuerwerk aus 700 Veranstaltungen und Aktionen an die Grünen Orte der Region. Es lud zum Beispiel mit Ausstellungen, Opern, Lesungen, Festen, Musical, theater, Gottesdiensten und Picknicks zu einer Entdeckungsreise durch das Grün der Region. Als Beispiele für Veranstaltungen des umfassenden Jahresprogramms 2009 seien an dieser Stelle das internationale Kunstprojekt Neulicht am See am Maschsee, das Musical Der Geheime Garten, die Oper auf dem Lande im Rittergut Eckerde I in Barsinghausen (seit 2009 jährlich), der Landschaftskunstpfad Ronnenberg (seit 2009 jährlich) und die Lesung von Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux auf der Kalihalde Empelde (seit 2009 jährlich) erwähnt. Organisiert und koordiniert wurde das breit gefächerte Angebot von einem in der Regionsverwaltung eigens eingerichteten mehrköpfigen Projektbüro unter der künstlerischen Leitung von Viktoria Krüger. Das Programm sprach sehr unterschiedliche, doch in aller Regel deutlich garten-, kunst- und kultur- sowie geschichtsaffine Zielgruppen an. Rund Besucher, davon etwa Besucher von außerhalb der Region, kamen. Das Konzept des kulturellen Bespielens der Gärten und Parks, um sie ins Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stellen, ging auf. Wintergärten IV : Verwandlung von öffentlichem Raum und Privatgärten in Kunst (2009) Blaue Orte : Das Jahresthema der Gartenregion 2012/13 60 WORKSHOP 1
62 profilieren. Die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern der Region honorierten diesen Erfolg und versahen die Gartenregion Hannover durch Beschluss der Regionsversammlung vom 11. Mai 2010 mit einer zehnjährigen Perspektive bis Sie soll auch weiterhin die besonderen Grünqualitäten der Region Hannover hervorheben und bekannt machen. Schon in den Jahren 2010 und 2011 setzte die Region Hannover die Gartenregion mit einem konzentrierten Veranstaltungsprogramm und der Förderung mehrerer Infrastrukturprojekte, allerdings auf deutlich geringerem finanziellem Niveau, fort. Wie vorgesehen wurde das Projektbüro aufgelöst. Nunmehr wird das team Regionale Naherholung der Region Hannover die Gartenregion als kontinuierliche Aufgabe fortführen und sie weiterentwickeln. Die Besteigung des Mont Ventoux : Lesung auf der Kalihalde Empelde (2009) Die Besucherzahlen des Gartenjahres beweisen, dass Parks und Gärten richtig in Szene gesetzt dazu beitragen können, die Attraktivität der Region Hannover zu steigern und sie insbesondere bei der heimischen Bevölkerung als attraktiven Lebens- und Wohnstandort mit hohen Erholungs- und Kulturqualitäten zu verwurzelung in langjähriger garten- und naherholungstradition Die Region Hannover besitzt eine reiche Gartentradition. Das Ensemble der Herrenhäuser Gärten mit Großem Garten, Berg-, Georgen- und Welfengarten währen bereits Jahrhunderte und sind weltberühmt. Die Gartenregion findet ihre ideellen Wurzeln konkret in der Stadt als Garten, einer Idee von Kaspar Klaffke, der bis 2002 das Grünflächenamt der Stadt Hannover leitete, zur Weltausstellung EXPO Ihre Umsetzbarkeit beruht auf den unzähligen grünen Orten in der Region, die sich in der öffentlichen, WORKSHOP 1 61
63 halb-öffentlichen sowie ausgeprägten und vielfältigen privaten Gartenkultur (Beispiel Offene Pforte) finden lassen. Auch die Naherholung hat in der Region Hannover tradition, die sich bereits in den Aktivitäten der Vorgängerinstitution der Region Hannover, dem Kommunalverband Großraum Hannover zeigte. Bereits in den 1970er Jahren nahm dieser die Planung von Naherholungsvorhaben, die konkrete Gestaltung von Erholungsflächen und -gebieten sowie die raumordnende Funktion für die Naherholung wahr. Mit der Gründung der Region Hannover im Jahr 2001 ging die Aufgabe der Förderung der regionalen Naherholung auf die neue Behörde über und wurde im Regionsgesetz festgeschrieben. Ihre Umsetzung erfolgte und erfolgt derzeit noch immer über das Regionale Naherholungskonzept 2004, das den inhaltlichen und räumlichen Handlungsrahmen absteckt. inszenierung als neuer strategischer ansatz Wesentliche Ausführungen des Naherholungskonzeptes 2004 gelten der Gartenregion. Während andere Inhalte des Konzeptes vor allem investive Infrastrukturmaßnahmen fokussieren (siehe Grüner Ring, FAHRRADREGION, Wietzepark und mehr) und einem klassischen Planungsverständnis entsprechen, rückt die Gartenregion das qualitätvolle Bespielen und Inszenieren von grünen Naherholungsorten, insbesondere Gärten und Parks, in den Mittelpunkt. Damit verfolgte die regionale Naherholung seit 2004 einen neuen strategischen Ansatz des Marketings im Sinne der Produktentwicklung und der Öffentlichkeitsarbeit. Mit der Gartenregion erweiterte sie ihr seit Jahren gut funktionierendes und wirksames Medienspektrum aus Broschüren, Flyern, Karten und Internetauftritten um Veranstaltungen. Letztere stehen als charakteristisches und unabdingbares Element im Zentrum des Angebotes. Die inszenierende, häufig künstlerische und die Sinne ansprechende Vermittlung der Freiraum- und Grünqualitäten an die Bürgerinnen und Bürger der Region wurde zum prägenden Charakteristikum der Gartenregion. Mittelfristig wird angestrebt, die Marke Gartenregion auch im touristischen Wettbewerb um Gäste aus Deutschland und darüber hinaus zu nutzen. nachhaltigkeit durch konzentration und vernetzung Wie geht es nun weiter? trotz der allseitigen Anerkennung der Erfolge der Gartenregion bleibt es zukünftig eine Herausforderung, sie unter den Voraussetzungen knapper kommunaler Haushalte und konkurrierender Aufgaben kontinuierlich weiter zu entwickeln und qualitativ wie quantitativ auf dem bislang schon erreichten Niveau zu sichern. Die Fokussierung von finanziellen und personellen Ressourcen auf vorhandene Grüne Orte sowie die Konzentration des jährlichen Programms auf qualitativ hochwertige und publikumsstarke Veranstaltungen unter dem Dach eines Jahres- beziehungsweise Zweijahresthemas erscheint angesichts der gegebenen Rahmenbedingungen ebenso erforderlich wie die Etablierung eines wertschätzenden (Pflege-)Bewusstseins für die neu geschaffenen beziehungsweise umgestalteten 62 WORKSHOP 1
64 KörperKleiderBild : Textile Kunst an grünen Orten (2011) Grünstrukturen bei allen beteiligten Partnerinnen und Partnern. Die Gartenregion umzusetzen, hieß stets intensive Netzwerkarbeit, an der unterschiedliche regionale Partner aus Kunst, Kultur, Verwaltung, Vereins- und Verbandsleben beteiligt waren dies wird auch zukünftig nötig sein. Damit die Gartenregion eine nachhaltige organisatorische, finanzielle und inhaltliche Struktur erhält und ihre Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen dauerhaft wirken können, müssen sie und andere zentrale Projekte der regionalen Naherholung beziehungsweise der Region Hannover zum Beispiel aus den themenfeldern Radfahren und Wandern, themenrouten, Neue Medien, Klimaschutz und Demografie eng miteinander verzahnt werden und ineinander greifen. Einen Schritt in diese Richtung ist die Region Hannover bereits durch die Wahl des themas für das kommende Jahr gegangen: In 2012 werden die Blauen Orte der Region, also Orte mit Bezug zu Wasser, im Mittelpunkt der Gartenregion stehen. WORKSHOP 1 63
65 die MontANREGION ERZGEBIRGE EINE KultUR- LANDSCHAFt AUF DEM Weg ZUM UNESCO-WELtERBE Nach den ersten Silberfunden im Jahre 1168 beim heutigen Freiberg erfasste der Bergbau bis ins 15. Jahrhundert das gesamte Erzgebirge und hatte einen tief greifenden und nachhaltigen Einfluss auf die gesamte Entwicklung dieses heute noch am dichtesten besiedelten Mittelgebirges Europas. Tausende Bergleute, Handwerker, Kaufleute und Abenteurer strömten nach dem großen Bergkgeschrey in das Erzgebirge. Bergsiedlungen und Bergstädte wurden gegründet, die Landschaft verändert, die Entwicklung von Technologie und Wissenschaft, Kunst und Kultur bis hin zu Traditionen und Brauchtum nachhaltig geprägt. Neben Silber wurden auch Erze der Metalle Zinn, Arsen und Wolfram, Blei, Kupfer und Zink, Kobalt, Wismut und Nickel bis hin zum Uran abgebaut, verhüttet und teilweise weiterverarbeitet. Das Montanwesen war die prägende Industrie der gesamten 850-jährigen Entwicklung des Erzgebirges und hat beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze eine einzigartige Kulturlandschaft hervorgebracht, die bis heute an einer Vielzahl originaler historischer Sachzeugen sowie landschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Merkmale abzulesen ist. Dr. Jens Uhlig, Planungsverband Region Chemnitz
66 te Kunstgraben- und teichsysteme, Röschen, Floßgräben oder Kohlenstraßen bis hin zu den gewaltigen Halden und Flächen des Uranbergbaus der jüngsten Zeit. Bergstädte, Siedlungen und Baudenkmale Mehr als 30 im sächsischen und über 20 im böhmischen Erzgebirge neu gegründete Städte mit zahlreichen profanen und sakralen Baudenkmalen wie Kirchen, Rathäuser, Adelspaläste und Wohnhäuser von Bergbeamten und Bergarbeitern. Bergbaulandschaft bei Annaberg-Buchholz; Terrakonikhalden der Wismut-Schachtanlage 116 in Buchholz mit Blick zur St. Annenkirche in Annaberg Das Besondere und weltweit Einmalige der industriellen Kulturlandschaft Erzgebirge ist ihr Facettenreichtum. Dazu gehören: Über- und untertägige Montandenkmale Zu ihnen zählen neben Fördergerüsten, Schachtgebäuden, Bergschmieden, Huthäusern, Kauen, Hochöfen, Schmelzhütten, Poch- und Hammerwerken, historischen Schächten, Grubenbaue und Stollen auch technische Denkmale wie Hüttengebläse, Wasserräder, turbinen, Dampfmaschinen, Grubenbahnen sowie Werkzeuge und Ausrüstungen der Berg- und Hüttenleute. Flora, Fauna, Geo- und Biotope Die Montanlandschaft brachte über Jahrhunderte eine ganz eigene besondere Pflanzen- und tierwelt hervor, die heute größtenteils geschützt ist. Kunst, Musik und Literatur Das Montanwesen bildete sowohl die wirtschaftliche Grundlage künstlerischer Aktivitäten als auch ein zentrales Motiv der Darstellung in der sakralen und weltlichen Kunst des Erzgebirges. Volkskunst, Brauchtum und Kunsthandwerk Jahrhundertalte traditionen wie Mettenschichten, Bergparaden und Bergaufzüge leben ebenso fort wie traditionelle Handwerkskunst des Klöppelns, Schnitzens und Drechselns. Bergbaulandschaften Von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Haldenzügen, über ausgedehn- Bildung, Wissenschaft und Landespolitik Wohl kaum eine Bergbauregion der Welt hat so viel WORKSHOP 1 65
67 zur Entwicklung der Montan- und Geowissenschaften, der Entstehung eines montanwissenschaftlichen Bildungswesens oder der ökonomischen, rechtlichen und verwaltungsmäßigen Herausbildung des frühneuzeitlichen Staatswesens beigetragen wie das Erzgebirge. All diese Facetten formten über Jahrhunderte eine einzigartige Kulturlandschaft von internationaler Bedeutung und waren 1998 ausschlaggebend für die offizielle Aufnahme der Montan- und Kulturlandschaft Erzgebirge in die deutsche Welterbe-tentativliste, dem ersten Schritt auf dem Weg zur Aufnahme in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Bereits kurz danach wurde eine Welterebe-Projektgruppe am Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und technikgeschichte an der tu Bergakademie Freiberg gebildet, die bis heute an der Umsetzung des Projektes arbeitet. Im Auftrag des 2003 gegründeten Fördervereins Montanregion Erzgebirge e.v. auf der finanziellen Grundlage privater Sponsorengelder und mit Unterstützung und Förderung durch das Regionalmanagement Erzgebirge erarbeitet die Projektgruppe Machbarkeitsund Umsetzungsstudien, prüft die in Frage kommenden, für die Montanregion Erzgebirge repräsentativen Objekte mit ihren Einzeldenkmalen und Sachgesamtheiten, stimmt diese mit den jeweiligen infrastrukturellen und wirtschaftlichen Planungen vor Ort ab, bringt sie in Einklang mit der kommunalen Bauleitplanung und bereitet die entsprechenden Beschlüsse der Gemeindegremien vor. Da es sich bei dem Welterbe-Projekt Montanregion Erzgebirge um ein grenzübergreifendes Kulturlandschaftsprojekt handelt, arbeiten Initiativen beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze eng bei der Realisierung des Projektes zusammen. Die beteiligten Bezirke Usti nad Labem und Karlovy Vary haben ebenfalls Projektgruppen gegründet, die Vorschläge für potenzielle Objekte des Projektes auf der böhmischen Seite des Erzgebirges ausarbeiten und die entsprechenden Umsetzungsstudien erstellen. Bis Ende 2012 sollen alle notwendigen Antragsunterlagen für die dann etwa 40 deutschen und knapp 20 tschechischen Objekte fertig gestellt sein, um am 1. Februar 2013 durch die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit der tschechischen Republik als grenzüberschreitendes Projekt den Welterbeantrag bei der UNESCO stellen zu können. Die vom Bergbau geprägte Identität und die Authentizität der Kulturlandschaft Montanregion Erzgebirge sind weltweit beispiellos und erfüllen im besonderen Maße die Anforderungen der Welterbekonvention. Die Montan- und Kulturlandschaft Erzgebirge beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze ist ein außergewöhnliches Zeugnis der Erzgewinnung und -verarbeitung vom 12. bis zum 20. Jahrhundert sowie der zugehörigen sozialen, wirtschaftlichen und naturräumlichen Auswirkungen. Die für 2013 bis 2015 angestrebte Anerkennung der Montanregion Erzgebirge als UNESCO-Welterbe ist eine 66 WORKSHOP 1
68 Rothschönberger Stollen ( ), Entwässerungsstollen des Freiberger Lagerstättenreviers einmalige Chance für die Region sowie für Sachsen, das Erzgebirge als eine lebendige, sich weiter entwickelnde Kulturlandschaft von außergewöhnlicher Bedeutung für das Erbe der Menschheit zu erhalten, weltweit bekannt zu machen und der Region neue Entwicklungsimpulse zu verleihen. Durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten am Welterbe-Projekt in der Antragsphase, den Austausch von Erfahrungen und die gemeinsame Erarbeitung der Grundlagen für die Entwicklung eines tragfähigen und nachhaltigen Konzepts führt bereits der Weg zum Welterbe-titel zu einem erkennbaren Zugewinn für die gesamte Region. Die große Akzeptanz und die Identifikation der Bewohner der Erzgebirgsregion mit dem Welterbe-Projekt sowie die weltweite Bekanntheit Untertägiger Gangerzbergbau im Erzgebirge und das überaus positive Image des Welterbe-titels werden das Marketing für das Erzgebirge wesentlich verstärken und zur nachhaltigen Förderung der Region beitragen. Co-Autoren dieses Beitrages: Prof. Dr. phil. habil. Helmuth Albrecht, Friederike Hansell M.A. und Dipl.-Geol.(FH) Jens Kugler, technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und technikgeschichte Dipl.-Ind. Arch. Jane Ehrentraut, Förderverein Montanregion Erzgebirge e.v. WORKSHOP 1 67
69 Das LEIPZIGER NEUSEEN- LAND ZWISCHEN AKtIVEM BRAUNKOHLENBERGBAU UND LANDSCHAFtEN NACH DER KOHLE In der Region Leipzig-Westsachsen wird seit über 300 Jahren Braunkohle gewonnen. Ab 1850 entwickelte sich der Braunkohlenbergbau rasch zu einer der Hauptsäulen für die Industrialisierung in Mitteldeutschland. Zahlreiche Innovationen wie die Brikettierung (ab 1858), die Braunkohlenverschwelung (ab circa 1860), die Verstromung in Großkraftwerken (ab 1910) und die Treibstoffsynthese (ab circa 1915) bildeten Hochtechnologien ihrer Zeit. Ab 1920 traten Großtagebaue in Erscheinung, die in ihren Dimensionen mit den heutigen Förderstätten bereits vergleichbar waren. Zugleich begannen damit gravierende Eingriffe in die gewachsenen Kulturlandschaften, die maßgeblich durch Ortsverlegungen und durch die bergbauliche Inanspruchnahme von Flussauen und Waldgebieten zum Ausdruck kamen. Prof. Dr. habil. Andreas Berkner, Leiter Regionale Planungsstelle, Regionaler Planungsverband Leipzig- Westsachsen Nach 1945 bildete die Braunkohlenindustrie einerseits das Rückgrat der Energieversorgung in der damaligen DDR. Unter planwirtschaftlichen Bedingungen wurden die Förder- und Veredlungskapazitäten massiv ausgebaut wurde das historische Fördermaximum im Mitteldeutschland mit fast 150 Millionen Tonnen Jahresförderung erreicht.
70 1989 waren noch 20 tagebaue in Betrieb; zugleich fanden im Industriezweig rund Bergleute Beschäftigung. Andererseits wurde der Bergbauraum angesichts der gravierenden Umweltschäden als ökologisches Katastrophengebiet wahrgenommen. Eine Gesamtflächeninanspruchnahme von circa 500 Quadratkilometer, die Umsiedlung von über Menschen sowie die weit reichenden Rauchgas- und Abwasserbelastungen verdeutlichen die damalige Situation. Die kumulativen Massenumlagerungen durch Kohleförderung (8,6 Milliarden tonnen) und Abraumbewegungen (19 Milliarden Kubikmeter) erreichten den Umfang einer quartären Inlandeisüberfahrung, allerdings beschleunigt um den Faktor Zehntausend. Nach der Wirtschafts- und Währungsunion sowie der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 standen die Fragen der Perspektive für den aktiven Braunkohlenbergbau sowie der Bewältigung der Rekultivierungsdefizite im Gesamtumfang von circa fünf Milliarden Euro im Revier im Vordergrund. Dabei übernahm der 1992 gegründete Regionale Planungsverband eine Schlüsselposition, indem er über die Aufstellung von Braunkohlenplänen als teilregionalpläne Vorgaben an die Bergbauunternehmen für Abbau und Folgenutzungen erarbeitete. Zugleich wurde damit für die kommunale Ebene ein belastbarer und zugleich ausformbarer Handlungsrahmen geschaffen. Insgesamt wurden für das Verbandsgebiet neun derartige Planwerke aufgestellt. Zwischenzeitlich erfolgten mehrere Fortschreibungen, so dass bis derartige Verfahren Braunkohlenveredlungswerk Espenhain 1989 abgeschlossen werden konnten. Damit konnte der Planungsverband den Rucksack der Vergangenheit ablegen und sich als anerkannter Akteur in der betroffenen Region profilieren. Im Zuge des aktiven tagebaubetriebs waren bis 1995 ausgehend vom Bedeutungsverlust der Braunkohle und der problematischen Akzeptanzsituation Grundentscheidungen zu den Perspektiven zu treffen, wobei auch ein Komplettausstieg bis zum Jahr 2000 im Raum stand. In der Planungsregion kam es letztlich über den Braunkohlenplan zur Ertüchtigung und zum Weiterbetrieb des tagebaus Vereinigtes Schleenhain, dessen Kohlevorräte bis circa 2040 reichen. Einziger Abneh- WORKSHOP 1 69
71 mer ist das 2000 in Betrieb genommene Kraftwerk Lippendorf mit insgesamt 1840 Megawatt installierter Leistung, das zudem über eine Kraft-Wärme-Kopplung rund 50 Prozent der benötigten Heizenergie für die Stadt Leipzig zu Verfügung stellt. Mit einem Brennstoffausnutzungsgrad von über 46 Prozent zählt das Kraftwerk bis heute zu den weltweit modernsten seiner Art und läuft stabil im Grundlastbetrieb. Die Umsiedlung der Ortslage Heuersdorf mit der 2007 über elf Kilometer Distanz nach Borna umgesetzten Emmauskirche wurde auch überregional wahrgenommen. Kernstücke der Landschaften nach der Kohle bilden die tagebauseen zwischen Leipzig und Halle (Saale). Die neue Seenlandschaft wird nach 2050 rund 175 Quadratkilometer Wasserfläche umfassen, die ein Gesamtvolumen von 3,8 Kubikkilometer beinhalten. Für die Region Mitteldeutschland verbinden sich damit beträchtliche Erwartungen hinsichtlich der Etablierung vielfältiger Nutzungsmöglichkeiten zwischen Freizeit und Erholung (Badestrände, Yachthäfen, Zeltplätze, Regattastrecken, tauchstützpunkte), neuen Naturrefugien (zum Beispiel Paupitzscher, Kahnsdorfer und Zechauer See) und Speicherwirtschaft (Hochwasserschutzfunktion Zwenkauer See). Geiseltalsee und Goitzsche wer- Der Hafen Zöbigker am Cospudener See 70 WORKSHOP 1
72 den unter den größten Seen Deutschlands die Positionen 16 und 32 einnehmen. Inzwischen sind bereits zahlreiche Beispiele für gestalterisch und nutzungsseitig attraktive neue Seen entstanden, die von Einheimischen und Gästen bestens angenommen werden. Der Cospudener See zieht heute über Besucher im Jahr an; insgesamt lässt sich das Besucherpotenzial der im Kontext zum Braunkohlenbergbau stehenden touristischen Anziehungspunkte auf circa zwei Millionen Gäste pro Jahr veranschlagen. In Zuge der Nutzungsartenfestlegungen für die Kippenareale erfuhren auch die Aspekte Natur und Landschaft sowie Waldmehrung umfassende Stärkungen. Großflächige Prozessschutzflächen und Landschaftsverbünde anstelle des früheren Naturschutzes nach dem Zufallsprinzip sind heute ebenso Bestandteil der Regionalplanung wie die Ausweisung von Aufforstungsflächen. Langfristig soll der Waldanteil im Raum südlich von Leipzig von sieben Prozent (1989) auf circa 20 Prozent gesteigert werden. Planerische Voraussetzungen wurden auch für die Etablierung von Freizeiteinrichtungen und den Abbau von Infrastrukturdefiziten geschaffen, wie der Vergnügungspark BELANtIS (Inbetriebnahme 2003, Gäste im Jahr) und die Autobahn A 38 (Inbetriebnahme 2006, damit Vollendung des Leipziger Autobahnrings) belegen. Das Schlüsselprojekt Gewässerverbund Region Leipzig mit der Zielrichtung, Stadt-, Auenwald- und Bergbaufolgelandschaften bootsgängig miteinander zu verbinden, erreichte 2011 mit der Inbetriebnahme der Kanupark und Bergbau-Technik-Park am Markkleeberger See zweiten von vier vorgesehenen Schleusen einen deutlichen Fortschritt. Auch im Zuge der Industriekultur konnten sichtbare Zeichen etwa mit dem Bergbautechnik-Park und dem Ausstellungspavillon am Kap Zwenkau gesetzt werden. Der Planungsverband übernimmt seit seiner Gründung auch Verantwortung für die Regionalentwicklung. So ist die Verbandsverwaltung in allen wichtigen Gremien zur Braunkohlesanierung mit Stimmrecht vertreten und übernimmt bei der Budgetierung von Landesmitteln für Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards im Gesamtumfang von circa 45 Millionen Euro seit 2005 die regionale Moderation. Darüber hinaus hat sich der Verband als Schlichtungsinstanz bei Kon- WORKSHOP 1 71
73 fliktfeldern sowie als qualifizierter wissenschaftlicher Begleiter und Impulsgeber zu Entwicklungen in den Bergbauräumen profiliert. So konnten nach dem Rutschungsereignis von Nachterstedt im Land Sachsen- Anhalt 2009 rasch Beiträge dazu geleistet werden, zugleich die aufkommenden Debatten zu versachlichen und berechtigten Besorgnissen nachzugehen. Auch die Erarbeitung gut angenommener Informationsangebote (Kartenwerk Realnutzung 1: mit Abschluss 2010, Seenkatalog Mitteldeutschland 2010) im Rahmen der Raumbeobachtung und Öffentlichkeitsarbeit zählt zu den Serviceleistungen des Planungsverbandes. Zwischenzeitlich konnte sich das Leipziger Neuseenland zu einer bekannten und gut nachgefragten touristischen Destination entwickeln. Neue Besucherattraktionen wie der Kanupark am Markkleeberger See, die schwimmende Kirchenkuppel Vineta im Störmthaler Landschaft nach Abschluss der Rekultivierung WORKSHOP 1
74 Neubaukraftwerk Lippendorf See oder das Highfield Musikfestival auf der Magdeborner Halbinsel werden auch überregional wahrgenommen. Zugleich treten bekannte und neuartige Problemfelder in Erscheinung, die maßgeblich zwischen Grundwasseranstieg, Wassergüteentwicklungen, Bewirtschaftungserfordernissen und Nachsorgeanforderungen liegen. Hierzu hat die Regionalplanung wiederholt Frühwarnfunktionen übernehmen können, um Risiken zu erkennen und diesen zu begegnen. Insofern werden die Arbeiten auf einer der weltweit größten Landschaftsbaustellen einerseits noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Andererseits sind die erreichten Fortschritte bei der Bewältigung der Erblasten bereits heute an vielen Stellen erlebbar und werden von Einheimischen und von Gästen in der Region Leipzig gleichermaßen geschätzt. WORKSHOP 1 73
75 PLENUMSDISKUSSION Moderation: Ulrich Kinder, Region Hannover Öffentlichkeitsarbeit und aktivierung durch Wettbewerbsprinzip Im Landschaftspark Region Stuttgart hat sich das Wettbewerbsprinzip als sehr erfolgreicher Ansatz herausgestellt. Der Wettbewerb hilft dabei, Kommunen anzusprechen und sie für eine Mitwirkung an Projekten zu gewinnen. Über das Wettbewerbsverfahren lassen sich einzelne Projekte breit kommunizieren, was zur Nachahmung anregt. Informationsveranstaltungen steigern den Bekanntheitsgrad. Der mögliche Effekt von Wettbewerben, Akteure zu demotivieren, die im Wettbewerb nicht erfolgreich sind, hat sich im Landschaftspark Region Stuttgart bisher nicht gezeigt: Kommunen, die ihr Projekt nicht erfolgreich durchbringen konnten, waren bislang sehr faire Verlierer. Ein Grund ist, dass die Kommunen ihre Projekte konzeptionell überarbeiten und im nächsten Jahr erneut einreichen können. Zahlreiche Projekte konnten aufgrund der Nachbearbeitung im Folgejahr realisiert werden. chancen für public private partnership von art der projekte abhängig Die Erfahrungen mit Public Private Partnership bei Projekten der Freiraumentwicklung und des Landschaftsschutzes sind unterschiedlich: Die in der wirtschaftsstarken Region Stuttgart ansässigen internationalen Firmen bevorzugen Investitionen in prestigeträchtige Projekte, die globale Ausstrahlung haben. Die Bereitschaft, in regionale Projekte oder den klassischen Landschaftsschutz vor Ort zu investieren, ist bei diesen Unternehmen eher gering. Kleinere ansässige Unternehmen konnten hingegen eher für derartige Projekte gewonnen werden und haben zum Beispiel bereits Renaturierungsmaßnahmen auf eigene Kosten durchgeführt. Frage ist, ob eine Festivalisierung bei Projekten der Freiraumentwicklung ein Ansatz sein kann, verstärkt Public Private Partnerships zu befördern. Mit Blick auf die touristische Infrastruktur stellt Silke Weidenbacher (Verband Region Stuttgart) fest, dass Kommunen langfristig meist nicht die geeignetsten träger seien. In Einzelfällen könnten kommunal getragene Projekte zwar gut funktionieren, aber grundsätzlich sollte man hier auf privatwirtschaftliche Investitionen setzen. Auch gewänne die Vermarktung regionaler Produkte im konzeptionellen Ansatz der Landschaftsparks immer mehr an Bedeutung: Gastronomen und Unternehmen seien in diesem Seg- 74 PLENUMSDISKUSSION
76 ment zunehmend aktiv und übernähmen so eine unterstützende Funktion. kommunikation von planung muss über unterschiedliche medien erfolgen Bei der Kommunikation von Planung und Projekten zeigen die Erfahrungen im Landschaftspark Region Stuttgart, dass alle Medien und Kommunikationswege genutzt werden müssen, um die Akteure zu erreichen. trotz der zahlreichen Aktivitäten sind weitere Maßnahmen nötig, um die Resonanz zu steigern, die gerade bei den Bürgerinnen und Bürgern bisher eher verhalten ist. Sowohl das Internet wie auch Printmedien, Kartenmaterial, die Kennzeichnung von Projekten vor Ort und Veranstaltungen können dazu dienen, den Bekanntheitsgrad der Vorhaben und der Planungsprozesse zu steigern. synergien zwischen naturschutz, naherholung und tourismus ermöglichen die bündelung von finanziellen mitteln In Landschaftsparks könnten touristische Entwicklung und Naturschutz im optimalen Fall gut verknüpft werden, ist sich Silke Weidenbacher sicher. Investitionen in grüne Infrastruktur führten zu Synergieeffekten, Kompensationsmaßnahmen werteten die Naturräume auf, wovon auch die Naherholung profitiere. Im Landschaftspark Region Stuttgart gibt es Beispiele für derartige Kombinationen, wobei der Verband allerdings nur das mitfinanziert, was über Pflichtaufgaben hinausgeht. Der Verband finanziert also nicht die Naturschutzmaßnahme selbst, aber zum Beispiel Projekte, die die Zugänglichkeit sicherstellen. sicherung von grünflächen als gemeinsame aufgabe Die Sicherung der Grünflächen im Landschaftspark Region Stuttgart erfolgt zum teil über Bauleitplanung, zum teil über Genehmigungsverfahren. Partiell erfolgt auch keine formale Sicherung. Der Landschaftspark ist hier darauf angewiesen, dass die Kommunen ein Interesse haben, die Flächen langfristig zu erhalten und dies selbst sicherstellen. Weltkulturerbe-titel als identitätsstiftende auszeichnung Die Bewerbung der Montanregion Erzgebirge um den Weltkulturerbe-titel hat bei den Akteuren vor Ort derzeit höchste Priorität. Die Region setzt alles auf eine PLENUMSDISKUSSION 75
77 Karte und hat derzeit keinen Alternativplan zu dieser Bewerbung. Mit dem titel sind viele Hoffnungen verknüpft: Er würde sowohl nach innen wie auch nach außen wirken, zur Identität wie zur Außenwahrnehmung der Region beitragen. trotz einer Kreisreform 2008 und der Zusammenlegung von vier Landkreisen zum Erzgebirgekreis ist das Gebiet noch von den einzelnen teilräumen geprägt. Der Weltkulturerbe-titel könne eine Klammer für die teilräume der Region darstellen und sie verbinden, so Dr. Jens Uhlig vom Planungsverband Region Chemnitz. Nach außen würde der titel vor allem positiv für den tourismus wirken: Die Erfahrungen aus anderen Weltkulturerbe-Regionen zeigen, welchen enormen Besucherzuwachs das Image des Labels auslösen kann. Insbesondere für ausländische touristen ist die Auszeichnung von Bedeutung. Gelingt es, den titel zu erlangen, ergeben sich daraus allerdings auch große Anforderungen für die Zukunft. Es gilt, die Qualität zu halten, um der Auszeichnung auch langfristig gerecht zu werden. gemeinsamkeiten der vorgestellten projekte Alle im Workshop präsentierten Beispiele dienen dazu, die Lebens- und Standortqualität zu erhöhen und die regionale Identität zu stärken. trotz der unterschiedlichen konzeptionellen Ansätze, der finanziellen Ausstattung und themenschwerpunkte zeigt sich an allen Beispielen, dass die regionale Vernetzung zu einem Mehrwert führt und dazu beitragen kann, personelle und finanzielle Ressourcen zu bündeln sowie externe Mittel einzuwerben. Die Moderation in derartigen Planungs- und Entwicklungsprozessen ist ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor. In allen vorgestellten Regionen spielen zudem Wasser, Industriekultur und Inszenierung eine wichtige Rolle. 76 PLENUMSDISKUSSION
78 Workshop 2: StEUERUNG DES GROSS- FLÄCHIGEN EINZELHANDELS
79 DIE BEWERtUNG VON GROSSf FLÄCHIGEN EINZELHANDELS- VORHABEN IM GROSSRAUM BRAUNSCHWEIG VOR DEM HINtERGRUND DES REGIONALEN EINZELHANDELSKONZEPtES Jens Palandt, Erster Verbandsrat, Zweckverband Großraum Braunschweig Mit dem Regionalen Einzelhandelsentwicklungskonzept 2010 für den Großraum Braunschweig wurde mit Hilfe der mit diesem Konzept verbundenen flächendeckenden Einzelhandelserhebungen aus den Jahren 2003 und 2008, den Leitlinien zur Einzelhandelsentwicklung und den aktualisierten Verfahrensregelungen zur Abstimmung raumbedeutsamer Einzelhandelsvorhaben die Möglichkeit geschaffen, die Veränderungen in der Einzelhandelslandschaft auch kleinräumig zu erkennen und auszuwerten. Die hierbei mögliche Zeitreihenbetrachtung ist angesichts der nach wie vor anhaltenden Dynamik des Einzelhandels unverzichtbar. Im Großraum Braunschweig wurden im Jahr 2008 insgesamt rund 1,97 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche erfasst (2003: 1,84 Millionen). Auf diesen Flächen konnte insgesamt ein Einzelhandelsumsatz von 6,56 Milliarden Euro erzielt werden (2003: 6,29 Milliarden Euro).
80 Obwohl die Einwohnerzahl von 2003 bis 2008 von 1,17 Millionen auf 1,15 Millionen leicht gesunken ist, kam es im Zuge dessen zu einer Umsatzsteigerung. Dies ist zum teil mit einem gestiegenen Ausgabebesatz im Einzelhandel zu erklären. Wie die Einzelhandelszentralität der Gesamtregion von 101,7 Prozent zeigt, konnte aber auch das Kaufkraftsaldo im Vergleich zu 2003 (99 Prozent) ins Positive gekehrt werden. Die nächste Nacherhebung ist für 2012/2013 geplant. Mit dem Datengerüst, den Zeitreihen und den aktuellen örtlichen Marktanalysen steht dem Zweckverband Großraum Braunschweig ein Planungsinstrumentarium zur Verfügung, das der Kommunalberatung und einer sach- und fachgerechten raumordnerischen Beurteilung von Einzelhandelsgroßprojekten dienlich ist. leitlinien zur einzelhandelsentwicklung im großraum braunschweig Das siedlungsstrukturelle Leitbild der dezentralen Konzentration des Regionalen Raumordnungsprogramms 2008 für den Großraum Braunschweig verfolgt die Absicht, die zentralen Standorte im Rahmen einer ausgeglichenen Einzelhandelsentwicklung zu sichern. Die übergemeindlich relevanten Einzelhandelsvorhaben sollen auf der Grundlage des Regionalen Einzelhandelsentwicklungskonzeptes vorrangig zur Stärkung der Innenstädte, der Versorgungsfunktion der Nahversorgungszentren und zur behutsamen Entwicklung des zentrenverträglichen großflächigen Einzelhandels an raumordnerisch geeigneten Standorten dienen und auf diese Weise regionsweit in den Grund-, Mittel- und Oberzentren zu ausgewogenen Versorgungsstrukturen führen. Es dient als Orientierungsrahmen zur Sicherstellung einer gegenseitig verträglichen und zukunftsfähigen Einzelhandelsentwicklung der Gemeinden im Großraum Braunschweig, die zum Ziel hat, nachhaltig funktionsfähige Versorgungsstrukturen zu erhalten, zu stärken und Versorgungsdefizite abzubauen. Das Regionale Einzelhandelsentwicklungskonzept ist letztlich Grundlage für die Abstimmung und Steuerung aller raumbedeutsamen Einzelhandelsvorhaben mit in der Regel mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, die im Sinne von 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung und 34 Absatz 3 Baugesetzbuch schädliche Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung oder die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche der betroffenen Gemeinden haben können, indem sie funktionsfähige Versorgungsstrukturen beeinträchtigen oder gefährden. Aus diesen generellen Absichten sind letztlich konkrete Leitlinien beziehungsweise Zielsetzungen zur Einzelhandelsentwicklung im Großraum Braunschweig wie der Abbau von Versorgungsdisparitäten, die Sicherung und Entwicklung der mittel- und oberzentralen Handelsfunktion oder die Sicherung der Zentrenfunktionen beziehungsweise der zentralen Versorgungsbereiche abgeleitet. verfahren zur abstimmung raumbedeutsamer einzelhandelsvorhaben Der Zweckverband Großraum Braunschweig führt die raumordnerische Beurteilung von Einzelhandelsvor- WORKSHOP 2 79
81 haben als untere Landesplanungsbehörde durch. Ist von einem Vorhaben eine überörtliche Wirkung zu erwarten, übernimmt der Zweckverband Großraum Braunschweig eine moderierende Rolle, wobei die Interessenlagen und Argumente der verschiedenen träger öffentlicher Belange im Rahmen der Abwägung berücksichtigt werden. Das hierbei praktizierte Verfahren fußt auf 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung und 21 des Niedersächsischen Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung in Verbindung mit den Zielsetzungen des Landes im Landesraumordnungsprogramm und den korrespondierenden, im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegten Zielen. Einzelhandelsgroßprojekte sind Einkaufzentren oder großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung nicht nur unwesentlich auswirken können. Derartige Auswirkungen sind in der Regel dann anzunehmen, wenn das Ansiedlungsvorhaben Quadratmeter Geschossfläche oder 800 Quadratmeter Verkaufsfläche überschreitet. Die nach 21 des Niedersächsischen Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung bestehende Mitteilungs- und Auskunftspflicht soll eine raumordnerische Überprüfung geplanter Einzelhandelsgroßprojekte inklusive der Erweiterung oder Umstrukturierung bereits vorhandener Projekte im Sinne der raumordnerischen Zielsetzungen des Landesraumordnungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsprogramms und eine möglichst frühzeitige Beratung ermöglichen. Im Großraum Braunschweig hat sich im Zuge dessen folgendes Verfahren zur Abstimmung der raumbedeutsamen Einzelhandelsvorhaben bewährt: Nach dem Bekanntwerden eines Vorhabens für den großflächigen Einzelhandel und noch vor gemeindlichen Aktivitäten für einen Aufstellungsbeschluss wird der Mitteilungsbogen für Einzelhandelsgroßprojekte durch die Gemeinde an den Zweckverband Großraum Braunschweig als untere Landesplanungsbehörde übermittelt. Zur Eröffnung des Abstimmungsverfahrens erhält Punkt 6 des Mitteilungsbogens (kalkulierter Einzugsbereich) eine wichtige Bedeutung. Um betroffene beziehungsweise zu beteiligende Gemeinden zu identifizieren, wird es in der Regel erforderlich, den kalkulierten Einzugsbereich beim Betreiber zu erfragen. Nach Plausibilitätsprüfung der Angaben kann die Beteiligung der betroffenen Gemeinden eröffnet werden. Bei der Bewertung von großflächigen Einzelhandelsprojekten wird für die Grundzentren und die Stadtteilzentren der Mittel- und Oberzentren eine Schwelle von 0,5 Quadratmetern Verkaufsfläche je Einwohner für den periodischen Bedarfsbereich zugrunde gelegt. Grundsätzlich gilt bis zum Erreichen der 0,5 Quadratmeter-Schwelle die Unschädlichkeitsvermutung. Die Planvorhaben können dann im vereinfachten Verfahren ohne Beteiligung der Nachbargemeinden raumordnerisch beurteilt werden. Weitere Ansiedlungen großflächiger Art bedürfen der Einzelfallbetrachtung. Im Einzelnen kommen darüber hinaus folgende Verfahrensabläufe für großflächige Einzelhandelsvor- 80 WORKSHOP 2
82 haben im periodischen Bedarf in Frage: Verfahren mit Beteiligung der Nachbargemeinden bei Überschreiten der Schwelle von 0,5 Quadratmeter ohne oder mit gutachterlichem Nachweis über die Raumverträglichkeit. Die Nachweispflicht obliegt dabei dem Unternehmer beziehungsweise der ansiedlungswilligen Gemeinde. raumordnungsverfahren Ein Raumordnungsverfahren ist erforderlich, wenn von der Größe oder der Angebotsstruktur des geplanten Einzelhandelsgroßprojektes erhebliche Auswirkungen auf Versorgungsstrukturen und Zentralitätsfunktionen im jeweiligen Einzugsbereich zu erwarten sind. Erhebliche Auswirkungen sind in der Regel dann anzunehmen, wenn städtebaulich nicht integrierte Einzelhandelsgroßprojekte wie Einkaufs- oder Fachmarktzentren geplant sind, die über eine Mindestverkaufsfläche von Quadratmeter verfügen. Bei Möbelmärkten liegt der Schwellenwert bei einer Mindestverkaufsfläche von Quadratmeter. Die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens ist in der Regel auch für Erweiterungen von mehr als 30 Prozent der bisherigen Verkaufsfläche erforderlich, wenn die vorhandenen Verkaufsflächen bereits oberhalb der vorgenannten Schwellenwerte liegen oder bei einer Erweiterung die Schwellenwerte überschritten werden. ausgeglichenen und die Nachbarinteressen in weitem Umfang berücksichtigenden Einzelhandelsentwicklung geführt haben. Festzustellen ist, dass einerseits überbordende Entwicklungen gedrosselt werden konnten, andererseits wurden Spielräume genutzt, um an der einen oder anderen Stelle Versorgungsdefizite, insbesondere auf der Ebene der Nahversorgung, auszugleichen. Die regionale Steuerung wird allerdings erst durch konsequente kommunale Einzelhandelsentwicklungskonzepte einschließlich der Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen und entsprechenden Sonderstandorten nachhaltig greifen können. Bei der geplanten Aktualisierung des Regionalen Einzelhandelsentwicklungskonzeptes werden die Herausforderungen des demographischen Wandels, der Internethandel und neue Konzepte mobiler Nahversorgung in sich ausdünnenden und alternden ländlichen Räumen verstärkt im Fokus stehen. Fazit und ausblick Wenn man die Entwicklungen der letzten Jahre im Großraum Braunschweig betrachtet, liegt der Schluss nahe, dass die Steuerungsansätze insgesamt zu einer WORKSHOP 2 81
83 regionalplanerische steuerung VON EINZEL- HANDELSStANDORtEN IN DER REGION StuttGARt Martin Wiemann, Verband Region Stuttgart Der Verband Region Stuttgart befasst sich bereits seit Mitte der 1990er Jahre intensiv mit dem Thema der raumordnerischen Steuerung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben und war 1998 zumindest in Baden-Württemberg der erste Regionalverband, der hierzu verbindliche und konkrete Standortvorgaben als Ziele der Raumordnung in den Regionalplan aufnahm. Auslöser war damals die enorme Nachfrage nach Einzelhandelsfläche überwiegend in nicht integrierten Standorten. Dem Planungskonzept zugrunde liegt dabei das Leitbild der Europäischen Stadt, deren Zentrum sich durch eine attraktive Nutzungsmischung aus Handel, Dienstleistung, Gastronomie, Kultur und Wohnen sowie die uneingeschränkte öffentliche Zugänglichkeit auszeichnet. Der Handel nimmt dabei eine wesentliche Leitfunktion als Magnet und Frequenzbringer ein. Diesem Leitbild wirkt der sich auch in der Region Stuttgart vollziehende Strukturwandel im Einzelhandel entgegen:
84 trotz rückläufiger, zumindest stagnierender Kaufkraft und Einzelhandelsumsätze hält das Verkaufsflächenwachstum an. Die Zahl der Einzelhandelsstandorte geht zurück, die Wege für die Verbraucher werden tendenziell weiter. Es erfolgt einer Verlagerung aus den Zentren an periphere Standorte. Folge ist ein zunehmender Funktions- und damit Attraktivitätsverlust der innerstädtischen Zentren, aber auch ein fortschreitender Verlust der Nahversorgung. Folge ist ebenfalls eine zunehmende Abhängigkeit von der Verfügbarkeit eines Individualverkehrsmittels und eine Zunahme des motorisierten Individualverkehrs mit entsprechenden Folgen für Umwelt und Klima. regionalplanerische strategie und gesetzliche vorgaben Wie versucht der Verband Region Stuttgart dieser Entwicklung regionalplanerisch entgegenzuwirken? Mit dem Ziel, regional einheitliche und transparente Entscheidungsgrundlagen zu schaffen und hierüber gleichzeitig eine überörtliche Abstimmung zu gewährleisten, definiert der Regionalplan konkrete Planungs- und Standortvorgaben für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmeter (Einzelhandelsgroßprojekte). Dieser Schwellenwert ist im Regionalplan definiert und erfolgt bewusst nicht unter Hinweis auf 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung, die als bauplanungsrechtliche Vorgabe keine für die Raumordnung unmittelbar relevante Rechtsgrundlage darstellt, sondern im Gegenteil ihrerseits auf von den trägern der Raumordnung eigenständig festzulegende Ziele verweist. Die Baunutzungsverordnung beinhaltet zudem einen ausschließlich vorhabensbezogenen Bezug, der einer raumordnerischen, vorhabensübergreifenden, wirkungsbezogenen Betrachtung nicht entspricht. Rechtliche Grundlage für die regionalplanerischen Festlegungen ist neben dem Raumordnungsgesetz ( 2 Absatz 2 Nummer 3) insbesondere das Landesplanungsgesetz, das unter anderem vorschreibt, dass in den Regionalplänen insbesondere Standorte für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe festzulegen sind. kriterien zur beurteilung von einzelhandelsgroßprojekten Grundlegende raumordnerische Vorgabe ist zunächst: Einzelhandelsgroßprojekte sind nur in zentralen Orten ab der Stufe Unterzentrum zulässig (Konzentrationsgebot), zentrenrelevante Sortimente dürfen nur in städtebaulich integrierten Lagen angeboten werden (Integrationsgebot), die Verkaufsfläche beziehungsweise die daraus resultierende Umsatzerwartung ist auf die Kaufkraft im Einzugsbereich des jeweiligen zentralen Ortes abzustimmen (Kongruenzgebot) und benachbarte Kommunen dürfen durch Umsatzverlagerungen nicht beeinträchtigt werden (Beeinträchtigungsverbot). Für das Kongruenzgebot und das Beeinträchtigungsverbot sind im Einzelhandelserlass für Baden-Württemberg konkrete Schwellenwerte definiert, die bei der Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben zugrunde gelegt werden. WORKSHOP 2 83
85 konkrete standortsteuerung von einzelhandelsgroßprojekten im regionalplan Im Regionalplan für die Region Stuttgart sind für alle zentralen Orte ab der Stufe Unterzentrum in Abstimmung mit den Kommunen Gebiete für Einzelhandelsgroßprojekte in der Raumnutzungskarte des Regionalplans festgelegt worden. Diese Gebiete stellen gewissermaßen die aus raumordnerischer Sicht integrierten Standortbereiche dar. Ausschließlich in diesen Gebieten sind Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten zulässig. Diese Gebiete sind gebietsscharf, also nicht parzellenscharf festgelegt und es besteht (auch maßstabsbedingt) ein Ausformungsspielraum an den Rändern. Außerhalb dieser als Ziel der Raumordnung verbindlich festgelegten Gebiete kommen zunächst nur Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten in Frage (zum Beispiel Möbelhäuser, Bau- und Gartenmärkte). Voraussetzung ist hierbei, dass gleichzeitig zentrenrelevante Randsortimente deutlich begrenzt werden: Der Regionalplan Gebiet für zentralrelevante Einzelhandelsgroßprojekte > Gebietsscharf > verbindliches Ziel Gebiet für nicht zentralrelevante Einzelhandelsgroßprojekte > Symbolisch > Grundsatz Darstellung von Gebieten für zentrenrelevante und für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte ( Ergänzungsstandorte ) im Regionalplan für die Region Stuttgart (Ausschnitt Raumnutzungskarte, Regionalplan 2009) 84 WORKSHOP 2
86 setzt hier betriebsbezogen eine Obergrenze von drei Prozent der Verkaufsfläche und höchsten 350 Quadratmetern fest, um so sicherzustellen, dass nicht indirekt innenstadtrelevante Sortimente an periphere Standorte verlagert werden. Für entsprechende Vorhaben aus regionalplanerischer Sicht geeignete Standortbereiche sind in der Raumnutzungskarte als sogenannte Ergänzungsstandorte symbolisch dargestellt. sicherung der grundversorgung Ausgenommen von der verbindlichen Zuordnung zu den im Regionalplan festgelegten Gebieten, aber auch von der Zuordnung zu zentralen Orten sind großflächige Einzelhandelsbetriebe der Grundversorgung (Lebensmittel, Getränke, Drogeriewaren und anderes). Voraussetzung dafür ist: Es werden nur Sortimente der Grundversorgung angeboten, der Verkaufsflächenumfang ist auf die örtliche Kaufkraft abgestimmt und die Grundversorgung benachbarter Gemeinden wird nicht beeinträchtigt. Hintergrund dieser Ausnahmeregelung des Regionalplans ist die Zielsetzung, eine wohnortnahe Grundversorgung in möglichst allen Gemeinden sicherzustellen. raumordnerische definition von einzelhandelsagglomerationen Eine besondere Problematik stellen aktuell Einzelhandels-Agglomerationen dar, die in der Summe der Gesamtverkaufsfläche und hinsichtlich ihrer (raumordnerischen) Auswirkungen einem Einkaufszentrums entsprechen können, bei denen die jeweiligen Einzelvorhaben aufgrund der baurechtlich jeweils für sich zu betrachtenden Verkaufsfläche von raumordnerischen Vorgaben unter Umständen nicht erfasst werden. In der Region Stuttgart konnte so zum Beispiel in einem Gewerbegebiet sukzessive eine Ansammlung von insgesamt elf Fachmärkten mit einer Verkaufsfläche von insgesamt rund Quadratmetern entstehen, ohne dass die von diesem Einkaufszentrum ausgehenden raumordnerischen Wirkungen geprüft wurden oder raumordnerische Vorgaben zu beachten waren. Hinzu kommt, dass eine solche oft ungeplante Entwicklung im Rahmen der Bauleitplanung meist nicht konkret in die Abwägung einbezogen und nicht mit Nachbarkommunen abgestimmt wird. Um solche Entwicklungen zukünftig unter raumordnerischen Kriterien prüfen zu können, wurde in den Regionalplan eine Regelung aufgenommen, dass unmittelbar benachbarte Einzelhandelsbetriebe gemeinsam zu betrachten sind. Hierüber wird erreicht, dass bei in der Summe der Verkaufsfläche großflächigen Einzelhandelsagglomerationen regionalplanerische Vorgaben ebenfalls zu berücksichtigen und damit bei der Ausweisung von Gewerbegebieten auch mögliche Einzelhandelsnutzungen in die Abwägung mit raumordnerischen Belangen einzubeziehen sind. Der Regionalplan beinhaltet damit ein umfassendes Instrumentarium, Einzelhandelsstandorte in der Region Stuttgart raumordnerisch bewerten und wirksam steuern zu können. WORKSHOP 2 85
87 Das REGIONALE EINZEL- HANDELSKONZEPt FÜR DEN BALLUNGSRAUM FRANKFURtRHEINMAIN Matthias Drexelius, Erster Beigeordneter Regionalverband Frankfurt- RheinMain Das engere Verbandsgebiet des Regionalverbandes Frankfurt- RheinMain umfasst 75 Städte und Gemeinden mit 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Zentrale Aufgabe ist die regionale Flächennutzungsplanung; der regionale Flächennutzungsplan ist seit dem 17. Oktober 2011 rechtskräftig. Der Verband vernetzt darüber hinaus die Metropolregion FrankfurtRheinMain mit 5,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Themengebieten wie Kultur, Wirtschaft, Regionalentwicklung und Europa.
88 aufstellungsverfahren des regionalen einzelhandelskonzepts Im Rahmen dieser Aufgaben hat sich der Verband auch mit der Entwicklung eines Regionalen Einzelhandelskonzeptes befasst. Ausgangspunkt für die Überlegungen im Jahre 2004 ein solches Konzept gutachterlich zu erstellen, war die tatsache, dass die verstärkt wahrnehmbaren Ansiedlungen auf der grünen Wiese den Verantwortlichen deutlich machten, dass man nicht länger nur zuschauen könne, was der Markt macht. Es war allen Beteiligten klar, sollte man nicht steuernd eingreifen, dass die Innenstädte und Zentren massiv gefährdet wären. Dies hätte ein Aussterben und die Verödung der Innenstädte zur Folge gehabt. Insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der tatsache, dass gerade für die älteren Menschen die Notwendigkeit einer wohnortnahen Versorgung bestehen muss, war ein unverzügliches Handeln geboten. Dabei wurden als maßgebliche Ziele eines solchen Konzeptes niedergelegt, dass die zentralen Versorgungsbereiche in Innenstädten und Zentren erhalten, die wohnungsnahe Grundversorgung der Bevölkerung sicher gestellt werden und Planungssicherheit für Kommunen und Standortentscheidungen entstehen sollte. Mit diesem Auftrag begann die gutachterliche Untersuchung mit der Analyse des Einzelhandelsbestandes und der Zentrenstrukturen um hier nur zwei Punkte beispielhaft zu nennen, da in der Kürze der gesamte Prozess nicht vollständig darstellbar ist. Im Rahmen dieser Bestandserhebung wurden für jeden Ort die Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels ab 250 Quadratmeter und die Betriebe des Facheinzelhandels ab 500 Quadratmeter Verkaufsfläche vollständig erfasst. Wesentlich war daneben auch die Zustandsanalyse der jeweiligen Zentrenstruktur der Städte und Gemeinden des Verbandsgebietes. Dabei wurde im Rahmen der Abgrenzung und Klassifizierung zwischen sogenannten A-, B-, C- und D-Zentren unterschieden. Ebenso wurde im Rahmen dieser Untersuchung ein Fokus auf Einzelhandelsagglomerationen sowie neue Zentren gelegt. Für die Frage der Einstufung in die jeweilige Zentrenkategorie war bedeutend, welches Angebot (beispielsweise Geschäftsausstattung, Branchenmix, Betriebsstruktur), welche städtebauliche Situation (beispielsweise Innenstadtgestaltung, Zustand öffentlicher Raum), wie die verkehrliche Anbindung (beispielsweise Fußgängerfrequenzen, Erreichbarkeit Öffentlicher Personennahverkehr, Individualverkehr) und welche sonstigen ergänzenden infrastrukturellen Einrichtungen vor Ort gegeben waren. Aus diesen Analysen wurden dann die Vorgaben für die zukünftige Steuerung des Einzelhandels gemacht. Als Eckpunkte waren dabei von Bedeutung, dass Vorhaben mit zentrenrelevanten Sortimenten in Versorgungskerne und zentrale Versorgungsbereiche gelenkt werden sollten. Weiter sollten außerhalb dieser zen- WORKSHOP 2 87
89 tralen Bereiche sogenannte Ergänzungsstandorte mit Angeboten ausgewiesen werden, die keine Zentrenrelevanz hatten. Die Abgrenzung erfolgt über eine Sortimentsliste. Weiterer Eckpunkt war die Sicherung der Nahversorgung in integrierten Lagen. Dabei wurde die Annahme der Raumverträglichkeit bei Lebensmittelvollversorgern bis Quadratmetern Verkaufsfläche oder bei Discountern bis Quadratmetern Verkaufsfläche unterstellt. Wesentlich war auch, dass keine Ausweitung der Angebotsplanung erfolgen sollte und auch kein weiteres Wachstum in den Einzelhandelsagglomerationen zugelassen werden sollten. Durch die Integration des Regionalen Einzelhandelskonzeptes in den Regionalen Flächennutzungsplan sowie den Regionalplan Südhessen einschließlich einer einheitlichen Sortimentsliste, sollten einheitliche Spielregeln für alle Kommunen begründet werden. Seit dem Jahr 2008 wird das Konzept als städtebauliches Entwicklungskonzept und zwischenzeitlich als Bestandteil des Regionalen Flächennutzungsplans im Rahmen der Prüfung von neuen Vorhaben regelmäßig angewandt. Dies wird durch ein Prüfungsschema sichergestellt, das ordnungsgemäß angewendet, die Zulässigkeit von Vorhaben sehr einfach und systematisch erschließt. Fazit Betrachtet man die ersten zwei Jahre der Anwendung des Konzeptes, so lässt sich zunächst feststellen, dass im Rahmen von Entscheidungsprozessen dieses Sys- tem durchaus funktioniert. Gleichzeitig muss aber auch konstatiert werden, dass es immer wieder zu erheblichen Problemfällen und Härten kommt, die im Rahmen einer pauschalen Regelung nicht immer vermieden werden können. So sei hier beispielsweise die Besonderheit der Region FrankfurtRheinMain genannt, in der es eine sehr hohe Dichte zentraler Orte gibt. Gleichzeitig liegen oft in unmittelbarer Nachbarschaft zum teil direkt ineinander übergehend nicht zentrale Orte. Dies führt naturgemäß zu Unverständnis und Diskussionen, wenn großflächige Vorhaben ein paar Meter weiter zugelassen werden könnten, nicht jedoch in der kleineren Kommune. Ebenso zeigt sich in einer dynamischen Region, bei attraktiven Angeboten von Investoren, dass das ortsbezogene Denken immer wieder durchschlägt, weil man die Vorteile der Entwicklung für die eigene Kommune sieht. Dies ist nachvollziehbar, erhöht jedoch die Schwierigkeiten der Umsetzung des Konzeptes. Wie schon zuvor ausgeführt, stellt das Gutachten fest, welche Bestands- und Verkaufsflächensituation gegeben ist und was für die Region noch verträglich sei. Ein Ansatz, der dann funktioniert, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem untersuchten Plangebiet keine weiteren Standorte entstehen, was in der Region jedoch nicht durchgehalten werden kann. So sind Städte wie Mainz und Wiesbaden (nicht im Pla- 88 WORKSHOP 2
90 nungsgebiet) in kürzester Zeit zu erreichen und großflächige Einzelhandelsentwicklungen dort beeinflussen naturgemäß sowohl das nähere und als auch weitere Rhein-Main-Gebiet. Dadurch entstehen automatisch Unwuchten im Rahmen der Feststellung und Steuerungswirkungen, die nicht ohne weiteres gelöst werden können. So kann zum Schluss festgehalten werden, dass das Regionale Einzelhandelskonzept des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain sowohl als Entwicklungskonzept wie als Bestandteil des Regionalen Flächennutzungsplanes und Regionalplanes Südhessen grundsätzlich geeignet ist, eine entsprechende Steuerung vorzunehmen. Gleichzeitig wird es aber sicher notwendig sein, im Rahmen der Evaluierung Anpassungen im Rahmen der erkannten Problempunkte vorzunehmen. Ob und mit welchem Erfolg dies gelingen wird, wird die Zukunft weisen. WORKSHOP 2 89
91 erfahrungen MIt DER VERBINDLICHEN StEUERUNG DES GROSSFLÄCHIGEN EINZELHANDELS IN DER REGION HANNOVER Susanne Borchert, Region Hannover Die Region Hannover erhebt den Anspruch, eine Region mit hoher Lebensqualität zu sein, wobei eine vielfältige und attraktive Einzelhandelsstruktur nicht unerheblich zu dieser Lebensqualität beiträgt. Zum Selbstverständnis der Regionalplanung in der Region Hannover gehört es, diese vorhandene Lebensqualität mit den Instrumenten der Regionalplanung zu verbessern und dabei auch innovative Wege einzuschlagen. Nach mehrjährigen Vorarbeiten und intensiver Abstimmung mit den regionalen Akteuren ist es der Region Hannover vor zehn Jahren gelungen, auf der Ebene der regionalen Raumordnung verbindliche Ziele und Grundsätze zur räumlichen Steuerung des großflächigen Einzelhandels zu verankern. Im November 2001, kurz nach der Gründung der Region Hannover, wurde nach einem förmlichen Änderungsverfahren der Beschluss gefasst, das Regionale Einzelhandelskonzept in den Regionalplan, der in Niedersachsen Regionales Raumordnungsprogramm heißt, zu integrieren.
92 Bei der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005 wurde das regionale Einzelhandelskonzept inhaltlich weiterentwickelt und vollständig in die beschreibende (text) und zeichnerische Darstellung (Karte) des Regionalen Raumordnungsprogramms integriert. Im Folgenden wird ein Überblick über die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Motivationen gegeben, die zu dieser regionalpolitischen Entscheidung beigetragen haben. Da es an diesem tag auch um einen Erfahrungsaustausch geht, werden die wichtigsten Regelungen vorgestellt und auf die Stärken und Schwächen des Konzeptes eingegangen. Die Region Hannover arbeitet bereits an einer Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes. Auch hierauf wird kurz einzugehen sein. these 1: Wichtigste Grundvoraussetzung für die verbindliche Einzelhandelssteuerung in der Region Hannover ist ein gemeinsames Zielgerüst der kommunalen Akteure! Der regionale Ansatz zur verbindlichen Steuerung des großflächigen Einzelhandels konnte nur eingeführt und umgesetzt werden, weil es gelungen ist unter den regionalen Akteuren, also den 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover sowie der Industrieund Handelskammer und dem Einzelhandelsverband Hannover, einen breiten Konsens herzustellen. Folgende Erwartungen und Zielsetzungen waren dabei besonders wichtig: Erhalt attraktiver Innenstädte und leistungsfähiger Zentren Sicherung des Einzelhandels als teil der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen Erhalt und Schaffung einer zukunftsfähigen Nahversorgung auch unter den Bedingungen des demografischen Wandels Bessere Verzahnung von regionaler und kommunaler Ebene Verlässliche Rahmensetzung durch Planung Schaffung von Planungssicherheit durch rechtssichere Festlegungen these 2: Der regionalplanerische Steuerungsanspruch gegenüber dem großflächigen Einzelhandel unterliegt einem Wandel von relativ passiven Einzelfallentscheidungen zu aktiverer Steuerung! Die negativen Effekte und Langzeitwirkungen der Herausbildung eines sekundären Standortnetzes an autogerechten, peripheren Standorten an Stadt- oder Ortsrändern, das zur Erosion der Nahversorgungsstrukturen WORKSHOP 2 91
93 beigetragen hat, sind zunehmend planungspolitisch wahrgenommen worden. Insbesondere der dynamische und beschleunigte Strukturwandel im Einzelhandel mit wachsenden Flächenansprüchen und veränderten Standortanforderungen führte zu interkommunalen Konflikten und Disparitäten, die auf der Ebene der Einzelkommune nicht mehr zu bewältigen waren. Die Lösung wurde in einer stärker koordinierenden und ausgleichenden Steuerung des großflächigen Einzelhandels auf regionaler Ebene gesehen. Im Rückblick lässt sich der regionalplanerische Paradigmenwechsel wie folgt skizzieren: Standortentscheidungen lagen weitgehend auf der kommunalen Ebene. In der zweiten Hälfte Ende der 1990er Jahre kam es zu einer Verschärfung der Konflikte durch Ansiedlungsdruck von Fachmärkten sowie Expansion der Discounter ab Damit einhergehend wurde eine aktivere Aufgabenwahrnehmung und Koordination durch die Region Hannover als träger der Regionalplanung gefordert. Bis in die 1990er Jahre war die Rahmensetzung durch allgemeine raumordnerische Zulässigkeitsvoraussetzungen weit gefasst. Bezüglich einer aktiveren und verbindlicheren Steuerung bestand seitens der Kommunen ein breiter Konsens. Ernst-August-Galerie Langenhagen, Blick in CCL 92 WORKSHOP 2
94 Hannover Sudelstraße / Revitalisierung eines Straßenbahndepots Es entstand ein gemeinsam getragener Anspruch, die eigene Steuerungs- und Verhandlungskapazitäten gegenüber den Einzelhandelsakteuren verbessern zu müssen. these 3: In der Region Hannover basiert die verbindliche Steuerung des großflächigen Einzelhandels auf Kooperation und Kommunikation, deshalb wurden auch neue Wege beim Planungsprozess beschritten! Der Diskussionsund Planungsprozess wurde von Anfang an von einer für diesen Zweck gegründeten regionalen Arbeitsgruppe Einzelhandel mit Planungsdezernentinnen und Planungsdezernenten und leitenden kommunalen Planerinnen und Planern unter Federführung der Regionalplanung vorbereitet und getragen. Als Pilotprojekt wurde eine vertiefende Einzelhandels- und Zentrenkonzeption für einen regionalen teilraum der Region Hannover (sogenanntes Nordraum-Gutachten ) im Rahmen einer gemeinsamen Finanzierung durch die betroffenen Kommunen und den Kommunalverband Großraum Hannover (träger der Regionalplanung bis zur Regionsgründung) an eine externe Gutachtergruppe vergeben. Die auf Basis von umfangreichen Bestandserhebungen gewonnen Erkenntnisse über den großflächigen Einzelhandelsbesatz und die Standortstruktur weckte das Interesse an einer regionsweiten Begutachtung. In einem zweiten Schritt wurde deshalb die Erarbeitung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für die Region Hannover in Angriff genommen. Hierzu wurde wiederum ein gemeinschaftlich finanziertes Gutachten vergeben und die einzelnen Bearbeitungsschritte und Ergebnisse in der regionalen Arbeitsgruppe vorgestellt und intensiv diskutiert. Dieses im Mai 2000 abgeschlossene Gutachten und die in der regionalen Arbeitsgruppe erarbeiteten konzeptionellen Vorarbeiten waren unverzichtbare Bausteine auf dem Weg zu einer verbindlichen Steuerung des großflächigen Einzelhandels. Zusammengefasst waren folgende Aspekte von Bedeutung: Etablierung einer regionalen Arbeitsgruppe Einzelhandel mit Planungsdezernentinnen und Planungsdezernente und leitenden kommunalen Planerinnen und Planern Schaffung von regionsweiten Planungsgrundlagen und Daten durch externe Gutachterinnen und Gutachter zur Versachlichung WORKSHOP 2 93
95 Integration kommunaler Erfahrungen aus Städtebau, Bauleitplanung und Wirtschaftsförderung Vertiefung einer auf Respekt und Vertrauen basierenden Planungskultur Darüber hinaus wurden gemeinsame Spielregeln verabredet und explizit die Möglichkeit beziehungsweise der Anspruch verankert, Moderationsverfahren in Konfliktfällen und bei größeren Vorhaben vorzusehen beziehungsweise zu beantragen. Welche neuen Festlegungen wurden eingeführt? Ein höherer Grad an Verbindlichkeit im Vergleich zu den bisherigen einzelhandelsrelevanten Grundsätzen und Zielen der Raumordnung wurde dadurch erreicht, dass eine räumliche Differenzierung ausgehend vom Zentrale-Orte-System vorgenommen wurde. Folgende Festlegungen wurden in der zeichnerischen Darstellung (Karte) des Regionalen Raumordnungsprogramms und in Beikarten aufgenommen und durch weitere textliche Ziele und Grundsätze ausgefüllt und präzisiert: Räumlich konkrete Festlegung von Versorgungskernen Zentralörtliche Standortbereiche differenziert nach Ober-, Mittel- und Grundzentrum Festlegung von regional bedeutsamen Fachmarkt- und Solitärstandorten Festlegung von herausgehobenen Nahversorgungsstandorten mit Verkaufsflächen-Obergrenzen Aufgrund nicht vorhersehbarer Ansiedlungswünsche und Standortanforderungen erfolgte in vier Fällen auf kommunalen Antrag hin eine Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms. Die Grundzüge der Planung wurden dadurch in keinem Fall berührt. Außerdem wurde ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt, um ein Nahversorgungszentrum in der Stadt Hannover zu ermöglichen. Welche bilanz kann nach zehn Jahren praxis gezogen werden? Seit Oktober 2001 gibt es zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels in der Region Hannover ein verbindliches regionales Einzelhandelskonzept, das mit geringen Ergänzungen in das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 integriert wurde. Mit der Einführung dieses Instrumentes wurde die Erwartung verknüpft, dass auf dieser Grundlage sowohl mehr Planungsals auch mehr Rechtssicherheit geschaffen werden können. Die Steuerung des großflächigen Einzelhandels stellt in mehrfacher Hinsicht eine Gratwanderung dar. Es geht um eine Rahmensetzung, die durch kommunale Konzepte ausgefüllt und durch eine verantwortungsvolle Bauleitplanung in ihrer Zielsetzung umgesetzt werden muss. Darüber hinaus kann es zu 94 WORKSHOP 2
96 Interessenkonflikten zwischen den Zielen der Regionalplanung beziehungsweise Stadtentwicklung und den Zielen und Anforderungen der Wirtschaftsförderung kommen. Dies ist in der Region Hannover nicht anders als in anderen Stadtregionen. Die Rahmenbedingungen für die Konfliktbearbeitung stellen sich aber vergleichsweise günstig dar. Der in der Region Hannover entwickelte Ansatz der verbindlichen Steuerung des großflächigen Einzelhandels hat sich grundsätzlich bewährt! In der Praxis haben sich allerdings einige Anwendungsprobleme ergeben, die nur kurz gestreift werden können: Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe wirft Fragen auf. Es gibt Schwierigkeiten mit dem Kongruenzgebot, da bisher keine Verflechtungsbereiche für die zentralen Orte festgelegt wurden. Wie geht es angesichts gestiegener rechtlicher anforderungen weiter? Damit diese Konzeption auch weiterhin ihre positive Wirkung entfalten kann und Akzeptanz findet, ist eine regelmäßige Überprüfung erforderlich. In Ansätzen ist dies im Rahmen des Gutachtens Aktualisierung des regionalen Einzelhandelskonzeptes für die Region Hannover in den Jahren 2006/2007 geleistet worden. Allerdings standen dort die Datenanalyse sowie die Erarbeitung von Beurteilungskriterien und allgemeine kommunale Empfehlungen im Vordergrund. In einem weiteren Schritt soll es nunmehr stärker um rechtliche Fragen gehen. In der Praxis hat sich in der Region Hannover gezeigt, dass bei der Beurteilung konkreter Einzelhandelsvorhaben und der gerichtsfesten Durchsetzung der Festsetzungen des regionalen Einzelhandelskonzeptes Schwierigkeiten auftreten können. Die folgenden themenkomplexe stehen daher bei der aktuellen Fortschreibung (11. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005) im Vordergrund: Anpassung an das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 Rechtssichere Handhabung des Kongruenzgebotes Steuerung von Einzelhandelsagglomerationen außerhalb der Zentren und Ortskerne Abgrenzung der städtebaulich integrierten von den nicht städtebaulich integrierten Standorten Im Rahmen einer rechtlichen Überprüfung werden zurzeit die einzelhandelsrelevanten Festlegungen überarbeitet und untersucht, ob sie den rechtlichen Anforderungen genügen und den landesseitigen Vorgaben entsprechen. Ein entsprechender Änderungsentwurf ist für Frühjahr 2012 terminiert. WORKSHOP 2 95
97 PLENUMSDISKUSSION Moderation: Susanne Krebser, Kommunalverbund Niedersachsen Bremen e.v. veränderungen in der steuerung des großflächigen einzelhandels Die vorgestellten Projekte zeigen, dass sich die Steuerung des großflächigen Einzelhandels unter planungsrechtlichen Gesichtspunkten für die träger der Regionalplanung im Vergleich zu Ende der 1990er Jahre vereinfacht hat, da sich die Instrumente, insbesondere die des Landesplanungsrechts, verbessert haben. Beispielsweise hat der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen, ein freiwilliger Zusammenschluss mehrerer träger der Regionalplanung, zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels einen konzeptionellen Ansatz gewählt, der mittels eines raumordnerischen Vertrags abgesichert wird. Betrachtet man jedoch die konkreten Entwicklungszahlen des Einzelhandels, differenziert sich die Sichtweise. Martin Drexelius (Erster Beigeordneter des Regionalverbands FrankfurtRheinMain) berichtet, dass vor zehn bis 15 Jahren die Auswirkungen einer Ansiedlung des großflächigen Einzelhandels andere, nämlich viel kleinräumigere Dimensionen gehabt hätten. Heutzutage ergebe sich hingegen folgende Problematik: Beispielweise wurde in Mainz eine Verkaufsfläche von Quadratmetern eröffnet, die nicht im Planungsbereich des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain liegt, aber enorme Auswirkungen auf die Region FrankfurtRhein- Main hat. Um auch Einfluss auf die Einzelhandelsentwicklung außerhalb der planungsrechtlichen Zuständigkeit nehmen zu können, ist der Verband deshalb darauf angewiesen, im Vorfeld intensive Gespräche zu führen und auf Moderationsverfahren zu setzen. Dies ist auch als Instrument verbindlich im Regionalen Einzelhandelskonzept und im Regionalen Flächennutzungsplan geregelt. regionales einzelhandelskonzept im einklang mit der bauleitplanung Der Zweckverband Großraum Braunschweig ist träger der Regionalplanung und untere Landesplanungsbehörde. Er verfügt somit über die Möglichkeit, am Bauleitverfahren mitzuwirken, so dass keine Widersprüche zum Regionalen Raumordnungsprogramm entstehen. Das Regionale Einzelhandelskonzept als persuasives Instrument dient als Basis für die raumordnerischen Beurteilungen. Anders in Baden-Württemberg: Der Verband Region Stuttgart ist nicht die höhere Verwal- 96 PLENUMSDISKUSSION
98 tungsbehörde für die Flächennutzungsplanung. Dies hat in Einzelfällen zur Folge, dass der Verband bei der Steuerung des Einzelhandels nicht immer im gewünschten Maße auf die Bauleitplanung einwirken kann. besonderheiten bei der steuerung des großflächigen einzelhandels in freiwilligen kooperationsräumen Auf großes Interesse stößt auch die Frage, welche Wege die regionalen Kooperationen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels einschlagen, die nicht träger der Regionalplanung sind und somit über keine rechtlichen Instrumente verfügen: Die StädteRegion Aachen hat in Abstimmung mit der Bezirksregierung, die für die Regionalplanung zuständig ist, das städteregionale Einzelhandelskonzept StRIKt aufgestellt. Im Konzept sind unter anderem Innenbereiche und Vorgaben bezüglich der Grund- und Nahversorgung festgelegt. Die StädteRegion Aachen hat damit folgenden Anreiz geschaffen: Halten sich die Kommunen an das Konzept, ziehen alle Beteiligten an einem Strang und eine schnelle Umsetzung kann erfolgen. Des Weiteren hat jede Kommune thematische Schwerpunkte im Bereich von Gewerbe (zum Beispiel Möbelhandel). Bei einer Neuansiedlung in dem festgelegten Schwerpunkt geben die Nachbarkommunen und die Bezirksregierung als Regionalplanungsträger eine positive Stellungnahme ab. Ein weiteres Beispiel ist eine freiwillige länderübergreifende Kooperation einiger Kommunen: Unterhalb der Regionalplanungsebene haben sich zwei Hamburger Bezirke und acht Kommunen aus Schleswig-Holstein zusammengeschlossen, um sich im Rahmen eines Kurzprüfungsverfahrens oder eines internetbasierten Verfahrens über Einzelhandelsvorhaben von über 800 Quadratmetern abzustimmen. Ergibt sich dadurch keine Lösung, werden Fachgutachterinnen und -gutachter hinzugezogen, die eine Kurzprüfung für das Vorhaben vornehmen. Nur im Konfliktfall wird ein Moderationsverfahren initiiert, an dem bei Bedarf auch die Regionalplanung beteiligt ist. Innerhalb von sechs Jahren hat sich auf diese Weise eine gute Kommunikationskultur entwickelt, so dass regions- und städtebauverträgliche Lösungen erzielt werden konnten. motivation kleiner gemeinden zur entwicklung integrierter nahversorgungsstandorte Für die Bewertung von großflächigen Einzelhandelsprojekten legt der Zweckverband Großraum Braunschweig einen Schwellenwert von 0,5 Quadratmeter je Einwohner zugrunde. Dieser Durchschnittswert bezieht sich auf den periodischen Bedarf. Einige Mittelzentren und teilweise auch Grundzentren liegen über diesem Wert. Jens Palandt vom Zweckverband Großraum Braunschweig berichtet, dass vor allem kleinere Gemeinden, die deutlich unter diesem Wert lägen und somit ein großes Nahversorgungsdefizit hätten, motiviert werden konnten, integrierte Nahversorgungsstandorte zu PLENUMSDISKUSSION 97
99 entwickeln. Dabei hätten die Kommunen festgestellt, dass ein solcher Standort unkomplizierter mit der Regionalplanung abzustimmen sei als ohne Regionales Einzelhandelskonzept. Eine Wirkung des Regionalen Einzelhandelskonzepts sei somit auch die Verbesserung der (Nah-)Versorgung in der Region. erfahrungen mit regionalen und örtlichen sortimentslisten von einzelhandelskonzepten In der Diskussion zeigt sich, dass die Erfahrungen bei der Festlegung von Sortimentslisten unterschiedlich sind: In der Region Stuttgart unterscheidet sich zwar zum teil die Sortimentsliste des Regionalen Einzelhandelskonzepts von denen in örtlichen Einzelhandelskonzepten. Aber die Abweichungen sind marginal und es hat bisher nicht das Problem gegeben, dass die Kommunen völlig andere Listen hatten. In der Region FrankfurtRheinMain wird zum Beispiel häufig der Elektrobedarf in den kommunalen Sortimentslisten anders als in der regionalen Sortimentsliste eingestuft: Die Kommunen argumentieren, Elektrobedarf würde niemand mehr in der Innenstadt, sondern in den Einkaufszentren auf der grünen Wiese kaufen. sünden der vergangenheit umgang mit nicht integrierten einzelhandelsstandorten Das Regionale Einzelhandelskonzept FrankfurtRhein- Main und die Steuerung von Einzelhandelsstandorten in der Region Stuttgart zeigen, dass auch existierende, jedoch von der Lage her nicht integrierte Standorte bei den Einzelhandelskonzepten berücksichtigt werden können, indem sie als Bestand erfasst und bewertet werden. Sowohl in der Region FrankfurtRheinMain als auch in der Region Stuttgart sind sie zwar als Bestand gesichert, können jedoch nicht weiterentwickelt werden. In der Region FrankfurtRheinMain sind diese Standorte darüber hinaus für den Rückbau vorgesehen: Wenn sie aufgegeben werden sollten, können sie nicht für den großflächigen Einzelhandel nachgenutzt werden. gemeinsamkeiten und schlussfolgerungen der vorgestellten projekte Die Impulsvorträge haben vier verschiedene Ansätze der Steuerung des großflächigen Einzelhandels dargestellt. Allen gemein ist es, dass der erste Schritt die sorgfältige Analyse von Zahlen, Daten und Fakten ist. Auch wurde bei allen Projekten zur Entwicklung eines Standortkonzepts die Bedeutung der Zentralität von Orten geklärt und eine Unterscheidung von Sortimenten vorgenommen. Weiterhin ist festzustellen, dass sich die Rahmenbedingungen in den vergangenen 15 Jahren stark verändert haben. Die erfolgreichen Pilotprojekte aus den ersten Jahren haben viele Regionen unter Berücksichtigung der neuen rechtlichen Instrumente aufgegriffen und für sich weiterentwickelt. 98 PLENUMSDISKUSSION
100 Workshop 3: KLIMASCHUtZ UND ERNEUERBARE ENERGIEN
101 DER BEItRAG INFORMELLER INStRUMENte ZUM KLIMA- SCHUtz WAS KANN DIE REGIONALPLANUNG LEIStEN? Am BEISPIEL DER REGION SÜDLICHER OBERRHEIN Dr. Dieter Karlin, Verbandsdirektor, Regionalverband Südlicher Oberrhein Die Region Südlicher Oberrhein ist die geographische Mitte der Trinationalen Metropolregion Oberrhein. In den 126 Städten und Gemeinden der Region mit einer Gesamtfläche von Quadratkilometer leben insgesamt 1,051 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein ist gesetzlicher Träger der Regional- und Landschaftsrahmenplanung und nimmt darüber hinaus regionale Entwicklungsaufgaben wahr. Als Körperschaft des öffentlichen Rechtes mit politischen Gremien versteht er sich als Regionaler Plan- und Impulsgeber und als Sprachrohr der Region gegenüber Europäischer Union, Bund und Land bei großen Infrastrukturmaßnahmen.
102 Weshalb engagieren wir uns pro klimaschutz? Die Region gilt aufgrund ihrer bioklimatischen Bewertung als Wärmeinsel in Zentraleuropa. Deshalb werden folgende absehbare Folgen des Klimawandels das Oberrheingebiet in besonderem Maße treffen und bedürfen deshalb in der räumlichen Planung besonderer Berücksichtigung: Erhöhung der Hochwassergefahr durch steigende Hochwasserabflüsse, vor allem im Winterhalbjahr Abnahme der Sommerwasserführung vieler Fließgewässer, Zunahme der Gewässertemperaturen Erhöhte Grundwasserneubildung im Winterhalbjahr, steigende trockengefahr für Land- und Forstwirtschaft im Sommerhalbjahr Welche instrumente setzen wir ein? Seit 2003 verfolgen wir eine Doppelstrategie: ursachenbezogen die klimaschädlichen Emissionen reduzieren und folgenbezogen die Siedlungsstrukturen den unabwendbaren Klimafolgen anpassen. abbildung 1: doppelstrategie zum klimaschutz Als Instrumente nutzen wir ordnungsrechtlich die Möglichkeiten des Regionalplans sowie informell regionale Entwicklungskonzepte, regionale Netzwerke sowie ein regionales Energie- und CO ² -Monitoring. Aus dem Bündel an Aktivitäten werden hier drei Projekte skizziert. Klimaschutz Verschlechterung der Wintersportmöglichkeiten, Verbesserung der Voraussetzungen für den Sommertourismus im Schwarzwald Ursachenbezogen: Folgebezogen: Erhöhte Gesundheitsgefahren für den Menschen durch steigende sommerliche Hitzebelastung im Oberrheingraben 2-fache Doppelstrategie Räumliche Planung Planerische Sicherheit Vorbeugender Hochwasserschutz regenerativer Energienutzung Planerische Sicherung thermisch/ Emissionsarme und energieeffiziente Raumstruktur lufthygienisch wichtiger Freiräume (REKLISO) Doppelstrategie zum Klimaschutz WORKSHOP 3 101
103 Ausgleichsfunktionen sowie zum Abbau klimatischer und hygienischer Belastungen in den Siedlungsgebieten auf. Die Ergebnisse der regionalen Klimaanalyse liefern in erster Linie Grundlagen für die Fortschreibung des Landschaftsrahmen- sowie Regionalplanes Südlicher Oberrhein. Darüber hinaus dienen sie für die Bauleit- und Siedlungsplanung der Kommunen als Leitlinie. Energieatlas und Klimaschutzstrategie regionale klimaanalyse rekliso Vor dem Hintergrund des Hitzesommers 2003 und den auch künftig steigenden sommerlichen Hitzebelastungen im Oberrheingraben haben wir gemeinsam mit der Universität Basel sowie der technischen Universität Berlin bis zum Jahr 2006 pilothaft für unsere Region flächendeckende Grundlagen für die Berücksichtigung klimatischer Belange in der räumlichen Planung erarbeitet. So wird in der regionalen Klimaanalyse REKLI- SO beispielsweise aufgezeigt, welche Freiraumbereiche zwischen Schwarzwald und Rhein für den ungehinderten Frisch- und Kaltlufttransport in die Siedlungsbereiche hinein besonders wichtig sind. Eine Vielzahl von fachlichen Empfehlungen zeigen konkrete Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung klimatischer regionales entwicklungskonzept zur nutzung regenerativer energien und zur reduktion der co ² -emissionen 2003 verpflichtete der Landtag von Baden-Württemberg die Regionalverbände, die Windenergienutzung planerisch zu steuern. Die Förderung anderer regenerativer Energien sowie spezifische Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs bleiben dabei unberücksichtigt. Vor diesem Hintergrund hat die Regionalversammlung im Juli 2004 einstimmig beschlossen, diesen gesetzlichen Planungsauftrag um Aussagen zu allen erneuerbaren Energiequellen zu ergänzen. Aus der Analyse der CO ² - und Energiebilanz sowie verschiedener Energie- und Klimaschutzszenarien wurden eine Umsetzungsstrategie sowie detaillierte Handlungsanweisungen für die verschiedenen Handlungsebenen und die verschiedenen Handlungsfelder entwickelt. Wichtiges Element des Energieatlas war von Anfang an die Identifizierung der Marktpotenziale in der Region. 102 WORKSHOP 3
104 Wesentliches Ziel war dabei, auch den Anteil regionaler Wertschöpfung an den Energiekosten der Region deutlich zu erhöhen. Zentraler Baustein für die regionale Umsetzungsstrategie war die Bildung eines regionalen Netzwerkes Strategische Partnerschaft aus circa 100 Kommunen sowie mehr als 50 Unternehmen und Verbände aus der Wirtschaft. Auf der Basis des Energieatlas und der Klimaschutzstrategie hat die Regionalversammlung im März 2007 einstimmig beschlossen: Reduktion des Pro-Kopf-Energieverbrauches um 20 Prozent bis 2020 Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf 20 Prozent bis 2020 regionales co ² -monitoringsystem Zur Prüfung der Zielerreichung und einer eventuellen Zielneudefinition wurde bereits im Jahr 2008 ein regionales CO ² -Monitoringsystem entwickelt. schlussfolgerungen für die raumordnung Pläne machen reicht nicht! Raumordnung muss Plan- und Impulsgeber für die Regionalplanung sein. Sie muss sich in den politischen Diskurs einmischen. Energieverbrauch GWh/a Energiekosten der Region: 1,5 Mrd. Euro regionale Wertschöpfung? CO2-Emission 9,3 Mio. t/a Substitutions-/ Einsparpotenzial GWh/a Wärmeschutz (3.970) Kraftwärmekopplung (2.130) Heizkesselerneuerung (750) Biomasse (3.120) übrige EE (1.780) Einsparpotenzial 3,9 Mio. t/a -42% Substitution durch den Ausbau EE GWh/a Stromeinsparung Energie- und CO ² -Bilanz sowie Substitutions-/Einsparpotenziale in der Region WORKSHOP 3 103
105 Die Formulierung klimapolitischer Ziele auf regionaler Ebene ist zur Steigerung der Energieeffizienz und zur konsequenten Nutzung der Potenziale regenerativer Energien unerlässlich, weil die Klimaschutzziele überwiegend auf der lokalen Handlungsebene verortet sind. - zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Institutionen (Netzwerke), - zur Abstimmung raumbedeutsamer Maßnahmen und - zur Effizienz klimaschützerischer tätigkeiten. Unter den Vorzeichen des Klimawandels wird es auch auf eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung und -gestaltung ankommen, die global wirkende Veränderungen wichtiger Klimaparameter örtlich noch nicht weiter verschärft. Regionale Handlungsstrategien (= Entwicklungskonzepte ) tragen bei - zur Stärkung der teilräumlichen Entwicklung, Sie erhöhen dabei deutlich das Bewusstsein für einen klimaschonenden Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und die regionale Wertschöpfung. Die notwendige Netzwerkbildung aller für die Umsetzung der klimapolitischen Ziele relevanten Akteure in den Regionen ist auf informeller Ebene deutlich besser zu erreichen als über formelle Instrumente. Wärmeschutz in gebäuden Heizkesselerneuerung Kraft-Wärme-Kopplung Realisierung des wirtschaftlichen Einsparpotenzials (1% des Gebäudebestandes pro Jahr) Austausch von ca Kesseln (3.700 Anlagen pro Jahr) Aufbau von 425 MWel KWK-Anlagen (ca Anlagen pro Jahr) kumulierte investition (mio. ) volumina p.a. (mio. ) 104 WORKSHOP 3 Regenerative Energie Realisierung des Verdopplungs-Ziels des Landes bis 2010 summe Darstellung der Marktpotenziale im Energieatlas (Stand 12/2004)
106 co ² -einspar-potenziale region südlicher oberrhein ziel 20 -szenario bisher erfasste co ² -reduktion grad der datenerfassung Handlungsfelder (t/a) (t/a) (%) Wärmeschutz % mittel Heizkesselerneuerung % gut KWK/BHKW % mittel Wasserkraft % gut Windkraft % gut Photovoltaik % gut Biomasse % gut Geothermie % mittel Solarthermie % gut Stromeinsparung ,3% schlecht gesamt % Regionales CO ² -Monitoringsystem (Stand 08/2001) Ein fortlaufendes Monitoring ist unerlässlich, um den Erreichungsgrad der formulierten klimapolitischen Ziele zu ermitteln, weitere Handlungserfordernisse zu erkennen und gegebenenfalls eine realistische Anpassung der Ziele vornehmen zu können. Alle Projekte sind abrufbar unter WORKSHOP 3 105
107 WINDKRAFtKONZEPtION INDUStRIEREGION MittEL- FRANKEN DIE StEUERUNG DER ERRICHtUNG VON WINDKRAFtANLAGEN AUF REGIONALER EBENE Thomas Müller, Regionsbeauftragter für die Industrieregion Mittelfranken Was bringt die Region der Region? auf die im Titel der Fachtagung aufgeworfene Fragestellung lässt sich am Beispiel der Windkraftnutzung recht anschaulich eingehen. Die optischen Auswirkungen von Windkraftanlagen der heutigen Generation sind allein aufgrund der Anlagengröße in den seltensten Fällen rein auf ein einzelnes Gemeindegebiet begrenzt. Schon deshalb erscheint eine regionale Betrachtungsweise sinnvoll, um vor dem Hintergrund einheitlicher und nachvollziehbarer Kriterien einem gesamträumlichen Regelungsbedarf nachzukommen. Windkraftanlagen zählen zu den privilegierten Vorhaben im Außenbereich (gemäß 35 Baugesetzbuch). Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass grundsätzlich überall dort eine Windkraftanlage errichtet werden kann, wo keine öffentlichen Belange entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung gesichert ist.
108 Dies hat in der Vergangenheit in einigen Regionen dazu geführt, dass Windkraftanlagen sehr unkoordiniert geplant und letztlich auch errichtet wurden. In der Bevölkerung wurde in diesen Fällen der Begriff einer Verspargelung der Landschaft geprägt. erarbeitung und Fortschreibung des Windkraftkonzepts Ziel des Planungsverbandes Industrieregion Mittelfranken war und ist es, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, indem Windkraftanlagen in hierfür geeigneten Bereichen konzentriert werden. Bereiche außerhalb dieser Gebiete sollen hingegen konsequent von Windkraftanlagen freigehalten werden. Dazu gehören unter anderem Bereiche in unmittelbarer Siedlungsnähe, sensible Landschaftsräume sowie Bereiche, die für Naturschutz oder Erholung von großer Bedeutung sind. Die Möglichkeit für eine regionalplanerische Steuerung wird durch das Landesentwicklungsprogramm Bayern geschaffen, wonach die regionalen Planungsverbände in den Regionalplänen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraftanlagen festlegen können (siehe Landesentwicklungsprogramm Bayern B V 3.2.3). Die Industrieregion Mittelfranken verfügt seit dem 1. Januar 2006 über eine rechtsverbindliche Windkraftkonzeption, die zwischenzeitlich bereits in teilbereichen fortgeschrieben wurde. Windkraftanlagen sind seither ausschließlich in den ausgewiesenen Vorrangbeziehungsweise Vorbehaltsgebieten Windkraft entstanden. Windkraftanlagen wurden in den letzten Jahren technologisch rasant weiterentwickelt. Das führte dazu, dass heute auch in Mittelfranken deutlich mehr Standorte für die Erzeugung von Windenergie in Frage kommen. Hier sei exemplarisch auf die Standorteignung innerhalb von Waldflächen hingewiesen. Noch vor wenigen Jahren schieden Waldflächen für eine sinnvolle Windkraftnutzung weitgehend aus, da die in vielen teilen Mittelfrankens ohnehin begrenzte Windausbeute durch die Bremswirkung des Baumbestandes und die damit einhergehenden Verwirbelungen zusätzlich deutlich gemindert wurde. Mit den gewachsenen Anlagenhöhen heute sind Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe (Mast inklusive Rotor) von circa 180 Metern Standard spielt die Bodenbedeckung und damit die Frage, ob es sich um einen Waldstandort oder einen Standort auf einer Wiesen- oder Ackerfläche handelt, für den Betrieb nahezu keine Rolle mehr. Dementsprechend werden auch Waldstandorte verstärkt nachgefragt und müssen bei einer planerischen Aufbereitung des themas sachgerecht berücksichtigt werden. Derartige Entwicklungen, aber selbstverständlich auch die Ereignisse des Jahres 2011 um das japanische Atomkraftwerk Fukushima und die nachfolgend in der Bundesrepublik Deutschland eingeläutete Energiewende sind die wesentlichen Gründe für die aktuell im Verfahren befindliche Fortschreibung der regionalplanerischen Windkraftkonzeption. Diese verfolgt zum einen das Ziel, erneuerbare Energien verstärkt zu fördern, zum anderen aber auch eine dauerhafte WORKSHOP 3 107
109 Ziele der Raumordnung Zeichnerisch verbindliche Darstellung Vorranggebiet für Windkraftanlagen Vorbehaltsgebiet für Windkraftanlagen Nachrichtliche Wiedergabe Regionsgrenze bestehende Windkraftanlage Ausschnitt aus dem rechtsverbindlichen Regionalplan der Industrieregion Mittelfranken (RP 7) Bereich Landkreis Fürth 108 Workshop 3
110 Rechtssicherheit für Städte und Gemeinde sowie Investoren zu gewährleisten. Ausgangspunkt für das Ausfiltern geeigneter Gebiete zur späteren Ausweisung als Vorrang- beziehungsweise Vorbehaltsgebiete Windkraft stellt zunächst das Anlegen fachlicher Ausschlusskriterien dar. Hierzu zählen beispielsweise Abstände zu Siedlungseinheiten sowie zu Verkehrs- oder Richtfunktrassen. Ebenso stellen zum Beispiel naturschutzfachliche Restriktionsflächen, wie Naturschutz- oder Vogelschutzgebiete, Ausschlussbereiche für eine Windkraftnutzung dar. Die dabei verbleibenden Flächen werden nachfolgend einem umfangreichen Abwägungsprozess, bei dem unter anderem auch der Aspekt der Windhöffigkeit (Messgröße für die vorherrschende Windgeschwindigkeit) oder die Möglichkeiten, den potenziell erzeugten Strom ortsnah ins Stromnetz einzuspeisen, einfließen. Nicht zuletzt werden die ermittelten Flächen auch mit dem jeweiligen kommunalen Datenbestand abgeglichen, um bestehende Vorhaben und Planungen der Städte und Gemeinden vor dem Hintergrund des Gegenstromprinzips sachgerecht in den Abwägungsprozess mit einbeziehen zu können. Gerade bei einem derart emotional besetzten thema wie der Errichtung von Windkraftanlagen nimmt neben der inhaltlichen Arbeit auch die Information von Stadt- oder Gemeinderäten, Medienvertretern sowie der Öffentlichkeit einen immer wichtigeren Stellenwert der regionalplanerischen Arbeit ein. Letztlich wird der Fortschreibungsentwurf in ein förmliches Beteiligungsverfahren eingebracht, in dem sich Städte und Gemeinden, die relevanten Fachbehörden und Verbände, die angrenzenden Nachbarregionen, aber auch die Öffentlichkeit (und damit auch Privatpersonen) zu den Planungen äußern können. All das soll in seiner Gesamtheit dazu beitragen, dass die Windkraftnutzung im bestmöglichen Einklang mit anderen schützenswerten Interessen und in einer abgestimmten regionalen Konzeption erfolgt. Über den Verfahrensgang der Regionalplanfortschreibung sowie die jeweiligen Gebietsvorschläge kann sich jedermann auf der Website des Planungsverbandes ( informieren. Fazit und ausblick Eines haben die Beteiligungsverfahren zur Erstkonzeption sowie zu vorangegangenen teilfortschreibungen der regionalplanerischen Windkraftkonzeption bereits gezeigt: Auch wenn naturgemäß je nach Interessenlage der Beteiligten durchaus unterschiedliche Bewertungen zu einzelnen Gebieten gegeben sind, besteht ein breiter Konsens darin, dass sich die Steuerung der Errichtung von Windkraftanlagen auf der Ebene der Regionalplanung bewährt hat und auch für die Zukunft sinnvoll und notwendig ist. WORKSHOP 3 109
111 KLIMASCHUtz IN DER REGIONALPLANUNG Michael Bongartz, Regionalverband Ruhr (RVR) Zunehmende Extremereignisse (Starkregen, Stürme, Hitzeperioden) sind deutlich wahrnehmbare Indizien globaler Klimaveränderungen. Mit dem zunehmenden Einsatz fossiler Energieträger wie Kohle, Erdgas und Erdöl in Verbrennungsprozessen der Industrie und des Verkehrs stieg auch der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO ² ), aus der medialen Diskussion auch als Treibhausgas bekannt. Vermehrt auftretende Hochwasser, niederschlagsarme Sommer mit deutlichen Auswirkungen auf die Ernteerträge oder stark überhitze Innenstädte sind nur einige, aber in ihrer Wirkung folgenschwere Erscheinungen des Klimawandels. Eine Strategie, mit den Auswirkungen umzugehen, ist die Reaktion hierauf. Im Fokus stehen Maßnahmen zur Reduzierung der negativen Auswirkungen des Klimawandels. Die Maßnahmen haben allesamt das Ziel, die Folgewirkungen abzumindern. Die eigentliche Behebung der Ursachen steht dabei nicht im Mittelpunkt der Handlungsausrichtung.
112 klimaschutz Die eigentliche Ursachenbehebung wird unter der Strategie des Klimaschutzes diskutiert. Unter dem Begriff Klimaschutz werden diejenigen Maßnahmen zusammengefasst, die dazu beitragen sollen, der globalen Erwärmung entgegenzuwirken beziehungsweise diese abzumindern. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich im Kyoto-Protokoll eine Selbstverpflichtung aufgegeben, deren Erreichung eine Reduzierung des Primärenergieverbrauchs sowie die Substitution von fossilen Energieträgern durch CO ² -ärmere erfordert. Mit gleichem Ziel bereitet die nordrhein-westfälische Landesregierung ein Klimaschutzgesetz vor. Die Gesamtsumme der treibhausgasemissionen soll in Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent und bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 verringert werden. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, werden der Steigerung des Ressourcenschutzes, der Ressourcen- und der Energieeffizienz, der Energieeinsparung und dem Ausbau erneuerbarer Energien Vorrang eingeräumt. bedeutung des klimaschutzes anpassung an den klimawandel in der regionalplanung Im Rahmen der Diskussion über die Umsetzung der Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel stellt sich die Frage, welchen Beitrag die Regionalplanung dazu liefern kann. Aufgabe der Regionalplanung ist die raumverträgliche Verteilung und Zuordnung unterschiedlicher, zum teil sich wechselseitig beeinträchtigender Raumnutzungen. Sie hat geeignete Standorte (Bereiche) für vorgesehene Nutzungen vor dem Zugriff durch entgegenstehende oder die vorgesehen Nutzung erschwerende Nutzungen zu sichern (Sicherungsauftrag). Gleichermaßen hat sie den Auftrag, die Nutzungen räumlich so zuzuordnen, dass negative Auswirkungen verhindert oder weit möglichst reduziert werden (Steuerungsauftrag). Kurzum: Regionalplanung sichert und steuert die Raumnutzungsstruktur mit dem Ziel der bestmöglichen Allokation der Raumnutzungsinteressen, Sicherung der natürlichen Ressourcen und einer nachhaltigen Entwicklung. Diese setzt zum einen voraus, dass ein konkreter Raumanspruch besteht, zum anderen, dass dieser Raumanspruch zugleich raumrelevant ist. Raumrelevanz kann, gemäß Planverordnung zum Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen, in aller Regel bei Nutzungen mit einer Größe von circa zehn Hektar unterstellt werden. Insofern müssen diese beiden Grundannahmen erfüllt sein, dass eine Nutzung für die Regionalplanung von Relevanz ist. Die Ansprüche des Klimaschutzes und Anpassung an den Klimawandel sind daher von regionalplanerischer Bedeutung, wenn sie eine räumliche Dimension aufweisen. entwicklung der bedeutung des klimaschutzes anpassung an den klimawandel in der regionalplanung Der Stellenwert des Klimaschutzes und die Anpassung an den Klimawandel in der Regionalplanung hat sich WORKSHOP 3 111
113 im Laufe der Zeit deutlich verändert. Chronologisch und inhaltlich lassen sich vier Phasen des Bedeutungswandels ausmachen: 1. phase: expansion Im Fokus der Regionalplanung steht die Sicherung von Fläche für die wachsenden Ansprüche von Wirtschaft, Wohnen und Verkehr. Die quantitative Veränderung wird zum Synonym für den Wohlstand, der Klimaschutzaspekt spielt noch keine oder nur eine rudimentäre Rolle. 2. phase: einführung der umwelt(verträglichkeits)prüfung Durch die Einführung der Umwelt(verträglichkeits)- prüfung werden die Auswirkungen auf das Klima zum materiellen Prüfgegenstand der räumlichen Planung und damit mittelbar in die Überlegung der räumlichen Disposition der Flächennutzung einbezogen. Klimabelange werden zwar in der Umwelt(verträglichkeits) prüfung abgehandelt, spielen aber in der konkreten Raumnutzungsdisposition nur eine untergeordnete Rolle (gegebenenfalls Berücksichtigung der Hauptwindrichtung). Hieraus abgeleitete Anforderungen der Klimabelange finden sich nur selten in konkreten Raumnutzungsmustern wieder. 3. phase: zunahmen von hochwasserereignisse Die dichter werdende Abfolge von Hochwasserkatastrophen zu Beginn der 1990er Jahre stellt neue Herausforderungen auch an die Planung. Anstatt auf eintretende Schäden nur zu reagieren, sollen durch Präventivmaßnahmen die Auswirkungen der Hochwasser begrenzt werden. In diesem Kontext erfährt der bestehende planerische Auftrag der Sicherung von Auen eine neue Dimension. Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat beschlossen, dass die Regionalplanung fortan Sorge dafür zu tragen hat, dass Auen und Retentionsräume vor einer weiteren baulichen Inanspruchnahme geschützt werden. Zudem sollen Deiche rückverlegt und Flächen, die für die Herstellung von Retentionsflächen benötigt werden, gesichert werden. Damit wird das Aufgabenspektrum der Regionalplanung um die Facette der Anpassung an den Klimawandel erweitert, die Sicherung und Entwicklung von Überschwemmungsbereichen zum Bestandteil von Plänen. 4. phase: strategie der co ² -reduktion Die Anpassung an den Klimawandel so zeigen die Erfahrungen reicht allein nicht aus. Das Kurieren der Symptome allein bringt keine Veränderungen. Diese sind nur durch die Behebung der Ursachen der Klimaveränderung herbeizuführen. Damit rückt die Strategie der Reduzierung der klimaschädlichen CO ² -Emmissionen in den Vordergrund der Handlungsausrichtungen. Die Energiezeugung mittels fossiler Energieträger soll sukzessive durch den Einsatz erneuerbarer Energien substituiert werden. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung, Erprobung und Einsatz erneuerbarer Energien. Erneuerbare Energien entwickeln Raumansprüche und lösen zugleich auch Raumnutzungskonflikte aus. 112 WORKSHOP 3
114 Die Aufgabe für die Regionalplanung besteht darin, geeignete Standorte zu finden beziehungsweise zu sichern und zu erwartende Nutzungskonflikte durch räumliche Steuerung ihrer Standorte zu lösen. Flächendeckende Erhebung von Luftaustauschbeziehungen (Belüftungsbahnen, Kaltluftabflüsse, Luftleitbahnen) zwischen belasteten Räumen und Ausgleichsflächen. vorbereitung der neuaufstellung des regionalplans ruhr Nach der Übernahme der Planungskompetenz für das Ruhrgebiet hat der Regionalverband Ruhr vier Regionalpläne der bis dahin zuständigen Bezirksregierungen für die planerische Beurteilung heranzuziehen. Hinzu kommt ein regionaler Flächennutzungsplan einer Planungsgemeinschaft von sechs Städten im Kernruhrgebiet. Die Verbandsversammlung der Regionalverbandes Ruhr hat in der Funktion als Regionalrat beschlossen, einen einheitlichen, flächendeckenden Regionalplan für das Ruhrgebiet aufzustellen. Bei der inhaltlichen Ausrichtung wird die Anpassung an den Klimawandel sowie die Belange des Klimaschutzes eine wichtige Rolle spielen. Als Grundlagen hierfür werden zurzeit erarbeitet: Verbandsweite Erhebung der klimatischen Situation Abgrenzung übermäßig erwärmter Bereiche und Interpretation der Auswirkungen auf die dort lebenden Bewohnerinnen und Bewohner anpassung an den klimawandel im regionalplan ruhr Im Rahmen der Anpassung an den Klimawandel ist geplant, im zukünftigen Regionalplan Ruhr Überschwemmungsbereiche darzustellen, mit denen bestehende Retentionsfläche, aber auch neu zu entwickelnde oder für die Deichrückverlegung geeignete Flächen, planerisch vor einem Zugriff durch andere Nutzungen gesichert werden sollen. In einigen bestehenden Regionalplänen der Bezirksregierungen finden sich hierzu schon textliche Ziele oder zeichnerische Festlegungen. Durch die Festlegung von klimaökologisch bedeutsamen Räumen (zum Beispiel großflächige Kaltluftentstehungsgebiete oder Frischluftleitbahnen) sollen klimaökologische Ausgleichsräume planerisch gesichert werden. Zu einem sollen diese Räume vor dem Zugriff durch Nutzungen gesichert werden, die deren Funktion beeinträchtigen könnte. Zum anderen sollen aber auch über textliche Ziele Direktiven für die Bauleitplanung aufgenommen werden (zum Beispiel Ausrichtung der Baukörper zur Minderung ihrer Barrierewirkung innerhalb von Kaltluftleitbahnen). Flächendeckende Erhebung klimaökologischer Last- und Ausgleichsräume und Beurteilung ihrer regionalen Wertigkeit WORKSHOP 3 113
115 klimaschutz im regionalplan ruhr Im Hinblick auf die Flächenansprüche des Klimaschutzes wird es im Regionalplan Ruhr insbesondere um die Standortsicherung und die Steuerung von Vorhaben zur Erzeugung erneuerbarer Energien gehen. Aktuell werden dabei folgende Vorhaben diskutiert beziehungsweise realisiert: Windenergieanlagen Großflächige Photovoltaik Nicht privilegierte Biogasanlagen Pumpspeicherkraftwerke Windenergieanlagen Windenergieanlagen sind gemäß Windenergieerlass der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in der Regel ab einer Nabenhöhe von 100 Metern raumrelevant. Damit sind sie für die Regionalplanung bedeutsam. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der ausgewählte Standort im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit den Zielen der Regionalplanung übereinstimmt. Darüber hinaus sieht der Entwurf des in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplans 2025 vor, künftig in Regionalplänen Vorranggebiete ohne Eignungswirkung festzulegen. Damit sollen geeignete Standorte vor dem Zugriff durch andere Nutzungen gesichert werden. Eine Steuerungsfunktion wird nicht beabsichtigt. Die Kommunen haben damit die Möglichkeit, auf der Ebene der Flächennutzungsplanung Konzentrationen für Windkraft festzulegen und diese mit entsprechender Ausschlusswirkung zu versehen. Gemäß dieser landesplanerischen Vorgabe sollen im Regionalplan Ruhr entsprechende Vorranggebiete für die Windenergienutzung ausgewiesen werden. Zurzeit werden die Potenziale der Windenergienutzung beziehungsweise geeignete Vorranggebiete gutachterlich sondiert. großflächige photovoltaik Flächen für Photovoltaikanlagen sind im Regionalplan darzustellen, wenn sie eine Größe von mehr als zehn Hektar aufweisen. Es ist geplant, im Regionalplan Ruhr geeignete Standorte zu finden und diese zeichnerisch festzulegen. Um Nutzungskonflikten mit der Landwirtschaft vorzubeugen, sollen diese Anlagen auf bereits baulich vorgeprägten Standorten (Industriebrachflächen, ehemalige Bergbauflächen, Eisenbahnbrachen, ehemalige Militärstandorte) realisiert werden. Zudem sollen textliche Ziele für die nachfolgende Bauleitplanung aufgenommen werden, um die raumverträgliche Einbindung von Anlagen unter zehn Hektar sicherzustellen. nicht privilegierte biogasanlagen Bei Biogasanlagen handelt es sich, soweit sie die Voraussetzungen des 35 Absatz 1 Nummer 6 Baugesetzbuch erfüllen, um privilegierte Anlagen. Sobald sie diese Anforderungen überschreiten, wird ein Planerfordernis ausgelöst, der Standort wäre 114 WORKSHOP 3
116 im Außenbereich bauleitplanerisch zu sichern. Zur Steuerung dieser Fälle sollen im Regionalplan Ruhr textliche Ziele definiert werden, die die räumliche Einbindung solcher Anlagen regeln. Es wird angestrebt, diese Anlage möglichst in räumlicher Nähe zu bereits im Regionalplan festgelegten Gewerbe- und Industriestandorten oder zu im Flächennutzugsplan dargestellten gewerblichen Bau- oder Industrieflächen zu lenken. Da die Anlagengröße in den bislang bekannten Fällen deutlich unterhalb von zehn Hektar liegt, erscheint eine zeichnerische Festlegung im Regionalplan entbehrlich. pumpspeicherkraftwerke Im Rahmen des vermehrten Einsatzes erneuerbarer Energien wird auch die Möglichkeit der Errichtung von Pumpspeicherkraftwerken diskutiert, wobei die für den Höhenausgleich des Wassers notwendige Energie mittels Windkraft erzeugt werden soll. Es wird angedacht, diese Anlagen auf den Halden des Bergbaus zu positionieren, um den damit geschaffenen Höhenunterschied energetisch zu nutzen. Während die Anlagengröße regionalplanerisch kaum bedeutsam sein dürfte, könnte die Ausbildung der Speicherbecken (auf den Halden) gegebenenfalls ein Darstellungserfordernis auslösen, sofern diese eine Größe von zehn Hektar überschreiten. Ein räumliches Steuerungserfordernis wird hierbei nur bedingt gesehen, da die Standorte bereits durch die Haldenstandorte vorgegeben sind. Allenfalls wäre in Abhängigkeit von ihrer landschaftlichen Einbindung oder dem Entwicklungszustand der Rekultivierungsbepflanzung zwischen geeigneten und weniger geeigneten Halden abzuwägen. stadt der kurzen Wege Auch der Verkehr trägt nicht unerheblich zum entstehen klimaschädlicher CO ² -Emmissionen bei. Planerisches Ziel ist es daher, unnötige Raumüberwindung zu vermeiden, um damit die Verkehrsmenge zu reduzieren. Planerisches Leitbild ist die Stadt der kurzen Wege, bei der entgegen der Funktionsentflechtung der Charta von Athen unterschiedliche Nutzungen möglichst räumlich einander zuzuordnen sind, um lange Wege zwischen den Nutzungen zu vermeiden. Da Städte und Gemeinde bereits weitgehend festgefügte Nutzungsmuster sind, kann die Anwendung dieses Leitbildes ansatzweise allenfalls bei Neubauprojekten oder bei Stadterneuerungsmaßnahmen zur Anwendung kommen. Ansonsten dürfte die Substitution der innerstädtischen Personenkraftwagen- Fahrten durch den öffentlichen Personennahverkehr ein ebenso bedeutsamer Ansatz zur CO ² -Vermeidung sein. WORKSHOP 3 115
117 DER VERKEHRSENtWICK- LUNGSPLAN PRO KLIMA: NEUE SCHWERPUNKte IN DER VERKEHRSPLANUNG DER REGION HANNOVER IM ZEICHEN DES KLIMASCHUtZES Klaus Geschwinder, Region Hannover Klimaschutz hat eine große Bedeutung in der Region Hannover. Sichtbare Zeichen dafür waren Organisation und Umsetzung des Klimaschutzjahres 2008, aus dem im Jahr 2009 das Klimaschutzrahmenprogramm der Region Hannover hervorging. Mit diesem ehrgeizigen Programm will die Region Hannover das von der Bundesregierung formulierte Ziel der 40-prozentigen CO ² -Reduktion bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 umsetzen. Der Sektor Verkehr stellt dabei ein problematisches Feld dar. Er ist der einzige Bereich, in dem seit 1990 in der Trendentwicklung keine Minderung der CO ² -Emissionen zu verzeichnen ist. Deshalb wurde im Klimaschutzrahmenprogramm festgelegt, dass für den Sektor Verkehr ein vertiefendes Konzept mit dem Titel Verkehrsentwicklungsplan (VEP) pro Klima zu erstellen ist. Die Region Hannover konnte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit für eine Förderung des VEP gewinnen.
118 Hauptverantwortlich für den negativen trend ist der stetig zunehmende Güterfernverkehr auf der Straße, der von der Region Hannover kaum beeinflusst werden kann. Dagegen ist der Personenverkehr von der Region Hannover und ihren Partnern steuerbar, da er in wesentlichen teilen regionsintern geplant und gestaltet wird. Er ist deshalb Gegenstand des vorgelegten Verkehrsentwicklungsplans pro Klima, der am 27. September 2011 von der Regionsversammlung verabschiedet wurde. Die Rahmenbedingungen sind relativ eindeutig. Von den verkehrsbedingten CO ² -Emissionen entfallen 84 Prozent auf den Straßenverkehr. Damit ist der Straßenverkehr die Stellschraube für das festgelegte Ziel. Die Verkehrsleistung im Straßenverkehr muss deshalb zukünftig abnehmen und emissionsärmer oder emissionsfrei erbracht werden. Die restlichen Anteile entfallen auf den öffentlichen Verkehr und auf weitere Systeme wie zum Beispiel die Binnenschifffahrt und den Flugverkehr. Auf den öffentlichen Verkehr hat die Region Hannover große, auf die beiden anderen Bereiche kaum Einwirkungsmöglichkeiten. der Weg: das drei-teile-konzept Der Verkehrsentwicklungsplan ist in drei Konzeptteile gegliedert: Im ersten teil werden die Wirkungen möglicher Maßnahmen für das Ziel einer 40-prozentigen CO ² -Reduzierung abgeschätzt. Betrachtet werden die vier Handlungsfelder: Siedlungsentwicklung und Nahmobilität Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Verkehrsmanagement, Straßeninfrastruktur und Parken Mobilitätsmanagement vielfältige handlungsmöglichkeiten Das Ergebnis dieser Phase ist ein Katalog von konkreten Handlungsmöglichkeiten. Hinter jedem Punkt steht das erreichbare Einsparpotenzial. Kosten und Wirtschaftlichkeitsaspekte werden in diesem Arbeitsschritt zunächst nicht betrachtet. Es gilt hier der objektive Nutzen. Auf diese Weise können nicht nur die Bereiche identifiziert werden, die eine größere Wirkung haben, sondern auch Dinge erkannt werden, die zwar ein hohes Potenzial vermuten lassen, sich aber in ihrer Wirkung als sehr gering herausstellen. realistisches handlungskonzept Die Ergebnisse werden im zweiten teil zu einem integrierten Handlungskonzept zusammengestellt. Insgesamt werden elf Maßnahmenpakete den vier Handlungsfeldern zugeordnet. Die Maßnahmenpakete sind so ausgewählt, dass durch ihre Umsetzung das gestellte Ziel bis 2020 erreicht werden kann. Gleichzeitig sind sie so zusammengestellt, dass eine Umsetzung des gesamten Handlungskonzeptes bei Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Region Hannover WORKSHOP 3 117
119 118 Workshop 3
120 und ihrer Partner sowie der Durchsetzbarkeit in Politik und Öffentlichkeit ehrgeizig, aber nicht unmöglich erscheint. Es hat sich herausgestellt, dass sich das vorgeschlagene Handlungskonzept an der dreistufigen Verkehrsstrategie der Region Hannover orientiert, die seit vielen Jahren als Grundlage für die Verkehrsentwicklung in der Region Hannover dient: Innen- vor Außenentwicklung: Die Siedlungstätigkeit wird auf die Innenentwicklung konzentriert sowie auf Standorte an Schienenhaltestellen mit guter Infrastruktur gelenkt. So verbessert sich deren Erreichbarkeit auch ohne Auto. Regionales Radverkehrskonzept: Radfahren in der Region Hannover soll schneller, bequemer und sicherer und damit insgesamt deutlich attraktiver werden, so dass im Jahr 2020 jeder vierte Weg mit dem Fahrrad zurückgelegt wird. Verkehr vermeiden, handlungsfeld Öpnv Verkehr verlagern, Verkehr verträglich abwickeln. Das bedeutet, dass mit dem VEP pro Klima kein Kurswechsel in der Verkehrsplanung und -entwicklung der Region Hannover notwendig ist. Stattdessen muss die Umsetzung der Maßnahmen beschleunigt, intensiviert und ausgeweitet werden. konkrete maßnahmenpakete Der VEP pro Klima beinhaltet in den vier Handlungsfeldern folgende elf Maßnahmenpakete: handlungsfeld siedlungsentwicklung und nahmobilität Ökostrom, alternative Antriebe: Stadt- und S-Bahnen fahren zukünftig mit CO ² -freiem Ökostrom. Die Busflotte wird 2020 aus energiesparsamen Fahrzeugen mit alternativen Antrieben bestehen. Der ÖPNV behält damit seinen Umweltvorsprung gegenüber dem motorisierten Individualverkehr. taktverbesserungen: Das Fahrtenangebot der Stadtbahn und der S-Bahn wird erheblich ausgeweitet. Marktbearbeitung, tarifangebote: Durch innovative Angebote werden neue Kundenkreise für den ÖPNV und für neue Mobilitätsdienstleistungen gewonnen. Jobticket für alle: Die Beschäftigten in der Region Hannover bekommen über ihren Arbeitgeber oder ihre Wohnungsgesellschaft ein günstiges Jobticket angeboten. WORKSHOP 3 119
121 handlungsfeld verkehrsmanagement, straßeninfrastruktur und parken Elektromobilität: Die Region Hannover unterstützt die Markteinführung von Elektrofahrzeugen. Alle elf Maßnahmenpakete zeigen deutliche Wirkungen. Die größten Wirkungen lassen sich durch die Realisierung der Maßnahmenpakete Regionales Radverkehrskonzept und Ökostrom, alternative Antriebe erzielen. Ruhender Verkehr: Ein effizientes Parkraummanagement sorgt für eine bessere Auslastung vorhandener Anlagen. Dadurch werden weniger Parkplätze benötigt und Überkapazitäten abgebaut. Verkehrsinformation und Verstetigung des Verkehrsflusses: In der Region Hannover fährt man zukünftig mit geringerer Geschwindigkeit, dafür aber flüssiger. konsequente umsetzungsstrategie Um den Umsetzungswillen zu verdeutlichen, enthält der VEP pro Klima im dritten teil eine Umsetzungsstrategie, die konkrete Vorgaben für die Überführung der elf Maßnahmenpakete in den Realisierungsprozess festlegt. Folgerichtig wird die Verwaltung im Beschlusstext zum VEP pro Klima beauftragt, konkrete Umsetzungsschritte vorzubereiten und eine Dachkampagne einzuleiten. handlungsfeld mobilitätsmanagement Dachkampagne: Regelmäßige Kampagnen begleiten die Einführung neuer Mobilitätsangebote in der Region und schaffen bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein für eine klimaschonende Mobilität. Mobilitätsmanagement: Im Jahr 2020 bietet ein Netzwerk von vielen Akteuren der Region den Bürgern umfassende Mobilitätsdienstleistungen für eine günstige und gesundheitsfördernde Mobilität. Die vorgeschlagenen Umsetzungsschritte sind hierbei sehr unterschiedlich und greifen zeitlich ungleich. Die Verwaltung hat bereits mit der Verabschiedung des VEP pro Klima mit den Arbeiten an den Umsetzungsschritten für die Maßnahmenpakete begonnen, die relativ kurzfristig umgesetzt werden können. So steht sie in konkreten Verhandlungen mit dem Verkehrsunternehmen üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG zum Aufbau einer umweltfreundlichen Busflotte mit Hybridfahrzeugen. Andere konkrete Planungen beschäftigen sich mit der bereits angesprochenen Dachkampagne, der Bestellung von Ökostrom und der Verdichtung des Angebotes im Schienenpersonennahverkehr. Erste Ergebnisse zu diesen Projekten sind in Kürze zu erwarten. 120 WORKSHOP 3
122 Der VEP pro Klima wurde mittlerweile auch dem Bundesumweltministerium vorgelegt. Dieses ist Voraussetzung für die Förderung der nun folgenden Umsetzungsschritte. Aus den Fördermitteln will die Verwaltung in 2012 und 2013 einen Radverkehrsbeauftragten und einen Mobilitätsmanager anstellen, die die jeweiligen Maßnahmenplanungen in den Bereichen Radverkehr und Mobilitätsmanagement in den Umsetzungsprozess überführen sollen. Es tut sich also allerhand im Bereich der Mobilität und des Verkehrs in der Region Hannover. Allen Maßnahmen ist das Ziel gemein, die Beeinträchtigungen durch den Verkehr zu reduzieren und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu steigern. WORKSHOP 3 121
123 PLENUMSDISKUSSION Moderation: Sonja Papenfuß, Region Hannover beitrag der regionalplanung zum ausbau von erneuerbaren energieträgern Wie die vorgestellten Projekte zeigen, ist die regionale Planung am effektivsten bei der Standortfestlegung von Windenergieanlagen. Die alleinige Regelung durch die Gemeinden ist in diesem Bereich nicht zielführend, zumal das Spannungsfeld zwischen den wirtschaftlichen Interessen und den Interessen des Naturschutzes und der Bevölkerung nicht klein ist. Die Regionalplanung muss die Interessen abwägen, denn die Wirtschaftlichkeit allein darf nicht im Vordergrund stehen. Von untergeordneter Rolle für die Regionalplanung ist die tiefengeothermie, da die geologischen Voraussetzungen die maßgeblichen Determinanten dieser Energieerzeugung sind. So sei laut Verbandsdirektor Dr. Dieter Karlin (Regionalverband Südlicher Oberrhein) die Raumwirksamkeit als verschwindend gering einzuordnen. Informelle Instrumente seien hier von größerer Bedeutung als die Instrumente der Regionalplanung. Intensiv diskutieren die teilnehmenden die Erzeugung erneuerbarer Energien aus Bioenergie: Dies ist ein ambivalentes, komplexes themenfeld, das im ländlichen Raum zunehmend zu Konflikten führt. Insbesondere bei der Errichtung von Biogasanlagen ist ein sensibler Umgang unabdingbar, um die Akzeptanz bei der Bevölkerung zu gewährleisten. Zudem steht die Erzeugung von Biomasse bekanntermaßen in Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Um dieses Problem zu lösen, gilt es, vorhandene Biomassenpotenziale zu nutzen. Beispielsweise ist die Region Südlicher Oberrhein von hochwertigen Böden geprägt, die sich optimal für den Nahrungsmittelanbau eignen, so dass ein verstärkter Anbau von Biomasse für die Energiegewinnung nicht zielführend ist. In dieser Region liegen die Potenziale in den Abfallprodukten des Weinbaus. klima-beratungsangebote: ein erfolgreiches informelles instrument In Baden-Württemberg zeigt sich, dass Regionen, die Klima-Institutionen mit einem Informations- und Beratungsangebot initiiert haben, beim erfolgreichen Klimaschutz im Vergleich zu anderen Regionen überdurchschnittlich gut abschneiden. Beispielsweise nehmen die Bürgerinnen und Bürger die drei Programme zur Energieberatung (inklusive Förderungsmöglich- 122 PLENUMSDISKUSSION
124 keiten), die es in der Region Südlicher Oberrhein gibt, rege in Anspruch. Diese Beratungen dienen als wichtige Unterstützung, um Maßnahmen umzusetzen. schlussfolgerungen aus den vorgestellten projekten In der Diskussion wird deutlich, dass eine Kooperation auf Regionsebene entweder als informelle Zusammenarbeit oder als regionale Gebietskörperschaft geeignet ist, den Rahmen für Aktivitäten im Bereich Klimaschutz zu setzen und als Impulsgeber zu fungieren. Dabei ist jedoch eine Zusammenarbeit mit strategischen Partnern und weiteren Akteuren in einem Netzwerk unabdingbar, um auch konkrete Maßnahmen umsetzen zu können. Alleine die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes als Gutachten ist nicht zielführend. Ergänzend ist die Erfolgskontrolle des Konzeptes wichtig, um zwischen den Wirkungen einzelner Maßnahmen und dem Einfluss von externen Rahmenbedingungen, beispielsweise dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, differenzieren zu können. Breite Zustimmung finden auch die vorgestellten Beratungsangebote zur Information über die komplexen themen Klimaschutz und erneuerbare Energien, um die Bevölkerung für den Klimaschutz zu sensibilisieren. Dieser Ansatz ist als ein richtiger Weg mit großem Potenzial für den Klimaschutz und den Ausbau von erneuerbaren Energien anzusehen und sollte daher weiter ausgebaut werden. PLENUMSDISKUSSION 123
125 SOZIALER LAStENAUSGLEICH IN DER StADt-UMLAND- BEZIEHUNG Erwin Jordan, Regionsrat, Region Hannover Das Modell der Region Hannover ist im Kern ein Solidarpakt zwischen einer Großstadt und dem städtischen Umland. Ziel ist eine gerechtere Verteilung der in Großstädten signifikant höher ausfallenden Sozialkosten. Gleichzeitig profitieren die Städte und Gemeinden im Umland unter anderem von der Großstadt als Wirtschaftsstandort und als Ort vielfältiger Kultur- und Freizeitangebote. Den bundesweit in dieser Form einmaligen Lastenausgleich zwischen einer Großstadt und ihrem großstädtischen Umland belegen folgende Beispiele: Soziales: Solidarischer Kostenausgleich für die Leistungen nach Sozialgesetzbuch II und XII Jugend: Kostenerstattung in der Jugendhilfe Klinikum: Sicherung der kommunalen Trägerschaft und der wohnortnahen Versorgung, Herstellung verlustfreien Wirtschaftens sowie eigener Investitionstätigkeit
126 % ,1 4,5 5,1 5,4 5,5 5,8 6,1 6,2 6,9 7,3 7,3 8,0 8,0 8,4 8,5 9,6 10,0 10,4 11,2 11,5 11,7 13,3 15,5 0 Isernhagen Wedemark Burgwedel Pattensen Hemmingen Gehrden Sehnde Wennigsen Uetze Wunstorf Neustadt a. Rbge. Springe Barsinghausen Region ohne LHH Burgdorf Lehrte Ronnenberg Langenhagen Garbsen Seelze Region Hannover Laatzen Hannover Anteil der Empfänger von Mindestsicherungsleistungen an der Gesamtbevölkerung am lastenausgleich durch umverteilung von kosten: beispiel sozialhilfekosten In der Region Hannover waren ,7 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner auf Mindestsicherungsleistungen angewiesen. Mit Blick auf die einzelnen Regionskommunen ergibt sich ein differenziertes Bild: In Hannover beziehen 15,5 Prozent, in den Städten und Gemeinden im Umland zusammen 8,4 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Mindestsicherungsleistungen. Insgesamt gibt es also ein starkes Gefälle der sozialen Lagen. Vom sozialen Lastenausgleich kann vor allem die Landeshauptstadt Hannover profitieren, denn in der Landeshauptstadt Hannover leben 45 bis 46 Prozent der Regionseinwohnerinnen und Regionseinwohner; doch hier fallen rund 68 Prozent der Kosten der Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch XII, 2010) an. Die Sozialhilfekosten werden seit Gründung der Region aus deren Haushalt beglichen, der wiederum durch die Regionsumlage von allen Städten und Gemeinden getragen wird. Der Entlastungseffekt für die Landeshauptstadt Hannover betrug allein im Bereich des Sozialgesetzbuchs XII bei Gesamtkosten von 198,2 Millionen Euro in 2010 rund 44,2 Millionen Euro. % ,9 68,1 45,5 45,5 45,4 45,3 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45, , ,5 37,4 32,4 31,6 30,9 31,4 33,1 31,7 62,6 67, Anteil Kosten Umland Anteil Kosten LHH Anteil Bevölkerung LHH 68,4 69,1 68,6 66,9 68,3 Anteile Netto-Sozialhilfekosten (SGB Xll) und Gesamtbevölkerung 2001 bis 2010 VORtRAG 125
127 Die Anzahl der Empfänger zentraler Sozialleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Sozialgesetzbuch II) hat sich bedingt durch die Reform etwa verdoppelt. Der damit verbundene Anstieg der Sozialhilfekosten wird durch die Region Hannover als örtlicher träger der Sozialhilfe geschultert. Der Anteil an allen Empfängern dieser Leistungen aus der Landeshauptstadt Hannover beträgt etwa 60 bis 62 Prozent bei einem Bevölkerungsanteil von rund 45 Prozent. lastenausgleich in der Jugendhilfe: beispiel Jugendhilfekostenausgleich Vor Gründung der Region Hannover gab es die Jugendämter der Landeshauptstadt Hannover, des alten Landkreises Hannover sowie in den Städten Burgdorf und Lehrte. Die Landeshauptstadt Hannover kam voll für die eigenen Kosten auf, der Landkreis erstattete Burgdorf und Lehrte 100 Prozent ihrer Kosten. Mit Regionsbildung sollte die Jugendhilfe stärker dezentralisiert werden. Es kamen jedoch nur in den Städten Laatzen, Langenhagen und Springe neue Jugendämter hinzu. % , ,8 37,6 40, ,6 39,2 38, ,9 61,2 62,4 59, ,4 60,8 61, Anteil Empfänger Umland Anteil Empfänger LHH Anteil Leistungsempfänger gesamt Leistungsempfänger HLU und Grundsicherung, 2002 bis 2010* (* nur HLU, GruSi, ab 2005 mit SGB II, 2005 unvollständige Daten SGB II) Als bundesweit einmalige Regelung werden Städten mit eigenem Jugendamt 80 Prozent der eigenen Jugendhilfekosten über den Jugendhilfekostenausgleich erstattet. Dies führt zu einer Entlastung der Leistungsempfänger absolut 126 VORtRAG
128 Landeshauptstadt Hannover in Höhe von zurzeit etwa 55 Millionen Euro, die Städte mit eigenem Jugendamt haben mit Regionsbildung jetzt Lasten von mindestens 20 Prozent ihrer Jugendhilfekosten übernommen. lastenausgleich durch gebündelte leistungserbringung: beispiel klinikum region hannover Vor der Regionsgründung gehörten sechs Krankenhäuser zum alten Landkreis (Regiebetriebe), sieben Krankenhäuser zur Landeshauptstadt Hannover (Eigenbetriebe). Zum 1. Januar 2003 wurde der gesetzlich vorgeschriebene Übergang der sieben Krankenhäuser der Landeshauptstadt Hannover zur Region Hannover vollzogen. Damit verbunden waren die Übernahme aller finanziellen und strukturellen Altlasten sowie ein Modernisierungsstau um Umfang von rund 250 Millionen Euro. Zum 1. Januar 2005 wurde die gemeinsame Klinikum Region Hannover GmbH mit Vorlage eines Businessplans gegründet. Das Klinikum Region Hannover ist heute mit seinen zwölf Krankenhäusern der zweitgrößte kommunale Krankenhausverbund und benötigt keine Zuschüsse mehr. Durch die Zusammenführung der Krankenhäuser ist es gelungen, Synergieeffekte auszunutzen und die Versorgungslage deutlich zu verbessern. Weitere positive Effekte sind der Erhalt von Arbeitsplätzen sowie der Erhalt der kommunalen Steuerung dieser wichtigen Einrichtung der Daseinsvorsorge. 0,0 0,5-2,7-5, Alle wesentlichen Ziele des Klinikums konnten in den Folgejahren umgesetzt werden: -14, Erhalt der wohnortnahen Versorgung -11, Verlustfreies Wirtschaften Herstellen einer eigenständigen Investitionstätigkeit -21, Mio Zuschussbedarf/Überschuss Klinikum Region Hannover, VORtRAG 127
129 AttRAKtIVER ÖFFENtLICHER PERSONEN- NAHVERKEHR DURCH Aufgabenbündelung Viele Menschen in der Region Hannover nutzen täglich den Nahverkehr auf ihren Wegen zur Arbeit, in die Schule, zum Einkaufen oder auch in ihrer Freizeit. Das Nahverkehrssystem ist exzellent ausgebaut, Busse und Bahnen fahren in einer dichten Taktfolge und durch abgestimmte Anschlüsse sind alle Ziele in der Region gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Im Auftrag der Region Hannover sind sie unterwegs: Auf den Schienenstrecken bis weit über die Regionsgrenzen hinaus die S-Bahnen, die Regionalbahnen und der metronom, innerhalb der Stadt Hannover die Stadtbahnen und Busse der üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe GmbH und im übrigen Regionsgebiet die Busse der RegioBus Hannover GmbH. Ulf-Birger Franz, Regionsrat, Region Hannover Den Bürgerinnen und Bürgern einen ausreichenden öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zur Verfügung zu stellen, liegt in der Verantwortung der Region Hannover. Sie ist nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz die Aufgabenträgerin für den gesamten ÖPNV auf ihrem Gebiet und damit sowohl für den Schienen- als auch für den Busverkehr verantwortlich.
130 Wo und wie häufig Busse und Bahnen fahren müssen, welche Qualitätsanforderungen zum Beispiel an Fahrzeuge, Personal und Fahrgastinformation gestellt werden, damit die Verkehrsbedienung ausreichend ist, bestimmt die Region Hannover. Dazu wird alle fünf Jahre ein Nahverkehrsplan erstellt, der die notwendige Ausgestaltung des ÖPNV in der Region beschreibt und festlegt, wie das Nahverkehrssystem für die Zukunft weiter entwickelt werden soll. Auf dieser Grundlage beauftragt die Region Hannover die Verkehrsunternehmen. Die Rolle der Region Hannover als Aufgabenträgerin hat sich dabei seit der Regionsgründung fundamental verändert. Hinsichtlich der Finanzierung des Nahverkehrs bestand im Jahr 2001 die Rolle der Region noch vornehmlich aus einer Scharnierfunktion, um die erforderlichen Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen zu zahlen. Für den Schienenpersonennahverkehr wurden die dafür von Bund und Land zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmittel an die DB Regio AG quasi durchgereicht. Für die Bus- und Stadtbahnverkehre wurde jeweils nach Abschluss der Geschäftsjahre rückwirkend der verbleibende Verlust ausgeglichen. Ein Verkehrsvertrag, der die Leistungen konkret benennt, wurde mit der DB Regio erstmals im Jahr 2001 abgeschlossen. Die Regelungsinhalte waren im Vergleich zu den heutigen vertraglichen Regelungen vergleichsweise bescheiden. Die Motivation für die Region Hannover in diesem Aufgabenfeld wesentlich stärker eine steuernde Funktion zu übernehmen, bestand einerseits in dem zunehmenden Kostendruck und der damit verbundenen Anforderung, die Haushaltsmittel noch effizienter als bisher einzusetzen. Gleichzeitig rückte die europäische Gesetzgebung stärker als bisher in den Fokus der Nahverkehrsfinanzierung, die den Aufgabenträgern dabei eine zentralere Rolle als vorher zugeordnet hat. Grund genug für die Region Hannover zu handeln und deutlich stärker als in der Vergangenheit, die Steuerung des Nahverkehrs voran zu treiben. Dass dies erfolgreich gelungen ist, beweisen nicht zuletzt die jährlichen Fahrgastzahlen in der Region, die von 160 Millionen im Jahr 2000 auf über 190 Millionen im Jahr 2010 gestiegen sind. An dieser deutlich über dem Bundestrend liegenden Entwicklung hat vor allem das zur Weltausstellung Expo 2000 eingeführte S-Bahn- System maßgeblichen Anteil. Im Jahr 2006 wurde mit der DB Regio ein neuer Verkehrsvertrag abgeschlossen, der die Leistungen konkret beschreibt und Elemente zur Qualitätssteuerung beinhaltet. Gleichzeitig ebnete dieser Vertrag auch den Weg in den weiteren Ausschreibungswettbewerb. Die erste ausgeschriebene Verkehrsleistung auf der Schiene ging im Dezember 2006 an den Start. Auf der Relation Uelzen-Hannover-Göttingen fährt seit dieser Zeit der metronom. Höhere Qualität zu deutlich geringeren Kosten, das ist das positive Ergebnis dieser Ausschreibung. Auch die Fahrgäste schätzen den Qualitätssprung und sind deutlich häufiger auf dieser Linie unterwegs. Während die Region in dieser Ausschreibung noch als Juniorpartner der Landes- VORtRAG 129
131 nahverkehrsgesellschaft Niedersachsen agierte, wurde im Jahr 2010 erstmals federführend durch die Region Hannover die Ausschreibung der S-Bahn Hannover durchgeführt. Mit 8,5 Millionen Zug-Kilometer pro Jahr eines der bis dahin größten Ausschreibungsprojekte im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Deutschland. Das Ausschreibungsergebnis ist noch besser als erwartet: Mehr Angebot mehr Qualität deutlich weniger Zuschuss, so lautet die Erfolgsformel des ehrgeizigen Projektes. Anders als auf der Schiene fahren im Bus- und Stadtbahnverkehr mit der üstra und der RegioBus Verkehrsunternehmen, die zum Konzern Region Hannover gehören. Die im Ballungsraum der Region Hannover sehr stark vernetzten Nahverkehrslinien lassen sich so praktisch aus einem Guss und mit maximalen Steuerungsmöglichkeiten durch den Aufgabenträger und Gesellschafter Region Hannover koordinieren. Das hat viele Vorteile für die Fahrgäste, weil so die Angebote optimal aufeinander abgestimmt werden können. Damit das so bleibt, hat die Region Hannover die Verkehrsleistungen der Busse und Stadtbahnen direkt an üstra und RegioBus vergeben. In Partnerschaftsverträgen ist festgelegt, dass die Unternehmen ihre Kosten am Markt ausrichten und auch im bundesweiten Vergleich ehrgeizige wirtschaftliche Ziele erreichen. So bleibt der Nahverkehr in der Region auch in der Zukunft bezahlbar. Die Anstrengungen seit Regionsgründung haben sich ausgezahlt: Die Zuschüsse für den SPNV konnten von 73,9 Millionen Euro im Jahr 2002 auf 74,1 Millionen Euro im Jahr 2010 fast auf gleichem Niveau gehalten werden. Das ist deshalb bemerkenswert, weil in dieser Zeit die Energiepreise, die die Kosten des Nahverkehrs maßgeblich beeinflussen, deutlich zugenommen haben und das Land die Zuwendungen (Regionalisierungsmittel) für diese Aufgabe im gleichen Zeitraum von 74,2 Millionen Euro auf 72,5 Millionen Euro erheblich gekürzt hat. Zur Finanzierung der Busverkehre waren die Zuschusszahlungen der Region sogar deutlich rückläufig. Während im Jahr 2002 noch 66,2 Millionen Euro aus dem Haushalt der Region erforderlich waren um die Busverkehrsleistungen zu finanzieren, konnte dieser Betrag im Jahr 2010 auf circa 57,5 Millionen Euro deutlich reduziert werden. Im gleichen Zeitraum hat sich die Qualität des Nahverkehrs erheblich verbessert. In den Verträgen und Vereinbarungen hat die Region die Anforderungen an die Verkehrsunternehmen klar beschrieben und ihnen Qualitätsziele gesetzt. Regelmäßig lässt sich die Region nun berichten, ob die vereinbarten Ziele eingehalten werden und welche Maßnahmen erforderlich sind um die Qualität weiter zu verbessern. Im Jahr 2010 ist erstmals der Bericht der Region Qualität im Nahverkehr erschienen, der nun jährlich über die Ergebnisse der Qualitätsmessungen informiert. Im Mittelpunkt steht der Fahrgast das ist die Leitlinie der Region, und dass die Erfolgsgeschichte des ÖPNV seit Regionsgründung eine Erfolgsgeschichte der Fahrgäste ist, zeigen die Zahlen in beeindruckender Weise. Schon 2002 war die große Mehrheit der 130 VORtRAG
132 vortrag 131
133 Fahrgäste mit dem Nahverkehr in der Region Hannover zufrieden. Inzwischen ist es Standard für jedes der Verkehrsunternehmen geworden, Kunden regelmäßig nach ihrem Urteil zu fragen. Dabei ist die tendenz eindeutig: Die Zufriedenheit ist hoch, die stetig verbesserte Qualität wird wahrgenommen. So versteht sich auch, dass heute deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger der Region die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Seit der Jahrtausendwende haben die jährlichen Nutzerzahlen um 20 Prozent zugenommen. Es ist davon auszugehen, dass die Bedeutung des ÖPNV für die Region Hannover auch zukünftig weiter zunehmen wird. Denn nur so sind die ehrgeizigen Umweltziele zu erreichen, die sich die Region gesetzt hat. Nur mit einem attraktiven ÖPNV-Angebot kann die Mobilität bei knapper werdenden fossilen Energievorräten so gesichert werden, dass die Lebensqualität und die wirtschaftliche Standortgunst der Region langfristig erhalten bleiben. Die Region Hannover ist für die zukünftigen Herausforderungen im ÖPNV sehr gut aufgestellt. Mit den hervorragenden Ausschreibungsergebnissen wurde außerdem der notwendige finanzielle Gestaltungsspielraum dafür geschaffen, den Einwohnerinnen und Einwohnern der Region auch weiterhin eine ausreichende und angemessene Verkehrsbedienung im ÖPNV zur Verfügung zu stellen. Und dies bedeutet vor allem, angesichts der in den kommenden Jahren auf über 200 Millionen steigenden jährlichen Fahrgastzahlen zusätzliche Kapazitäten und neue Angebote zu schaffen. 132 VORtRAG
134 Workshop 4: StADtREGIONALE PLANUNGSINStRUMENtE
135 DER GEMEINSAME FLÄCHEN- NUtZUNGSPLAN ÜBERLEGUN- GEN ZUM PROBLEMLÖSUNGS- POtENZIAL DES INStRUMENtES AM BEISPIEL DES ZWECKVER- BANDES RAUM KASSEL Andreas Vesper, Zweckverband Raum Kassel Am Beispiel des gemeinsamen Flächennutzungsplanes (gfnp) des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) soll umrissen werden, welchen Beitrag dieses Instrument zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit in einer Stadtregion leisten kann, wobei aber auch hier wie für alle stadtregionalen Instrumente gilt, dass es für jeden Raum spezifische Bedingungen gibt und sich Erfahrungen nicht einfach übertragen lassen.
136 Der Raum Kassel ist ein einkerniger ballungsferner Verdichtungsraum inmitten eines strukturschwächeren, ländlich geprägten Raumes; er umfasst hier gleichgesetzt mit dem Gebiet des Zweckverbandes Raum Kassel eine Fläche von circa 380 Quadratkilometer, auf der rund Einwohnerinnen und Einwohner leben und auf vier Prozent der Fläche der Planungsregion Nordhessen circa 35 Prozent der nordhessischen Wirtschaftsleistung erarbeiten. Der hohe Verflechtungsgrad seiner elf Kommunen erzwingt interkommunale Kooperation, um in der Konkurrenz der Regionen bestehen zu können. Im Rahmen der kommunalen Neugliederung 1972 setzten die unmittelbar an den Regionskern Kassel angrenzenden Kommunen den Erhalt ihrer Selbständigkeit durch. Um den aus den engen funktionalen Verflechtungen zwischen Kernstadt und Umlandgemeinden resultierenden Regelungsbedarf besser bewältigen zu können, wurden die Kommunen per Landesgesetz zur Zusammenarbeit bei der Flächennutzungs- und -entwicklungsplanung in Form eines Zweckverbandes verpflichtet. Mangels politischen Drucks wurde eines der ursprünglichen Ziele, die Aufstellung des gfnp für das Gesamtgebiet des Zweckverbandes Raum Kassel, zunächst zurückgestellt und es wurden lediglich Änderungsverfahren auf weitgehend veralteter Grundlage durchgeführt. Der Raum Kassel im Schnittpunkt der Metropolregionen Stattdessen wurden auch als Vorarbeiten für den gfnp besser überschaubare sektorale Entwicklungsplanungen forciert (Siedlungsrahmenkonzept mit Aussagen unter anderem zu Lage und Umfang von Siedlungsentwicklungsschwerpunkten, Entwicklungsplan zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung, Gesamtverkehrsplan, Landschaftsplan) sowie ein interkommunal betriebenes Güterverkehrszentrum aufgebaut. WORKSHOP 4 135
137 Basierend auf diesen Entwicklungsplanungen wurde die FNP-Aufstellung seit 2003 als ein Plan mit einer Darstellungssystematik und einheitlichen Bewertungsmaßstäben angegangen. Auf ein Leitbild als bewusstseinsbildendes, raum- und sachübergreifendes Bindeglied eigentlich höchst wünschenswert musste verzichtet werden: Politisch waren die Bedenken zu groß, dass der gfnp mit einer weiter ausgreifenden Leitbilddebatte in den Strudel der immer wieder aufflammenden Regionaldiskussion geraten könnte. (Gemeint ist eine zwischen regionalen Akteuren und Landesregierung sehr kontrovers geführte Debatte um die Etablierung eines Regionalkreismodells in Nordhessen.) ziele des gfnp des zweckverbandes raum kassel Die mit der gfnp-aufstellung verfolgten Ziele wurden demgemäß bescheiden angesetzt: FNP der Stadt Kassel bzw. der Stadt Vellmar bis 2009 (oben), gfnp des Zweckverbandes Raum Kassel seit 2009 (unten): Vereinfachung, Aktualisierung, Grenzbereichsabstimmung ein valider Plan: Aktualisierung aller Darstellungen, um die Bebauungspläne wieder ableiten zu können ein FNP für den gesamten Zweckverband Raum Kassel: gemeinsame Handlungsgrundlage schaffen; zehn Darstellungssystematiken durch eine ersetzen Reduzierung der Darstellungstiefe: Spielräume für Bebauungspläne der Kommunen erweitern 136 WORKSHOP 4
138 Einarbeitung des Landschaftsplans und der Kommunalen Entwicklungspläne: Entwicklungsplanungen über ein formelles Planverfahren stärken Gestaltungswillen demonstrieren: neueste Planungsabsichten gebündelt darstellen FNP der Stadt Kassel bis 2009 (oben), gfnp des Zweckverbandes Raum Kassel seit 2009 (unten): Vereinfachung, Aktualisierung, Reduzierung der Siedlungsexpansion Dem zurückhaltenden Ansatz entsprach die Arbeitsweise einer engen und detaillierten Abstimmung mit den Kommunen, die gegenseitiges Vertrauen und Verständnis, vor allem verwaltungsintern, gestärkt, auf den Gesamtraum bezogenes Verständnis aber nur begrenzt gefördert hat. Insgesamt konnten die gesteckten Ziele aber erreicht werden. beiträge des instrumentes gfnp zur stärkung der stadtregion kassel und die erfahrungen aus dem planungsprozess Die Beiträge des Instrumentes gfnp zur Stärkung der Stadtregion Kassel und die Erfahrungen aus dem Planungsprozess sind vor dem geschilderten Hintergrund zu sehen; sie lassen kritische, aber auch ermutigende Wertungen zu. Der Verzicht auf die Leitbild-Diskussion hat dazu geführt, dass eine umfassende grenzüberschreitende Konzeption nicht entwickelt und eine Chance zur Festigung des Regionsbewusstseins nicht genutzt wurde. WORKSHOP 4 137
139 Der gfnp wurde lange als unzulässiger Eingriff in die kommunale Planungshoheit empfunden. Aus Vorsicht wurde der gfnp dann eher additiv zusammengestellt als integrativ entwickelt. Die kleinteilige Herangehensweise hat das Vertrauen der Kommunen gegenüber dem Verband als Planverfasser gestärkt, den Blick auf gemeinsame Problemlagen, Chancen und Zielsetzungen aber etwas verstellt. Der FNP hat generell an Steuerungskraft verloren, er wird eher nachgeführt (im Innenbereich wegen 13a Absatz 2 Nr. 2 Baugesetzbuch; Großprojekte setzen selbst Rahmenbedingungen; im Außenbereich kompliziert sich Planung); der gfnp als Instrument für Kooperation an Wert. Die Vielzahl anderer Koordinierungsansätze und -institutionen relativiert die Bedeutung sowohl des gfnp als Instrument als auch des Zweckverbandes Raum Kassel als stadtregionaler Institution. Positiv ist zu vermerken: Der gfnp wird von den Verbandsmitgliedern zunehmend akzeptiert; das im Planungsprozess erwachsene Vertrauensverhältnis besteht fort. Die Einarbeitung der Entwicklungsplanungen macht den gfnp attraktiv: Die für virulente Problemstellungen erarbeiteten Entwicklungsplanungen sind als informeller Planungsansatz - flexibel bezüglich Gegenstand, Form, Aussagetiefe und Verbindlichkeit, - rascher, kostengünstiger und problemorientiert herstell- und aktualisierbar, - eher operativ ausgerichtet und - eine gemeindeübergreifende Konzeption ist leichter möglich. Der umsetzungsnähere Ansatz wird in Politik und Öffentlichkeit positiv wahrgenommen. Entwicklungsplanungen werden durch Einarbeitung in den gfnp attraktiv. Durch das förmliche Verfahren gewinnen die informell erarbeiteten Handlungsempfehlungen an Gewicht. Es zeigt sich, dass der vom Zweckverband Raum Kassel verfolgte Ansatz, die einander wechselseitig positiv beeinflussenden Instrumente gfnp und Entwicklungsplanungen je nach Problemlage pragmatisch einzusetzen, Erfolg verspricht. Fazit Problemlösungspotential für stadtregionale Probleme hat der gfnp gewiss: Im Wechselspiel mit sachlichen oder teilräumlichen Entwicklungsplanungen kann er zum Beispiel: 138 WORKSHOP 4
140 interkommunale Flächenkonkurrenzen im Wohnbau- wie auch im Gewerbebereich klären, überörtliche Grünvernetzungen sichern oder interkommunal wirksame Regelungen für Ansiedlungen des großflächigen Einzelhandels rechtswirksam festschreiben. Allein schafft der gfnp diese Leistung nicht, aber in einem pragmatisch an den jeweiligen politischen Gegebenheiten orientierten Zusammenspiel von, eventuell noch weiter auszudifferenzierenden, Entwicklungsplanungen und Flächennutzungsplanung entstehen immer wieder erfolgversprechende Kooperationsansätze. Weitere Informationen unter WORKSHOP 4 139
141 DER REGIONALPLAN Christian Breu, Verbandsdirektor, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München Der Regionalplan als Instrument der Regionalentwicklung hat seinen Platz in ganz unterschiedlich verfassten und strukturierten Regionen. Bei dem Regionalplan München geht es um den Regionalplan in seiner ursprünglichen Form, also als strikt überörtlich angelegter Raumordnungsplan, den die Kommunen der Region München gemeinsam aufstellen. Die Aufgabe selbst ist eine staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis. Der Regionalplan gedeiht am Besten in einer solch kommunal verfassten Region. Kennzeichen dafür ist, dass es keine regionale Zentrale gibt, die Vorgaben zu allen Entwicklungsbereichen macht. Im Gegenteil in der Region München stehen die Kommunen mit ihrer Planungshoheit im Mittelpunkt der räumlichen Entwicklung. Die Regionalplanung ist eingebettet in ein Netzwerk von Organisationen, die jeweils ihre genau definierten Ziele verfolgen und untereinander eng zusammenarbeiten.
142 vorteile einer solchen lösung: Siedlung und Verkehr Die Effizienz in dezentralen Organisationen ist höher als bei einer zentralen Steuerung. Die Mitgliedsstruktur und Organisation der einzelnen Institutionen kann zielgerecht zugeschnitten werden. Diese Konstruktion ermöglicht eine Einbeziehung von Wirtschaft und Gesellschaft in die regionale Entwicklung. Diese Strukturen sind politisch gut legitimiert, denn die Kommunen sind mit ihren vom Volk direkt gewählten Vertretern beteiligt. Die wesentliche Herausforderung besteht in dem Abstimmungsprozess untereinander. Dieser ist in der Region München seit den 1950er Jahren gut eingeübt, auch die Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern. inhalte des regionalplans Die Aussagen und Vorgaben des Regionalplans beschränken sich auf überörtlich und regional bedeutsame themen und Projekte. Wie oben erwähnt sind träger der Regionalplanung alle Kommunen im Regionalen Planungsverband München. Die themen des Regionalplans konzentrieren sich auf die entwicklungsrelevanten Felder: Wirtschaft (Bodenschätze, Einzelhandel, Energie) Natürliche Lebensgrundlagen, Landschaft Regionsspezifische themen (in der Region München Freizeit und Erholung, zum Beispiel Golfplätze) Festlegungen zu den zentralen Orten der unteren Stufe (ansonsten erledigt das die Landesplanung) Instrumente des Regionalplans sind zum einen verbale Ziele, zum anderen die Ausweisung von Gebieten (zum Beispiel Grünzüge, Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, Bodenschätze). In dieser Konstruktion haben der Regionalplan und der Regionale Planungsverband München keine eigenen Verwaltungs- und Umsetzungskompetenzen. Die Umsetzung der raumordnerischen Ziele des Regionalplans erfolgen über 1 Absatz 4 Baugesetzbuch und 4 Raumordnungsgesetz. trotz dieser zuweilen als Manko beschriebenen fehlenden Umsetzungskompetenz sind circa 98 Prozent aller Bauleitplanungen in der Region München mit den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen kompatibel. WORKSHOP 4 141
143 Geschäftsstelle des RPV Organe des Regionalen Planungsverbands München (RPV München) Verbandsversammlung 194 Verbandsmitglieder Wichtige inhalte: Regionale Grünzüge, die wichtig für die Durchlüftung der Region sind. trenngrün soll bandartiges Zusammenwachsen von Siedlungen vermeiden, auch an den S-Bahn- Achsen. Regionsbeauftragter der Regierung von Oberbayern Planungsausschuss 30 Vertreter Verbandsvorsitzender Komissionen Arbeitskreise zu aktuellen Fragen Organigramm des Regionalen Planungsverbandes München Da der Regionale Planungsverband München auch nicht träger des Raumordnungsverfahrens ist, sondern lediglich Beteiligter, verfügt er nicht über Vetorechte in diesen Raumordnungsverfahren. Das ist vor allem im Bereich des großflächigen Einzelhandels Möbelhäuser mit sehr großen zentrenrelevanten Nebensortimenten ein Nachteil. Hier konnte sich der Regionale Planungsverband München gegen die positive Beurteilung solcher Projekte durch die Regierung von Oberbayern nicht durchsetzen. Maßstab des Regionalplans ist 1: (1 Millimeter im Plan entsprechen 100 Meter in der Realität). Diese nicht flurnummernscharfe Darstellung ist gewollt. Bereiche, die für Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommen, sollen eine stärkere Entwicklung an den Schienenpersonenhaltepunkten unterstützen. Ansonsten kann jede Gemeinde im Sinn einer organischen Entwicklung planen. (Die Region München ist nach wie vor und wohl auch in den nächsten 20 Jahren eine Zuzugsregion; es geht also darum, das Wachstum zu steuern, nicht zu verhindern.) Zur Sicherung der Bodenschätze Kies und Sand, Lehm und ton und Bentonit werden Vorrangund Vorbehaltsgebiete im Regionalplan ausgewiesen, circa Hektar. herausforderungen für die regionalplanung in der region münchen: Die demographische Entwicklung mit stärkeren Zuzügen als Wegzügen erfordert anhaltenden Wohnungsbau. Insbesondere der Strukturwandel der Haushalte (mehr Einpersonenhaus- 142 WORKSHOP 4
144 Region München (14) Bevölkerungsentwicklung in % und absolut Landkreis Freising 9,2% Landkreis Landsberg am Lech 8,2% 8,687 Landkreis Fürstenfeldbruck 5,9% Landkreis Dachau 6,9% Landkreis Starnberg 4,3% Landeshauptstadt München 11,8% Landkreis München 9,4% Landkreis Erding 9,5% Landkreis Ebersberg 8,8% Legende Reihung nach %-Werten höchster Wert niedrigster Wert Quelle: Bayrisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung und eigene Berechnungen PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 11/2011 Bevölkerungsentwicklung in der Region München halte, mehr Quadratmeter je Person) benötigt etwa Wohnungen pro Jahr in der Region München. Weitere Wohnungen sind für zuziehende Bürgerinnen und Bürger erforderlich. In der Landeshauptstadt München werden in den nächsten 20 Jahren überplanbare größere Neubauflächen sehr knapp, ebenso in Gemeinden des engeren Umlands. Lösungsmöglichkeiten erarbeitet eine Arbeitsgruppe aus Kommunalpolitik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft unter Moderation des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München. WORKSHOP 4 143
145 Region München (14) Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030 Veränderung 2010 bis 2030 in % und absolut - Bevölkerung insgesamt - Landkreis Landsberg am Lech 5,6% 6,5 Tsd. Landkreis Fürstenfeldbruck 6,1% 12,6 Tsd. Landkreis Starnberg 2,5% 3,2 Tsd. Landkreis Dachau 10% 13,9 Tsd. Landeshauptstadt München 11,6% 156,7 Tsd. Landkreis Freising 8,4% 14 Tsd. Landkreis München 13,9% 44,9 Tsd. Landkreis Erding 10,9% 13,8 Tsd. Landkreis Ebersberg 9,3% 12 Tsd. Legende Reihung nach %-Werten höchster Wert niedrigster Wert Quelle: Bayrisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung und eigene Berechnungen PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 11/2011 Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung in der Region München bis Workshop 4
146 Eine wesentliche Herausforderung ist zudem das Instandhalten und der Neubau von Infrastruktur, vor allem im verkehrlichen Bereich. Die S-Bahn-Stammstrecke in München wird von dreimal so vielen Menschen täglich benutzt als projektiert ( statt ). Die Finanzierung einer zweiten Stammstrecke steht aber in den Sternen. Strukturen in der regionalen Zusammenarbeit nicht erforderlich. Notwendig ist eine immer wieder verbesserte Zusammenarbeit der regionalen Akteure. Inhalt und Karten des Regionalplans: Nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch für die Gewerbebetriebe muss weiterhin ortsplanerisch verträglich Baurecht geschaffen werden, um die wirtschaftliche Prosperität der Region zu erhalten. Nach der Föderalismusreform haben die Bundesländer die Hoheit über die Landesplanung. Bayern hat ein eigenes Vollgesetz im Verfahren. Es kommt darauf an, die planerische Arbeit der Regionalen Planungsverbände unabhängiger von staatlichen Vorgaben zu machen, die Geschäftsstellen der Regionalen Planungsverbände besser finanziell und mit eigenem Personal auszustatten und ihnen mehr Freiheit zu geben, regional in Bayern durchaus unterschiedliche themen aufzugreifen. Fazit Bei allen Diskussionen um die richtige Organisation der regionalen Ebene zeigt die klassische Regionalplanung der Region München durchaus Erfolge. Angesichts der hohen Lebensqualität und der wirtschaftlichen Stärke der Region München sind andere WORKSHOP 4 145
147 DER REGIONALE FLÄCHENNUtZUNGSPLAN Matthias Drexelius Erster Beigeordneter, Regionalverband FrankfurtRheinMain Das engere Verbandsgebiet des Regionalverbandes Frankfurt- RheinMain umfasst 75 Städte und Gemeinden mit 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Zentrale Aufgabe ist die regionale Flächennutzungsplanung; der Regionale Flächennutzungsplan ist seit dem 17. Oktober 2011 rechtskräftig. Der Verband vernetzt darüber hinaus die Metropolregion Frankfurt- RheinMain mit 5,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Themengebieten wie Kultur, Wirtschaft, Regionalentwicklung und Europa. Dabei ist die Struktur des engeren Verbandsgebietes durchaus heterogen. Es handelt sich um eine polyzentrale Struktur mit sehr vielen zentralen Orten. Man findet städtische Strukturen, zum Beispiel Frankfurt und Offenbach, aber auch sehr ländliche Bereiche.
148 aufstellungsverfahren des regionalen Flächennutzungsplans Nur 43 der 75 Städte und Gemeinden betreiben schon seit Jahrzehnten eine gemeinsame Flächennutzungsplanung. Per Gesetz kamen die restlichen 32 Kommunen im Jahre 2001 dazu und mit dem Inkrafttreten des Regionalen Flächennutzungsplanes haben die bis dahin gültigen örtlichen Flächennutzungspläne ihre Geltung verloren. Dass dies nicht in allen Orten bei jedem Beteiligten wegen befürchteter Verluste der kommunalen Selbstverwaltung auf Begeisterung gestoßen ist, kann man sich vorstellen. Auf der anderen Seite wird aber auch registriert, dass eine Planung, die nicht an den kommunalen Gemarkungsgrenzen in ihrem Denken endet und Entwicklungen auch darüber hinaus berücksichtigt für die gesamte Region Vorteile bringt. Dies ist unter anderem auch darin begründet, dass die Aufstellung des Planes mit zahlreichen Gesprächen zwischen Verband und Kommunen begleitet wurde und im Vorfeld ein intensiver Leitbildprozess stattgefunden hat, an dem viele der betroffenen Kommunen mitgewirkt haben. Dies führte zwar zu einer sehr langen Planungsdauer von acht Jahren zwischen Beginn der Leitbilddiskussion und Rechtskraft des Planes, trug aber am Ende zur breiten Akzeptanz bei. Der neue Plan stellt die Entwicklung der Region bis 2020 dar und besteht aus einer Hauptkarte, der Beikarte 1 (Kennzeichen, Vermerke und nachrichtliche Übernahmen), der Beikarte 2 (ausgewählte Inhalte des Regionalen Einzelhandelskonzeptes) sowie den textteilen (allgemeiner teil, Umweltbericht und Gemeindeteil). Die Planungsgrundlagen waren neben den geltenden Flächennutzungsplänen der Regionalplan und die Landschaftspläne, die Bevölkerungsprojektionen, die Planumweltprüfung, das erarbeitete Leitbild und natürlich besonders die Entwicklungsvorstellungen der einzelnen Kommunen. Dies musste in Übereinstimmung gebracht werden. Dabei war insbesondere die Zielvorstellung, die Neuausweisung von Siedlungsflächen an den bestehenden Verkehrsachsen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Individualverkehrs anzusiedeln, bei der Planung von erheblicher Bedeutung. Es sollte ausdrücklich die Zersiedlung, die Bildung von New towns, vermieden werden. Weiter wurden die Ziele verfolgt, die Zentren zu stärken, die Attraktivität für junge Leute und Familien zu steigern, innovative Branchen zu unterstützen, Mobilität und Logistik weiter zu entwickeln, Landschaft und Kultur zu sichern und den Standortfaktor Verkehr auszubauen und zu verbessern. Auf diesen Grundlagen entstand ein Entwurf, der der Bevölkerung und den trägern öffentlicher Belange im Plangebiet mit einem intensiven Beteiligungsangebot zur Diskussion gestellt wurde. Heraus kamen in der frühzeitigen Beteiligung Stellungnahmen, WORKSHOP 4 147
149 die in Bearbeitungseinheiten aufgegliedert wurden. Nach der öffentlichen Auslegung wurden Stellungnahmen eingereicht, aus denen Bearbeitungseinheiten entstanden. Beispielhaft für besonderen Regelungsbedarf sind dabei das Regionale Einzelhandelskonzept sowie die Siedlungsbeschränkungsbereiche durch den Internationalen Flughafen Frankfurt genannt. Der Erfolg der intensiven Beteiligung und der umfangreichen Gemeindegespräche zeigt sich zum Beispiel bei den Flächenwünschen zu Wohn- und Mischbauflächen, mit denen man in das Verfahren gegangen war. Ausgehend von den Zuwachsflächen in den rechtswirksamen Flächennutzungsplänen 2004 sowie im Regionalplan Südhessen 2000 in der Größe von rund Hektar, wuchsen diese nach den gemeindlichen Entwicklungswünschen auf rund Hektar an. Davon verblieben nach den Gemeindegesprächen und formalen Verfahrensschritten am Ende noch rund Hektar. Letztlich also eine deutliche Reduzierung der Gesamtflächen. Mit diesem Ergebnis wurde der Plan durch die Verbandskammer im Dezember 2010 verabschiedet und dem Ministerium zur Genehmigung vorgelegt. Diese wurde im Juli 2011 erteilt und nach der Veröffentlichung im Staatsanzeiger am 17. Oktober 2011 ist der Plan rechtskräftig. Im Rahmen der Genehmigung wurden die Planungen für 83 teilflächen von der Genehmigung ausgenommen und sind jetzt als unbeplante Flächen, sogenannte Weißflächen, ausgewiesen. Dabei handelt es sich bei fast allen Flächen um solche, deren Darstellungen sich nach der Offenlage und vor dem abschließenden Beschluss in ihrer Darstellung noch einmal geändert haben. Hier muss formal noch einmal die Offenlage durchgeführt werden. Insgesamt war die Menge dieser Flächen jedoch so gering, dass dies nicht zu einer Gesamtversagung der Genehmigung geführt hat. Fazit Zusammenfassend muss man feststellen, dass die Regionale Flächennutzungsplanung Sinn macht, da sie Friktionen und planerische Stringenzbrüche vermeidet, die bei rein kommunalen Planungswerken oft festzustellen sind. Auch die Kompetenzbündelung wie im Regionalverband FrankfurtRheinMain ist von Vorteil, weil diese gerade bei kleineren Kommunen im Regelfall nicht gegeben sein kann. Problematisch ist sicher der gesetzlich vorgegebene Maßstab von 1:50.000, der notwendige Detaillierungen, die für einen Flächennutzungsplan an der einen oder anderen Stelle sinnvoll und wichtig sind, nicht ermöglicht. Schwierig ist eine Planung über ein solch großes Gebiet in einer sich dynamisch entwickelnden und verändernden Region wie FrankfurtRheinMain, weil sich während des Prozesses immer wieder Änderungsnotwendigkeiten aufgrund lokaler und aktueller Entwicklungen ergeben, die dann zwangsläufig zu solchen Weißflächen führen, wie zuvor dargestellt. 148 WORKSHOP 4
150 Aus dem Verfahren genommen wurde die Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraft, da man sich nicht auf die Menge einigen und die am Ende gewünschte Menge zur Nichtgenehmigung geführt hätte. Dies nimmt Kommunen gewünschte Steuerungsoptionen. Der Erfolg des Planes wird sich erst in den kommenden Monaten und Jahren zeigen, wobei sich aber auch schon zeigt, dass er gut funktioniert, so dass eine positive Erwartungshaltung sicher nicht unbegründet ist. WORKSHOP 4 149
151 DER EINHEItLICHE REGIONAL- PLAN RHEIN-NECKAR: REGIONALPLANUNG IN DREI BUNDESLÄNDERN Christoph Trinemeier, Ltd. Direktor, Verband Region Rhein- Neckar Die Europäische Metropolregion Rhein-Neckar zählt mit knapp 2,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern auf Quadratkilometern zu den großen Ballungsräumen Deutschlands. Eines ihrer Kennzeichen ist ihre polyzentrische Siedlungsstruktur mit gleich drei Großstädten, den Oberzentren Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie über 287 Mittelstädten und kleineren Kommunen. Die regionale Kooperation über die Grenzen der drei Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz hinweg hat bereits eine über 50-jährige Geschichte im Rhein-Neckar- Dreieck: Die Metropolregion Rhein-Neckar versteht sich als Modellregion für kooperativen Föderalismus.
152 staatsvertrag über die zusammenarbeit bei der raumordnung und Weiterentwicklung im rheinneckar-gebiet Am 26. Juli 2005 wurde von den Ministerpräsidenten der drei Bundesländer der Staatsvertrag über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet unterzeichnet. Durch den Vertrag wurde der Verband Region Rhein-Neckar zum 1. Januar 2006 Rechtsnachfolger des Regionalverbandes Rhein- Neckar-Odenwald, der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz und des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar. Statt des rahmensetzenden Raumordnungsplanes Rhein- Neckar sowie der jeweiligen Regionalpläne in den drei teilregionen wird es nach dem Staatsvertrag künftig nur noch den Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar als verbindlichen regionalen Raumordnungsplan geben, wobei der Regionalplan für den hessischen Landkreis Bergstraße zunächst als Planentwurf gilt, der die Zustimmung der Regionalversammlung Südhessen benötigt. Der genannte Staatsvertrag hat zudem die Kompetenzen des Verbandes auch über die Zuständigkeit für die regionalplanerische Gesamtentwicklung in der Metropolregion hinaus im Bereich umsetzungsorientierter trägerschafts- und Koordinationsaufgaben bei regionalbedeutsamen Aufgaben deutlich erweitert. besonderheiten des einheitlichen regionalplans rhein-neckar Als besondere Herausforderung bei der Aufstellung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar hat sich die Koordination und Harmonisierung der unterschiedlichen rechtlichen und planerischen Vorgaben in den drei Bundesländern erwiesen. Am Beispiel der sehr unterschiedlichen landes- und regionalplanerischen Rahmenbedingungen zur Steuerung der künftigen Siedlungsentwicklung oder aktuell bei den länderspezifischen Vorstellungen zum Ausbau der Windenergienutzung wird deutlich, welch schwierige Koordinationsaufgaben bei der Aufstellung des Einheitlichen Regionalplans zu bewältigen sind. Unterstützung dabei erfährt der Verband durch die gemäß Artikel 13 des Staatsvertrages aus Vertretern der zuständigen Ministerien in den drei Bundesländern gebildete Raumordnungskommission. Deren zentrale Aufgabe besteht in der Abstimmung der für eine gemeinsame Entwicklung des Rhein-Neckar-Raumes vorgegebenen Ziele, insbesondere in den jeweiligen Landesentwicklungsplänen. Nach Artikel 13 Absatz 2 kann die Raumordnungskommission schließlich über Form und Inhalt des Einheitlichen Regionalplans Weisungen erteilen. In dem umfangreichen Prozess der Regionalplanaufstellung sind länderübergreife Konsenslösungen inhaltlich und (verfahrens-)rechtlich auch deshalb zwingend erforderlich, da für die laut Staatsvertrag von der Obersten Landesplanungsbehörde Baden- Württemberg zu erteilende Genehmigung das Einvernehmen mit der zuständigen Landesbehörde in Rheinland-Pfalz notwendig ist. WORKSHOP 4 151
153 ausblick und Fazit Die Verwaltung des Verbandes Region Rhein-Neckar hat im Herbst 2011 den Entwurf des Einheitlichen Regionalplans für die Durchführung des Beteiligungsverfahrens in den zuständigen Gremien vorgestellt. In der Sitzung der Verbandsversammlung am 28. Oktober 2011 wurde einstimmig die baldmögliche Einleitung dieses Verfahrensschrittes beschlossen. Vertreter aller politischen Fraktionen haben nicht nur die Bedeutung des Einheitlichen Regionalplans als gesetzliche Kernaufgabe hervorgehoben, sondern sehen darin auch ein Schlüsselprojekt zur weiteren Integration der den drei Bundesländern zugehörigen teilräume innerhalb der Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. 152 WORKSHOP 4
154 PLENUMSDISKUSSION Moderation: Prof. Dr. Axel Priebs, Region Hannover regionaler Flächennutzungsplan als neues management- und entwicklungsinstrument Der Regionale Flächennutzungsplan stößt auf großes Interesse der teilnehmerinnen und teilnehmer. Er wird als innovativer Lösungsansatz eingeschätzt, um Regionalpläne als Management- und Entwicklungsinstrument zu verbessern. Auf diese Weise stehen beide Planungsinstrumente (Regional- und Flächennutzungsplan) zur Verfügung. Das Beispiel des Regionalen Flächennutzungsplans der Region FrankfurtRheinMain lässt vermuten, dass dieses Instrument insbesondere für polyzentrische Regionen geeignet ist. In monozentrischen Regionen wie zum Beispiel der Region München könne eine Machtverlagerung zugunsten der Umlandkommunen die Folge sein; das Zentrum könne in wichtigen Belangen wie beispielsweise der Flächenentwicklung von den kleineren Umlandkommunen überstimmt werden, befürchtet Verbandsdirektor Christian Breu vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München. In der Region FrankfurtRheinMain habe es anfangs ebenfalls diese Befürchtungen gegeben, die sich in der Praxis allerdings nicht bestätigt haben, erwidert Matthias Drexelius, Erster Beigeordneter des Regionalverbands FrankfurtRheinMain. Wie erfolgreich der regionale Flächennutzungsplan der Region Frankfurt- RheinMain wirklich sein werde, müsse sich noch zeigen. Interessant sei zum Beispiel, wie zukünftig Änderungsverfahren ablaufen. Derzeit liegen bereits 45 Anträge auf Änderungen vor, obwohl der Plan erst in den kommenden tagen rechtsgültig wird. Viele Verbandskommunen hätten jedoch die Vorteile der regionalen Zusammenarbeit und Planung schätzen gelernt, so dass eine positive Erwartungshaltung sicher nicht unbegründet sei. kooperativer planerstellungsprozess als impulsgeber Der gemeinsame Planerstellungsprozess und die daraus resultierende enge Zusammenarbeit zwischen dem Regionalplanungsträger und den Kommunen haben sich insbesondere in den Regionen Rhein- Neckar und FrankfurtRheinMain als sehr vorteilhaft erwiesen. Der Regionalverband FrankfurtRheinMain hat zum Beispiel im Rahmen vieler Abstimmungsgespräche mit den Kommunen einen produktiven Diskurs über die wünschenswerte Entwicklung der Region geführt. Zu- PLENUMSDISKUSSION 153
155 dem ist im Rahmen der Aufstellung des regionalen Flächennutzungsplans die Frage nach der Notwendigkeit weiterer Wohnbebauung aufgekommen. Dies war zuvor in der Region kein thema. Daraus resultiert, dass der Regionalverband FrankfurtRheinMain nun das thema Innenentwicklung bearbeitet und mit den Akteuren der Region diskutiert. Der Erstellungsprozess des gemeinsamen Entwicklungsplans der Region Kassel sei hingegen als weniger erfolgreich anzusehen, so Andreas Vesper vom Zweckverband Raum Kassel. Der Verzicht auf die Leitbild-Diskussion erweise sich als Mangel: Eine umfassende grenzüberschreitende Konzeption existiert nicht. Hier spielen daher die informellen Entwicklungsplanungen wie zum Beispiel das Siedlungsrahmenkonzept und der Entwicklungsplan zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach wie vor eine große Rolle. praxis der regionalplanung am beispiel erneuerbare energien Christoph trinemeier vom Verband Region Rhein- Neckar sieht den Regionalplan als geeignete Ebene an, die Windenergie, aber auch den Verlauf von Energietrassen zu steuern. Bei den Energietrassen liegen die Zuständigkeiten derzeit bei anderen Instanzen, geeignete Instrumente zur Steuerung müssten erst entwickelt werden. Bei der Windenergie haben sich in den vergangenen zwei bis drei Jahren die Sichtweisen in den drei beteiligten Bundesländern geändert: Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Steuerung auf regionaler Ebene im Vergleich zu lokalen Vorhaben zu sinnvolleren Lösungen für die Versorgung mit Windenergie führen kann, so dass die Akzeptanz vor Ort erhöht wird. Voraussetzung dafür ist die enge Zusammenarbeit mit den Kommunen bei der Erarbeitung von Inhalten und Vorgaben. Der Regionalplan München bearbeitet die themen Windenergie und Photovoltaik. Weiter gehende Aktivitäten des Planungsverbands München im Bereich erneuerbare Energien sind aufgrund der geringen personellen und finanziellen Ausstattung nicht möglich. Die Kommunen in der Region München haben allerdings, teilweise im Rahmen von interkommunalen Kooperationen, sehr gute Ansätze und Konzepte entwickelt, so dass eine Steuerung durch die Regionalplanung nicht zwingend erforderlich ist. Die Regionalplanung nimmt deshalb eine beratende Funktion ein. schlussfolgerungen aus den vorgestellten projekten Die vorgestellten Instrumente und Vorgehensweisen der Regionalplanung sind als effektiv zu bewerten. Die Regionalplanungsträger können mit ihrer Hilfe beispielsweise auf neue Herausforderungen in der Flächenentwicklung reagieren und diese steuern. Auch begrüßen die teilnehmerinnen und teilnehmer, dass die interkommunale Kooperation im Rahmen der präsentierten Projekte gestärkt wird. Die enge Zusammenarbeit hat sich bei der Aufstellung der Pläne als vorteilhaft und unverzichtbar erwiesen. 154 PLENUMSDISKUSSION
156 Workshop 5: StADtREGIONEN OHNE GRENZEN
157 StADtREGIONEN OHNE GRENZEN DAS BEISPIEL BREMEN Dr. Ralph Baumheier, Senatsrat, Freie Hansestadt Bremen Bremen ist keine Insel, sondern als traditionsreicher Stadtstaat vielfältig und eng mit der umgebenden niedersächsischen Region verbunden. Die Bedeutung, die Bremen dem Thema regionale Kooperation beimisst, wird auch im neuen Leitbild der Stadtentwicklung deutlich, das der Senat 2009 als gemeinsamen Orientierungsrahmen beschlossen hat. Sowohl auf der generellen Zielebene als auch auf der Ebene der integrativen Handlungsfelder des Leitbildes sowie bei den konkret benannten Zielen des Senats findet sich die regionale Kooperation prominent vertreten: Bremen will (auf der generellen Zielebene) eine Stadt in guter Nachbarschaft mit der Region sein, definiert hierzu eines von acht integrativen Handlungsfeldern des Leitbildes und benennt folgende zwei konkrete Zielvorstellungen:
158 bremen will bis zum Jahr 2020 gemeinsam mit den niedersächsischen Partnern den Kommunalverbund Niedersachsen/ Bremen zu einer belastbaren Plattform regionaler Planung weiterentwickelt haben; gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten den Spitzenplatz in der Entwicklung innovativer Anpassungsstrategien an den Klimawandel erreichen belegt durch die erste verbindlich beschlossene regionale Umsetzungsstrategie. In diesen beiden Zielsetzungen wird zugleich die doppelte Regionskulisse deutlich, in der Bremen regionale Kooperation betreibt: der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen für die engere Stadtregion, die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten für den größeren Nordwestraum. Welche Ziele verfolgen diese beiden regionalen Kooperationen, worin unterscheiden sie sich? insbesondere auch über die Einzelhandelsentwicklung prägen das Aufgabenspektrum des Kommunalverbundes. Wichtigste Grundlage ist das gemeinsam erarbeitete und von allen beteiligten Gemeinden und Landkreisen als Orientierungsrahmen beschlossene Interkommunale Raumstrukturkonzept Region Bremen (intra). Derartige planerische Aufgabenstellungen wiederum sind auf der Ebene der Metropolregion kaum anzutreffen, hier geht es prioritär um strukturpolitische Fragen mit einem deutlichen Fokus auf wirtschaftliche und wissenschaftliche Aspekte. Die beiden regionalen Ebenen unterscheiden sich zudem hinsichtlich ihrer Akteure. Der Kommunalverbund ist ein eingetragener Verein, der ausschließlich aus kommunalen Gebietskörperschaften besteht, überwiegend kreisangehörige Städte und Gemeinden, Delmenhorst und die Stadtgemeinde Bremen als kreisfreie Städte sowie der Landkreis Oldenburg als assoziiertes Mitglied. Ein schon genanntes Unterscheidungskriterium besteht in dem unterschiedlichen Raumbezug, der auch unmittelbar auf die unterschiedliche Hauptaufgabenstellung verweist. Das themenfeld der konkreten planerischen Zusammenarbeit in einem Verflechtungsraum, die interkommunale Abstimmung über Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrsentwicklung sowie WORKSHOP 5 157
159 158 WORKSHOP 5
160 Die Metropolregion hat eine deutlich breitere und differenziertere Mitgliederstruktur: Auf der Seite der Gebietskörperschaften gehören dazu die beiden Länder Niedersachsen und Bremen, mittlerweile elf Landkreise sowie die fünf kreisfreien Städte Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst, Oldenburg und Wilhelmshaven. Mit gleichem Gesamtstimmgewicht und gleichem Finanzierungsanteil wie die kommunale Seite ist die regionale Wirtschaft in die Metropolregion eingebunden, repräsentiert durch die Industrie- und Handelskammern. Ergänzt wird die Akteursstruktur der Metropolregion durch den Metropolbeirat, in dem insbesondere die Spitzen der regionalen Hochschullandschaft sowie weitere regional bedeutsame Institutionen vertreten sind, sowie durch den Parlamentarischen Beirat, in dem je fünf Abgeordnete der beiden Landtage die Anbindung an die Landespolitik gewährleisten. Insgesamt also ein breitgefächertes und dadurch auch repräsentatives Bild der Region, das sich in den Gremien der Metropolregion wiederfindet. Eine bundesweite Besonderheit und insofern ein Alleinstellungsmerkmal der Metropole Nordwest ist die unmittelbare und gleichberechtigte Einbindung der regionalen Wirtschaft in die Entscheidungsstrukturen der Metropolregion. Die breite Akteursbeteiligung von kommunalen Gebietskörperschaften, den beiden Ländern, den Hochschulen und Universitäten sowie eben der regionalen Wirtschaft hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Metropolregion (gemeinsam mit weiteren Konsortialpartnern aus der Region) erfolgreich aus dem KLIMZUG-Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums hervorgegangen ist: Mit dem mehrjährigen Verbundforschungsvorhaben Nordwest 2050 hat sich die Metropolregion dem ehrgeizigen Ziel verschrieben, eine belastbare roadmap of change, eine regionale Anpassungsstrategie an den Klimawandel, zu erarbeiten und umzusetzen. Ein Ziel, dem sich Bremen als Partner in der Region, bereits mit der Berücksichtigung im Leitbild der Stadtentwicklung konkret verpflichtet fühlt. WORKSHOP 5 159
161 GEMEINSCHAFtLICHE REGIONALENtWICKLUNG IN DER MetROPOLREGION RHEIN-NECKAR Ralph Schlusche, Verbandsdirektor Verband Region Rhein- Neckar Die gemeinschaftliche Regionalentwicklung in der Metropolregion Rhein-Neckar folgt in allen Handlungsfeldern einer strategisch abgestimmten Ausrichtung, der Vision Die Metropolregion Rhein-Neckar hat sich darin zum Ziel gesetzt, im Jahre 2025 als eine der attraktivsten und wettbewerbsfähigsten Regionen in Europa bekannt und anerkannt zu sein.
162 Zur erfolgreichen Umsetzung dieser Vision hat Rhein- Neckar ein besonderes Modell der regionalen Zusammenarbeit entwickelt, das auf eine sechzig Jahre andauernde tradition gemeinsamer Regionalentwicklung aufbaut. Dieses Regional-Governance-Modell ruht wesentlich auf drei Säulen: dem Verband Region Rhein- Neckar, dem Verein Zukunft Metropolregion Rhein- Neckar e.v. und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. der verband region rhein-neckar Der Verband Region Rhein-Neckar ist das demokratisch legitimierte Organ und das politische Rückgrat der gemeinschaftlichen Regionalentwicklung. Die politische Willensbildung des Verbandes findet in der Verbandsversammlung statt (Vorsitz Dr. Eva Lohse, Oberbürgermeisterin Ludwigshafen). Die Verbandsversammlung ist oberstes Entscheidungsgremium der Region. Sie besteht aus 95 Mitgliedern, die von den Parlamenten der Stadtkreise beziehungsweise kreisfreien Städte und den Landkreisen abgesandt werden, wobei die Landrätinnen und Landräte sowie Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister jeweils sogenannte geborene Mitglieder sind. An der Spitze der Verwaltung des Verbands mit circa 30 Mitarbeitern steht der Verbandsdirektor. Er ist gleichzeitig einer der beiden Geschäftsführer der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Verbandes Region Rhein-Neckar ist, dass sich sein politisches Mandatsgebiet mit der räumlichen Abgrenzung der Metropolregion Rhein-Neckar deckt. Diese Deckungsgleichheit stellt einen entscheidenden Vorteil in den Prozessen der Regionalentwicklung dar, weil alle Entscheidungen der operativen Ebene im politischen Willen der gesamten Region rückgespiegelt werden können. Auf diese Weise wird eine regionale Identität geschaffen, die zugleich das Engagement aller regionalen Kräfte in der Metropolregion bündelt. Der Verband ist einerseits träger der Regionalplanung (staatliche Pflichtaufgabe). Darüber hinaus nimmt der Verband weitere Aufgaben der Regionalentwicklung und des Regionalmanagements nach dem Staatsvertrag über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet wahr. Dem Verband Region Rhein-Neckar sind unter anderem die Aufgabenfelder Wirtschaftsförderung und Standortmarketing, Koordinierung der Energieversorgung auf der Grundlage von Regionalen Energiekonzepten sowie die Erarbeitung des Regionalparks Rhein-Neckar zugewiesen. der verein zukunft metropolregion rhein-neckar e.v. Der eingetragene Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.v. ist mit über 700 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, einem hochkarätig besetzten Vorstand und einem Kuratorium WORKSHOP 5 161
163 die Plattform für den strategischen Dialog in der Metropolregion Rhein-Neckar. Er unterstützt die Region beim Aufbau einer eigenen Identität und beim Nutzen ihrer Potenziale. Im Vorstand des Vereins sind hochrangige Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vertreten. Sie verstehen sich als thementreiber und Ideengeber und führen gemeinsam den stetigen strategisch-regionalen Dialog: Man spricht miteinander nicht übereinander! Unter dem Dach des Vereins werden so die regionale Zusammenarbeit gestärkt und regionale Initiativen ideell und finanziell gefördert. Mit ihrer Mitgliedschaft im Verein werden kleine, mittlere oder große Unternehmen, Freiberuflerinnen und Freiberufler, Stadtverwaltungen, Bürgermeisterämter, Zweckverbände und weitere Akteure teil eines aktiven regionalen Netzwerks mit einer Vielzahl von Initiativen, Arbeits- und Expertengruppen und Kompetenzzentren. Die Breite von regionalen Netzwerkaktivitäten lässt erkennen, welches Potenzial und welche Synergieeffekte hinter diesen Verknüpfungen unterschiedlichster Akteure in vielfältigen Branchen und themengebieten stecken. 162 WORKSHOP 5
164 die metropolregion rhein-neckar gmbh Die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH ist als dritte Säule die operative Plattform der gemeinschaftlichen Regionalentwicklung in der Region. Sie setzt regionale Initiativen und Projekte in eigener trägerschaft um, sie koordiniert zudem Projekte anderer träger, bindet regionale Netzwerke ein und betreibt die Öffentlichkeitsarbeit für die Metropolregion insgesamt. Schwerpunkte der Projektarbeit der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH liegen derzeit vor allem in den themenfeldern Arbeitsmarkt, Standortmarketing, Cluster-management und E-Government. Die Projektarbeit der GmbH gestaltet sich dabei nach einem besonderen Prinzip: Jede einzelne Projektidee wird in einen sogenannten Steckbrief überführt. Dies erleichtert die Suche nach potenziellen Partnern und Sponsoren. Findet sich ein Interessent, der sich mit der Projektidee identifizieren kann, so wird ein individuelles Projektkonzept ausgearbeitet, das Projekt also gleichsam auf ihn maßgeschneidert. Auf diese Weise kann jeder Akteur seinen ganz individuellen und aktiven Beitrag zum Vorankommen der Region leisten ob durch die Zurverfügungstellung von Sachwerten, Personal oder durch das klassische finanzielle Sponsoring. Ein eindrucksvoller Beweis für das Kommittent der regionalen Akteure ist die Zusammensetzung der Mitarbeiter der GmbH selbst: Viele der dort beschäftigten Kolleginnen und Kollegen wurden von den großen Unternehmen der Region für eine bestimmte Zeit in die GmbH abgeordnet, um dort an bestimmten Projekten mitzuarbeiten und ihr Know-how für die gemeinschaftliche Regionalentwicklung zur Verfügung zu stellen. WORKSHOP 5 163
165 EURODIStRICt SAARMoselle DIE ANDERE MetROPOLREGION Peter Gillo, Regionalverbandsdirektor Saarbrücken Metropolregionen zeichnen sich durch eine räumliche Nähe mehrerer Großstädte, einer hohen Bevölkerungsdichte, einem außergewöhnlichen Wachstum, einer positiven Arbeitsplatzentwicklung sowie letztlich durch vielfältige politische, soziale und kulturelle Interaktionen aus. So prägen Metropolregionen als dynamische Zentren einen Gesamtraum, fördern die Standortbedingungen für Wohnen und Arbeit und steigern in vielfältiger Weise die Lebensqualität. Die deutschen Metropolregionen definieren nahezu ausschließlich Kooperationsräume im Inneren der Republik; die Randlagen entlang der nationalen Grenzen werden von diesem raumordnerischen Leitbild nur in wenigen Ausnahmen umfasst. So droht speziell den deutschen, aber durchaus auch weiteren europäischen Grenzräumen, von wesentlichen Entwicklungsdynamiken abgeschnitten zu werden. Die Gefahr nachhaltiger Raumdisparitäten in einem zusammenwachsenden Europa ist spätestens dann virulent.
166 Aber bieten nicht gerade die Randlagen dank ihrer spezifischen Charakteristika ebenfalls Lebensqualitäten, Wachstums- und Entwicklungspotenziale, mit denen sie sich dem Wettbewerb um Standortfaktoren, Wirtschaftskraft und somit um Arbeits- und Wohnbevölkerung stellen? Eingebunden in facettenreiche und wertvolle Kooperationen auf Ebene der Großregion SaarLorLux, dem Städtenetzwerk Luxemburg, trier, Metz und Saarbrücken (sogenannte QuattroPole) sowie dem kleinräumigeren Eurodistrict SaarMoselle werden innovative Ideen zur Zukunftsgestaltung entwickelt, an synergetischen Kooperationsprozessen in Forschung und Entwicklung gearbeitet oder Akzente in der Wahrnehmung als Wirtschaftsstandort zwischen den Metropolen Paris und FrankfurtRheinMain gesetzt. Deutlich wird dies nicht zuletzt anhand immenser Grenzgängerbewegungen zwischen den Städten und Staaten, anhand unmittelbarer und mittelbarer Waren- und Dienstleistungsströme oder anhand bedeutender Industrie-Cluster wie insbesondere im Stahlund Automotive-Segment. So betrachtet können auch kleinere Verflechtungsräume unterhalb der deutschen und europäischen Metropolregionen wichtige Funktionen für die Fortentwicklung von Lebens- und Arbeitsräumen übernehmen. Der immer mehr an Fahrt aufnehmende Eurodistrict SaarMoselle kann mit seinem grenzüberschreitenden Kontext einerseits eine wichtige Plattform für gesellschaftliche, kulturelle und politische Zusammenarbeit bieten, andererseits aber auch Motor für Innovationen und wirtschaftliche Kooperationen sein. Insbesondere die gegenwärtigen Arbeiten zur Entwicklung des grenzüberschreitenden Wirtschaftsraumes SaarMoselle ernten dabei besonderes Interesse. Derzeit entstehen unter anderem eine Marketing- Broschüre und eine digitale Gewerbeflächenkarte mit Angaben zu disponiblen Bauflächen oder etwa leerstehenden Gewerbehallen. Das grenzüberschreitende Industrie- und Gewerbegebiet Eurozone Saarbrücken- Forbach ist bereits in Betrieb, die Flächen gefüllt. Als besonderes Highlight darf die Produktion des ersten Image-Filmes für den Eurodistrict in Kooperation mit der Air France gewürdigt werden. Der international anerkannte Konzern zeichnet sich für die Erstellung eines kurzweiligen Spots über den grenzüberschreitenden Lebens- und Wirtschaftsraum verantwortlich. Nach der Fertigstellung im Herbst 2011 wird der Image-Film ein halbes Jahr lang auf allen Überseeflügen der Air France ausgestrahlt werden. Der kleinräumige Eurodistrict kann selbst nicht den Charakter einer eigenständigen Metropolregion einnehmen. Aber die neue Kooperationsform kann als Nukleus eines größeren grenzüberschreitenden Verflechtungsraums gemeinsam mit QuattroPole und Großregion wichtige Impulse für die Zukunftsfähigkeit der Region leisten. WORKSHOP 5 165
167 Denn gerade für Regionen in national isolierter Randlage wird es künftig stärker darum gehen, über bi- oder trinationale Kooperationen Aufmerksamkeit zu erregen und sich ein eigenständiges Profil zu erarbeiten. Ansonsten laufen sie über kurz oder lang Gefahr, dass sie im Hinblick auf wirtschaftliche und demografische Entwicklungen vollends hinter den Spitzenregionen Deutschlands und Frankreichs abfallen. Dies bedarf in einer Region in Randlage sehr viel stärker der Bündelung der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Kräfte, als es in den ohnehin prosperierenden Wachstumszentren der Fall ist. Weitere Informationen zum Eurodistricts SaarMoselle unter Großregion SaarLorLux mit dem Städtenetzwerk QuattroPole und dem Eurodistrict SaarMoselle; Quelle: La Grande Région, eigene Bearbeitung Großregion SaarLorLux Deutschsprachige Gemeinschaft Belgien Wallonie Rheinland-Pfalz Luxemburg QuattroPole Lu/Trier/Metz/SB Saarland Lothringen Eurodistrict SaarMoselle 166 WORKSHOP 5
168 4,685 (D) Wallonie GD Belgien 144 RLP; 47 Saar (D) ,464 (B) (F) Luxembourg 45 Rheinland-Pfalz Saarland env. 130 (B) ca. 200 ca (F) (F) Lorraine env. 120 Grenzgängerströme in der Großregion als Merkmal dynamischer Interdependenzen zwischen den einzelnen Wirtschaftszentren; Quelle: BBSR Bund Workshop 5 167
169 AG CHARLEMAGNE NEUE PERSPEKtIVEN DER GRENZ- ÜBERSCHREItENDEN Zu- SAMMENARBEIt IN DER EUREGIO MAAS-RHEIN Markus Terodde, StädteRegion Aachen Die StädteRegion Aachen, die Parkstad Limburg und die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens bilden innerhalb der Euregio Maas-Rhein einen kompakten grenzüberschreitenden Verflechtungsraum mit rund Einwohnerinnen und Einwohnern. Die drei Gemeindeverbände stehen für innovative interkommunale Kooperation. Neben der Bündelungsfunktion für ihre Kommunen arbeiten sie seit Jahren an einer modellhaften grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene. Sie bauen hierbei auf der bewährten projektorientierten Kooperation im Rahmen der Euregionale 2008 auf.
170 Vor diesem Hintergrund haben die Parkstad Limburg und die StädteRegion Aachen Mitte 2007 in Amsterdam eine strategische Allianz mit definierten themenfeldern und konkreten Projekten vereinbart. Vorzeigbare Ergebnisse dieser Allianz sind etwa die gemeinsamen Auftritte auf den Immobilienmessen EXPOReal und Provada, die grenzüberschreitend etablierten Schultheatertage oder das Engagement für den Ausbau der Euregiobahn sowie die anstehende IC-Verbindung Aachen-Heerlen-Amsterdam. Mit Blick auf die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens gibt es gerade im touristischen Sektor aktuelle Beispiele ertragreicher Kooperationen: So etwa die seit 2001 bestehende europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) im Bereich des Eifel-Ardennen Marketings, deren erfolgreiche Arbeit nicht zuletzt den Ausschlag gegeben hat, dass sich die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens seit Ende 2008 an der Zukunftsinitiative Eifel beteiligt. Weitere qualitative Schritte markieren der Beitritt in die vogelsang ip ggmbh im Jahre 2009 und das INtERREG-Projekt RAVEL. Hier setzt die AG Charlemagne an. Sie soll im Kernraum der Dreiländerregion die strategische Handlungsebene der Euregio Maas-Rhein ergänzen, die grenzüberschreitende interkommunale Kooperation intensivieren und ein wahrnehmbares politisches Zeichen setzen. Die Entwicklungsziele der AG Charlemagne orientieren sich einerseits an den jeweiligen kommunalen Leitbildern und andererseits am Entwicklungsplan der Europäischen Metropolregion mit Konzentration auf die themenfelder räumliche Entwicklung/ Infrastruktur, Bildung/Arbeitsmarkt und Kultur/ tourismus/marketing. Diesen besonderen Chancen einer kommunal geprägten grenzüberschreitenden Raum- und Strukturentwicklung stehen allerdings organisatorisch-administrative Hemmnisse gegenüber. Eine zukunftsfähige Entwicklung erfordert daher verbindliche interkommunale Strukturen über die Grenzen hinweg, um die zahlreichen Maßnahmen und Aufgaben effektiv bündeln, eine dauerhafte politische Handlungsebene schaffen und abgestimmte Entwicklungsziele definieren zu können. WORKSHOP 5 169
171 PLENUMSDISKUSSION Moderation: Barbara thiel, Region Hannover großes engagement der Wirtschaft in der region rhein-neckar Oftmals bestehe bei der interkommunalen Zusammenarbeit die Schwierigkeit, die Wirtschaft zu aktivieren, führt Prof. Dr. Dietrich Fürst aus. Daher sei es bemerkenswert, dass sich weltweit führende Firmen wie zum Beispiel BASF und SAP sehr stark in der Metropolregion Rhein-Neckar engagieren. Der Grund dafür liege unter anderem im gemeinsamen Standortmarketing, erläutert Verbandsdirektor Ralph Schlusche vom Verband Region Rhein-Neckar. Die Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar liegen in Städten, die im Vergleich zu München und Berlin international kaum bekannt sind. Die Unternehmen haben erkannt, dass die Region als Ganzes dargestellt werden muss, um ein attraktiver Arbeitsund Wohnstandort zu sein und so Hochqualifizierte anwerben zu können: Heidelberg punktet beispielsweise als Schul- und Hochschulstandort, Mannheim steuert ein attraktives kulturelles Angebot bei und 170 PLENUMSDISKUSSION
172 der Pfälzer Wald bietet gut erreichbare Naherholungsmöglichkeiten. Die Metropolregion biete nach Ansicht von Verbandsdirektor Ralph Schlusche ein gut geeignetes Dach, um die Vorteile der Region zu vermarkten. Plattform für den strategischen Dialog in der Metropolregion Rhein- Neckar ist der Verein Zukunft-Metropolregion Rhein- Neckar, in dem zahlreiche Unternehmen Mitglied sind. Im Rahmen dieser Kooperation sind die Unternehmen neben dem thema Standortmarketing an themen wie Fach- und Führungskräfte sowie Infrastruktur- und Straßenbaumaßnahmen interessiert. PLENUMSDISKUSSION 171
173 StADtREGIONALE ORGANISAtIONEN HEUte UND MORGEN Prof. Dr. Axel Priebs, Erster Regionsrat, Region Hannover In seinem Eingangsreferat hatte Prof. Dr. Rainer Danielzyk die wesentlichen Kooperations- und Organisationsformen dargestellt und aufgezeigt, dass sich deren Spektrum von weichen (informellen) Kooperationen über verschiedene Formen von Zweck- und Regionalverbänden bis zu den Regionalkreisen als regionale Gebietskörperschaften erstreckt. Deutlich wurde, dass die einzelnen Stadtregionen für sich sehr unterschiedliche Formen des Umgangs mit den übergemeindlichen Herausforderungen gefunden haben. Ergänzend soll hier noch einmal deutlich hervorgehoben werden, dass es in den letzten zehn Jahren viel Bewegung auf stadtregionaler Ebene gegeben hat, wodurch in einigen Regionen sehr positive Entwicklungen möglich wurden (vergleiche Priebs 2010). Zum Abschluss der Fachtagung soll mit dem folgenden Beitrag der Blick in die Zukunft gerichtet werden.
174 Im Mittelpunkt stehen die Fragen: welche möglichen Optionen der organisatorischen Weiterentwicklung der Stadtregionen erkennbar sind, wo die Vor- und Nachteile der jeweiligen Organisationsmodelle liegen und Modell des im Jahr 1994 gebildeten Verbandes Region Stuttgart. Charakteristisch für die Struktur in der Region Stuttgart ist ein dreistufiger Aufbau mit den Gemeinden, den Landkreisen und dem Verband Region Stuttgart, wobei im Bereich der kreisfreien Kernstadt nur eine zweistufige Struktur besteht, wie die Möglichkeiten zu ihrer Realisierbarkeit einzuschätzen sind. eine direkt gewählte Regionalversammlung als Vertretungskörperschaft des Verbandes und Die Überlegungen konzentrieren sich dabei auf formelle Organisationsstrukturen und beginnen mit den Möglichkeiten der Weiterentwicklung von Verbandsstrukturen. Im Anschluss daran wird der Regionalkreis zuerst als mögliche Entwicklungsperspektive für Verbandsstrukturen diskutiert, bevor anschließend auch unterschiedliche Optionen für die mögliche Optimierung des Regionalkreises selbst erörtert werden. Sodann wird (mit Blick auf die jüngere Entwicklung im Großraum London) das Modell Stadtregion als Holding diskutiert, bevor abschließend (mit Blick auf Berlin) das Modell der Regionalstadt mit starken Stadtbezirken diskutiert wird, wie sie dort schon im Jahr 1920 gebildet wurde. modell Weiterentwicklung von verbandsstrukturen Wenn es um die Weiterentwicklung der klassischen Planungsverbände geht, denen ausschließlich die Aufgabe der Regionalplanung übertragen wurde, empfiehlt sich grundsätzlich eine Orientierung an dem die Verantwortung des Verbandes für einige regionale Kernaufgaben, nämlich die Regionalplanung, die trägerschaft des S-Bahn-Verkehrs, die Wirtschaftsförderung sowie die Freiraumgestaltung. Dieses für den Verband Region Stuttgart genannte Aufgabenspektrum eines Regionalverbandes könnte durch weitere regionale trägerschaftsaufgaben der Kreisebene etwa im Bereich der Berufsschulen oder der öffentlichen Krankenhäuser ergänzt werden. Zu den Vorteilen eines solchen Organisationsmodells gehören insbesondere die Bündelung wesentlicher stadtregionaler Aufgaben und der überzeugende Außenauftritt der Stadtregion. Dabei sorgt die regionale Politikebene mit Direktwahl für eine starke Legitimierung und eine breite örtliche wie auch politische Verankerung der stadtregionalen Entscheidungsebene. AUSBLICK 173
175 Bei den Nachteilen dieses Organisationsmodells ist an erster Stelle die institutionelle und daher auch politische Konkurrenz zwischen den Landkreisen und dem regionalen Verband zu nennen. Beispielsweise wehren sich in der Region Stuttgart die Landkreise seit langem gegen die von der Sache her unzweifelhaft sinnvolle Übertragung zusätzlicher Aufgaben etwa im Busverkehr auf den Verband, weswegen dieser bis heute keine umfassende Kompetenz für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr bekommen hat. Diese Konkurrenz ist auch der Grund dafür, warum auf einen Verband immer nur eine begrenzte Zahl stadtregionaler Aufgaben übertragen werden kann je mehr originäre Kreisaufgaben übertragen werden, desto stärker fühlen sich die beteiligten Landkreise in ihren Kompetenzen ausgehöhlt. In der Folge leisten die Landkreise in der Regel starken, weil grundsätzlich motivierten Widerstand gegen solche Überlegungen. Während als Kritik an einem Verbandsmodell häufig angeführt wird, es werde eine zusätzliche Verwaltungsebene geschaffen, ist andererseits auch festzuhalten, dass regionale Verbände nur denjenigen teil der regionalen Dienstleistungen aus einer Hand anbieten können, der unzweifelhaft für die gesamte Stadtregion wahrgenommen werden muss, um damit einen regionalen Mehrwert zu erzielen. Eine Einschätzung der Realisierbarkeit eines solchen Modells führt zu dem Ergebnis, dass die Weiterentwicklung eines einfachen regionalen Planungsverbandes zu einem mehrdimensionalen Regionalverband möglich ist, sofern der entsprechende politische Willen sowohl in der Region selbst als auch auf Landesebene vorhanden ist. Allerdings dürfte auch diese relative Optimierung stadtregionaler Verbandsstrukturen in vielen Regionen mit einem nicht zu unterschätzenden Kraftaufwand verbunden sein. modell regionalkreis Das Modell geht als Grundprinzip von einer kreisähnlichen gebietskörperschaftlichen Struktur aus, wie sie in den Regionen Saarbrücken, Hannover und Aachen etabliert ist. In diesen Regionen wurde die ansonsten übliche Struktur auf Kreisebene durch eine institutionelle Integration der Kernstädte bei gleichzeitiger Auflösung der Umlandkreise abgelöst. Der Regionalkreis übernimmt deswegen für die Stadtregion (fast) alle Kreisfunktionen, kann aber auch weitere Aufgaben (zum Beispiel wie in der Region Hannover die Aufgabenträgerschaft für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr oder den Zoo als regional bedeutsame Erholungseinrichtung) übernehmen. Der Vorteil des Modells besteht in der Bündelung sämtlicher stadtregionaler Kompetenzen. Synergien entstehen durch die Zusammenlegung sämtlicher Kreisfunktionen für Kernstadt und Umland. Eine starke stadtregionale Politikebene sorgt für eine eindeutige Legitimation, die klare Zweistufigkeit für hohe transparenz bezüglich Zuständigkeiten und politischer Verantwortung. 174 AUSBLICK
176 Entscheidender Nachteil ist die hohe Einstiegsschwelle für die Schaffung einer solchen stadtregionalen Institution. Wie die Beispiele der Region Hannover und der StädteRegion Aachen gezeigt haben, sind zur Überwindung dieser Schwelle eine mehrjährige Vorarbeit, günstige personelle Konstellationen sowie ein hoher politischer Grundkonsens erforderlich beziehungsweise hilfreich. Nach Schaffung einer solchen Regionalkreisstruktur bleibt das Verhältnis zwischen Kernstadt und Region gleichwohl sensibel, weil deren besonderer Lokomotivfunktion Rechnung zu tragen ist, ohne dabei freilich eine ganzheitliche stadtregionale Politik in Frage zu stellen. Nachteilig für die Außenwahrnehmung des Regionalkreises kann seine starke Prägung durch hoheitliche Aufgaben sein, während positiv besetzte freiwillige Aufgaben (zum Beispiel Förderung der Kultur, des Sports und ehrenamtlich tätiger Institutionen) eher durch die gemeindliche Ebene wahrgenommen oder durch fehlende originäre Finanzquellen der regionalen Ebene limitiert werden. Die Einschätzung dieses Modells kommt zu dem Ergebnis, dass es sich beim Regionalkreis um die stärkste Positionierung der Stadtregionen handelt. Sie ist aber nur mit längerem Vorlauf und hohem politischen Kraftaufwand erreichbar und konnte bislang nur in drei Fällen monozentrischer Stadtregionen realisiert werden. optimierungsoptionen des modells regionalkreis Auch für das Organisationsmodell des Regionalkreises muss die Frage aufgeworfen werden, ob und gegebenenfalls wie dieses weiter optimiert werden kann und muss. In diesem Sinne sollen im Folgenden drei Optionen diskutiert und bewertet werden. optimierungsoption zusammenlegung der verwaltungen Im Zusammenhang mit den Reformvorschlägen von Hesse (2004) für die Region Saarbrücken ist eine Konstruktion genannt worden, die auch schon gelegentlich in früheren Reformdiskussionen als eigenständiges Reformmodell diskutiert worden ist, nämlich die Zusammenlegung der Verwaltung von Kernstadt und Stadtregion. Dabei wird als Problem unterstellt, dass es in hohem Umfang Doppelarbeit in den Verwaltungen von Kernstadt und Regionalkreis gibt. Die vorgeschlagene Lösung besteht deswegen darin, dass die Kernstadtverwaltung die Regionalverwaltung übernimmt. Übersehen wird bei dieser Unterstellung offenbar, dass die wesentlichen Synergieeffekte bereits durch die Zusammenführung aller oder zumindest aller wesentlicher Aufgaben der Kreisstufe bei der Stadtregion erzielt werden. Sowohl bei der Gründung der Region Hannover als auch der StädteRegion Aachen sind deswegen in erheblichem Umfang Beschäftigte der Kernstadt in die stadtregionale Verwaltung gewech- AUSBLICK 175
177 selt. Da die verbliebenen Aufgaben der Kernstadt fast ausschließlich gemeindlicher Natur sind, sind Möglichkeiten zur Erzeugung weiterer fachlicher Synergien nur für zentrale administrative Aufgaben (elektronische Datenverarbeitung, Personalverwaltung, Gebäudemanagement und so weiter) zu erkennen. Für deren Zusammenführung sind jedoch niedrigschwelligere Lösungen anwendbar, die unter der Optimierungsoption Gemeinsame Serviceeinrichtungen vorgestellt werden. Während Vorteile dieses Reformvorschlages nicht erkennbar sind, können seine Nachteile klar benannt werden. Zum Ersten stellen die Größe und die Heterogenität der entstehenden neuen Verwaltung eine Herausforderung dar. Problematisch ist, dass der Regionalkreis, das heißt seine politische Vertretungskörperschaft, bei dieser Option keinen Zugriff auf eine eigene Exekutive hat. Auch die Interessen- und Loyalitätskonflikte innerhalb der Verwaltung sind nicht zu unterschätzen, da sich deren Arbeitsfelder zwangsläufig in einen gemeindlichen und einen regionalen teil mit unterschiedlicher geographischer und materieller Zuständigkeit unterteilen würden. Ganz erhebliche Probleme dürfte die Vermittlung dieses Modells im Umland bereiten, weil dort die Aufgaben der regionalen Ebene von der Kernstadt wahrgenommen würden, die in der Praxis häufig als Konkurrent der Umlandkommunen gesehen wird. Als Alternative könnte natürlich auch die umgekehrte Lösung diskutiert werden, das heißt dass die Stadtverwaltung in die Regionalverwaltung zu integrieren. Hierbei sind jedoch noch sehr viel massivere Schwierigkeiten und Nachteile als bei dem diskutierten Modell absehbar. 176 AUSBLICK
Prof. Dr. Axel Priebs
 Organisatorische Lösungen für die Ballungsräume ein aktueller Überblick Erster Regionsrat, Region Hannover Stadtregionen sind Leistungsträger im Siedlungssystem Knotenpunkte für Verkehr, Handel und Informationen
Organisatorische Lösungen für die Ballungsräume ein aktueller Überblick Erster Regionsrat, Region Hannover Stadtregionen sind Leistungsträger im Siedlungssystem Knotenpunkte für Verkehr, Handel und Informationen
Gesta(en: Region Hannover. Menschen. Ideen. Erfolge. Vom Lebensgefühl einer starken Region
 Gesta(en: Region Hannover Menschen. Ideen. Erfolge. Vom Lebensgefühl einer starken Region Die Region Hannover geografisch! 21 Städte und Gemeinden rd. 1,1 Millionen Menschen 2.300 Quadratkilometer Fläche
Gesta(en: Region Hannover Menschen. Ideen. Erfolge. Vom Lebensgefühl einer starken Region Die Region Hannover geografisch! 21 Städte und Gemeinden rd. 1,1 Millionen Menschen 2.300 Quadratkilometer Fläche
Regionale Kooperationen im Rhein-Main-Gebiet. Anforderungen und Handlungsempfehlungen fur eine zukunftsfahige Weiterentwicklung
 Martin Schaffer/Christoph Scheck Regionale Kooperationen im Rhein-Main-Gebiet Anforderungen und Handlungsempfehlungen fur eine zukunftsfahige Weiterentwicklung Materialien zur Regionalentwicklung und Raumordnung
Martin Schaffer/Christoph Scheck Regionale Kooperationen im Rhein-Main-Gebiet Anforderungen und Handlungsempfehlungen fur eine zukunftsfahige Weiterentwicklung Materialien zur Regionalentwicklung und Raumordnung
Deutsche Großstadtregionen (nach BBSR)
 Deutsche Großstadtregionen (nach BBSR) Kriterium: Pendlerbewegungen der sozialversicherungspflichtig versicherten Beschäftigten Zentrum: (Tag-)Bevölkerung > 100.000 Einwohner, Ergänzungsgebiet: Tagesbevölkerungsdichte
Deutsche Großstadtregionen (nach BBSR) Kriterium: Pendlerbewegungen der sozialversicherungspflichtig versicherten Beschäftigten Zentrum: (Tag-)Bevölkerung > 100.000 Einwohner, Ergänzungsgebiet: Tagesbevölkerungsdichte
Hat die Regionalplanung noch eine Zukunft?
 Hat die Regionalplanung noch eine Zukunft? 09. November 2015 in Berlin Prof. Dr. Rainer Danielzyk (ARL / Leibniz Universität Hannover) 0. Einführung Regionalentwicklung das hat mit Regionalplanung überhaupt
Hat die Regionalplanung noch eine Zukunft? 09. November 2015 in Berlin Prof. Dr. Rainer Danielzyk (ARL / Leibniz Universität Hannover) 0. Einführung Regionalentwicklung das hat mit Regionalplanung überhaupt
Charta der Metropolregion Nürnberg.
 Charta der Metropolregion Nürnberg Erlangen, 12. Mai 2005 Die anwesenden Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie Vertreter von Kammern, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Verwaltung aus dem
Charta der Metropolregion Nürnberg Erlangen, 12. Mai 2005 Die anwesenden Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie Vertreter von Kammern, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Verwaltung aus dem
Organisation, Ziele und Inhalte der Kooperation. Anja Wilde Geschäftsführerin
 Europäische Metropolregion München Organisation, Ziele und Inhalte der Kooperation Anja Wilde Geschäftsführerin Zahlen und Fakten 24.094 km², 5,48 Mio. Einwohner Höchstes Bevölkerungswachstum aller dt.
Europäische Metropolregion München Organisation, Ziele und Inhalte der Kooperation Anja Wilde Geschäftsführerin Zahlen und Fakten 24.094 km², 5,48 Mio. Einwohner Höchstes Bevölkerungswachstum aller dt.
Die Region Hannover - Kooperieren statt konkurrieren!
 Die Region Hannover - Kooperieren statt konkurrieren! Vortrag von Axel Priebs Erster Regionsrat der Region Hannover auf dem kommunalpolitischen Kongress der Linksfraktion in der Region Hannover am 27.8.2011
Die Region Hannover - Kooperieren statt konkurrieren! Vortrag von Axel Priebs Erster Regionsrat der Region Hannover auf dem kommunalpolitischen Kongress der Linksfraktion in der Region Hannover am 27.8.2011
Grußwort bei der Feierlichkeit zur Übernahme der Geschäftsbesorgung im. NLKH Wunstorf am 15. November 2007 in der Sporthalle 1
 Grußwort bei der Feierlichkeit zur Übernahme der Geschäftsbesorgung im NLKH Wunstorf am 15. November 2007 in der Sporthalle 1 Sehr geehrter Herr Regionspräsident Jagau, sehr geehrter Herr Dr. Brase, sehr
Grußwort bei der Feierlichkeit zur Übernahme der Geschäftsbesorgung im NLKH Wunstorf am 15. November 2007 in der Sporthalle 1 Sehr geehrter Herr Regionspräsident Jagau, sehr geehrter Herr Dr. Brase, sehr
Neue Schwerpunkte für die Leitbilder zur Raumentwicklung in Deutschland. Vortrag am in Hannover Rainer Danielzyk
 Neue Schwerpunkte für die Leitbilder zur Raumentwicklung in Deutschland Rainer Danielzyk Gliederung 1. Leitbilder und Handlungsstrategien zur Raumentwicklung in Deutschland 2. Stellungnahme 3. Reflexion
Neue Schwerpunkte für die Leitbilder zur Raumentwicklung in Deutschland Rainer Danielzyk Gliederung 1. Leitbilder und Handlungsstrategien zur Raumentwicklung in Deutschland 2. Stellungnahme 3. Reflexion
Stadt-Umland-Zusammenarbeit in der Region München - Bilanz
 1. Österreichischer Stadtregionstag in Graz, 7. Mai 2013 Stadt-Umland-Zusammenarbeit in der Region München - Bilanz Stefan Schelle 1. Bürgermeister Oberhaching Dr. Stephan Schott Landeshauptstadt München
1. Österreichischer Stadtregionstag in Graz, 7. Mai 2013 Stadt-Umland-Zusammenarbeit in der Region München - Bilanz Stefan Schelle 1. Bürgermeister Oberhaching Dr. Stephan Schott Landeshauptstadt München
Grußwort. Parlamentarischer Abend der NRW-Stiftung Dienstag, 13. September 2016, 18 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal
 Grußwort Parlamentarischer Abend der NRW-Stiftung Dienstag, 13. September 2016, 18 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrter Herr Präsident Voigtsberger! Lieber
Grußwort Parlamentarischer Abend der NRW-Stiftung Dienstag, 13. September 2016, 18 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrter Herr Präsident Voigtsberger! Lieber
Grußwort. Junge Islam Konferenz Freitag, 23. September 2016, 13 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal. Es gilt das gesprochene Wort!
 Grußwort Junge Islam Konferenz Freitag, 23. September 2016, 13 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Teilnehmerinnen und
Grußwort Junge Islam Konferenz Freitag, 23. September 2016, 13 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Teilnehmerinnen und
Hochverehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus!
 Hochverehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! Ich habe die Wahl mit großer Freude und Dankbarkeit angenommen. Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst, die diese Funktion
Hochverehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! Ich habe die Wahl mit großer Freude und Dankbarkeit angenommen. Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst, die diese Funktion
Grußwort. Isabel Pfeiffer-Poensgen Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
 Grußwort Isabel Pfeiffer-Poensgen Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Festakt "10 Jahre Universitätsallianz Ruhr" 13. Juli 2017, Bochum Es gilt das gesprochene Wort. Sehr
Grußwort Isabel Pfeiffer-Poensgen Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Festakt "10 Jahre Universitätsallianz Ruhr" 13. Juli 2017, Bochum Es gilt das gesprochene Wort. Sehr
Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler
 28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
Das Düsseldorfer Stadtentwicklungskonzept Düsseldorf Wachstum fördern, Zukunft gestalten
 Das Düsseldorfer Stadtentwicklungskonzept Düsseldorf 2020 + Wachstum fördern, Zukunft gestalten 1. Anlass Am 29. November 2006 beauftragte der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung die Verwaltung
Das Düsseldorfer Stadtentwicklungskonzept Düsseldorf 2020 + Wachstum fördern, Zukunft gestalten 1. Anlass Am 29. November 2006 beauftragte der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung die Verwaltung
Leitbild. des Deutschen Kinderschutzbundes
 Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Herren Bürgermeister der Pilotkommunen,
 Rede von Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich der Veranstaltung Landestreffen der Initiative Ich bin dabei! am 17. Juni 2014, 14.00 16.00 Uhr in der Staatskanzlei Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Rede von Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich der Veranstaltung Landestreffen der Initiative Ich bin dabei! am 17. Juni 2014, 14.00 16.00 Uhr in der Staatskanzlei Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Europäische Metropolregion München Organisation, Ziele und Inhalte einer neuen Kooperation. Anja Wilde Geschäftsführerin
 Europäische Metropolregion München Organisation, Ziele und Inhalte einer neuen Kooperation Anja Wilde Geschäftsführerin Jung und dynamisch Wussten Sie schon, dass... mit 5,48 Mio. Bürgern etwa jeder 15.
Europäische Metropolregion München Organisation, Ziele und Inhalte einer neuen Kooperation Anja Wilde Geschäftsführerin Jung und dynamisch Wussten Sie schon, dass... mit 5,48 Mio. Bürgern etwa jeder 15.
Schlusswort. (Beifall)
 Schlusswort Die Bundesvorsitzende Angela Merkel hat das Wort. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Vorsitzende der CDU: Liebe Freunde! Wir blicken auf einen, wie ich glaube, erfolgreichen Parteitag zurück.
Schlusswort Die Bundesvorsitzende Angela Merkel hat das Wort. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Vorsitzende der CDU: Liebe Freunde! Wir blicken auf einen, wie ich glaube, erfolgreichen Parteitag zurück.
Potenziale aktivieren durch interkommunale Zusammenarbeit
 Potenziale aktivieren durch interkommunale Zusammenarbeit Klaus Austermann, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen Südwestfalen, 14./15. Oktober 2013
Potenziale aktivieren durch interkommunale Zusammenarbeit Klaus Austermann, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen Südwestfalen, 14./15. Oktober 2013
Die Region Hannover: Geschichte und Gegenwart eines Modells für stadtregionales Management
 Die Region Hannover: Geschichte und Gegenwart eines Modells für stadtregionales Management Vortrag von Axel Priebs in Bad Oldesloe am 22.11.2008 Tagung Metropolregion, Stadtregion und urbane Peripherie
Die Region Hannover: Geschichte und Gegenwart eines Modells für stadtregionales Management Vortrag von Axel Priebs in Bad Oldesloe am 22.11.2008 Tagung Metropolregion, Stadtregion und urbane Peripherie
Grußwort des Oberbürgermeisters anlässlich der Gründungsveranstaltung Lokales Bündnis für Familie Rastatt am 04. Dezember 2008 um 18.
 Grußwort des Oberbürgermeisters anlässlich der Gründungsveranstaltung Lokales Bündnis für Familie Rastatt am 04. Dezember 2008 um 18.00 Uhr Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, ich begrüße
Grußwort des Oberbürgermeisters anlässlich der Gründungsveranstaltung Lokales Bündnis für Familie Rastatt am 04. Dezember 2008 um 18.00 Uhr Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, ich begrüße
Metropolregion Rheinland - Perspektiven und Potenziale einer stadtregionalen Partnerschaft
 Kongress Metropole Rheinland Metropolregion Rheinland - Perspektiven und Potenziale einer stadtregionalen Partnerschaft Prof. Dr. Thorsten Wiechmann, TU Dortmund Seite 1 Gliederung 1 Metropolregionen:
Kongress Metropole Rheinland Metropolregion Rheinland - Perspektiven und Potenziale einer stadtregionalen Partnerschaft Prof. Dr. Thorsten Wiechmann, TU Dortmund Seite 1 Gliederung 1 Metropolregionen:
Inter-regionale Zusammenarbeit: Notwendigkeit und Herausforderung für informelle EE-Regionen
 (De)zentrale Energiewende Wirklichkeiten, Widersprüche und Visionen - Konferenz des Leibnitz-Forschungsverbundes Energiewende am 30.6.2016 Inter-regionale Zusammenarbeit: Notwendigkeit und Herausforderung
(De)zentrale Energiewende Wirklichkeiten, Widersprüche und Visionen - Konferenz des Leibnitz-Forschungsverbundes Energiewende am 30.6.2016 Inter-regionale Zusammenarbeit: Notwendigkeit und Herausforderung
Regionalmanagement in Deutschland. OstWestfalenLippe und die anderen Regionen - eine vergleichende Analyse -
 Regionalmanagement in Deutschland OstWestfalenLippe und die anderen Regionen - eine vergleichende Analyse - Analyse der Metropolregionen Übersicht der Metropolregionen*: Hamburg Bremen-Oldenburg Berlin-Brandenburg
Regionalmanagement in Deutschland OstWestfalenLippe und die anderen Regionen - eine vergleichende Analyse - Analyse der Metropolregionen Übersicht der Metropolregionen*: Hamburg Bremen-Oldenburg Berlin-Brandenburg
Zusammenwirken von Regionalplanung, regionalen Entwicklungsperspektiven, Projekte interkommunaler Kooperation
 Zusammenwirken von Regionalplanung, regionalen Entwicklungsperspektiven, Projekte interkommunaler Kooperation Landrat Dr. Jörg Mielke Landkreis Osterholz Landkreis Osterholz 1 Ausgangspunkte effektive
Zusammenwirken von Regionalplanung, regionalen Entwicklungsperspektiven, Projekte interkommunaler Kooperation Landrat Dr. Jörg Mielke Landkreis Osterholz Landkreis Osterholz 1 Ausgangspunkte effektive
Europa stärken für seine Bürgerinnen und Bürger, für seine Städte
 Begrüßungsrede von Oberbürgermeister Peter Feldmann, anlässlich der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am 24. April 2013 in Frankfurt am Main Europa stärken für seine Bürgerinnen und Bürger, für
Begrüßungsrede von Oberbürgermeister Peter Feldmann, anlässlich der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am 24. April 2013 in Frankfurt am Main Europa stärken für seine Bürgerinnen und Bürger, für
Gemeindekooperation in Südböhmen
 16. Tagung der oö. Gemeinden Gemeindekooperation in Südböhmen Mgr. Dalibor Carda Bürgermeister der Stadt Český Krumlov Gemeindekooperation durch freiwillige Vereine und Bunden in verschiedenen Bereiche
16. Tagung der oö. Gemeinden Gemeindekooperation in Südböhmen Mgr. Dalibor Carda Bürgermeister der Stadt Český Krumlov Gemeindekooperation durch freiwillige Vereine und Bunden in verschiedenen Bereiche
Raumordnungsprognose 2030 des BBSR
 Raumordnungsprognose 2030 des BBSR Bevölkerung, private Haushalte, Erwerbspersonen in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg ARL-Tagung der Landesarbeitsgemeinschaften Bayern und Baden-Württemberg
Raumordnungsprognose 2030 des BBSR Bevölkerung, private Haushalte, Erwerbspersonen in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg ARL-Tagung der Landesarbeitsgemeinschaften Bayern und Baden-Württemberg
Informelle Ministerkonferenz zum Thema "Europa vermitteln"
 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss Informelle Ministerkonferenz zum Thema "Europa vermitteln" Rede von Roger BRIESCH Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 7./8. April
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss Informelle Ministerkonferenz zum Thema "Europa vermitteln" Rede von Roger BRIESCH Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 7./8. April
Präsident der Bayerischen Landesärztekammer
 Grußwort Dr. Hartmut Stöckle 80 Jahre von Dr. Max Kaplan, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer am 11. Februar 2013 in München Es gilt das gesprochene Wort! Lieber Hartmut, liebe Frau Stöckle, lieber
Grußwort Dr. Hartmut Stöckle 80 Jahre von Dr. Max Kaplan, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer am 11. Februar 2013 in München Es gilt das gesprochene Wort! Lieber Hartmut, liebe Frau Stöckle, lieber
Wohnen und Wandern Überblick über vorhandene Forschungen und einen Forschungsverbund in NRW
 Wohnen und Wandern Überblick über vorhandene Forschungen und einen Forschungsverbund in NRW von Rainer Danielzyk (ILS NRW Dortmund) Claus-Christian Wiegandt (Universität Bonn) Forschungsverbund Demografischer
Wohnen und Wandern Überblick über vorhandene Forschungen und einen Forschungsverbund in NRW von Rainer Danielzyk (ILS NRW Dortmund) Claus-Christian Wiegandt (Universität Bonn) Forschungsverbund Demografischer
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG
 BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 88-3 vom 10. September 2008 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Rahmen der Veranstaltungsreihe Menschen in Europa am 10. September 2008 in Passau: Sehr geehrter
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 88-3 vom 10. September 2008 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Rahmen der Veranstaltungsreihe Menschen in Europa am 10. September 2008 in Passau: Sehr geehrter
Engagement-Lotsen Programm Hessischen Landesregierung. der
 Engagement-Lotsen Programm 2017 der Hessischen Landesregierung 1. Engagementförderung mit Engagement-Lotsen Bürgerschaftliches Engagement befindet sich in einem deutlichen Wandel. Neben dem Engagement
Engagement-Lotsen Programm 2017 der Hessischen Landesregierung 1. Engagementförderung mit Engagement-Lotsen Bürgerschaftliches Engagement befindet sich in einem deutlichen Wandel. Neben dem Engagement
Für starke Städte, Gemeinden und Landkreise. Für eine lebenswerte Heimat.
 Für starke Städte, Gemeinden und Landkreise. Für eine lebenswerte Heimat. Wahlaufruf des Bundesvorstands der CDU Deutschlands anlässlich der Kommunalwahlen in zehn Bundesländern am 25. Mai 2014. Für starke
Für starke Städte, Gemeinden und Landkreise. Für eine lebenswerte Heimat. Wahlaufruf des Bundesvorstands der CDU Deutschlands anlässlich der Kommunalwahlen in zehn Bundesländern am 25. Mai 2014. Für starke
Rede zur Begrüßung der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am
 Rede zur Begrüßung der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am 24.04.2013 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrter Herr Präsident Ude, sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums, sehr geehrte Kolleginnen
Rede zur Begrüßung der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am 24.04.2013 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrter Herr Präsident Ude, sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums, sehr geehrte Kolleginnen
- 1. Sehr geehrte Damen und Herren,
 - 1 Grußwort von Landrat Michael Makiolla anlässlich des Empfangs des Landrats für die Selbsthilfe im Kreis Unna am 07. September 2016 auf Haus Opherdicke Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen
- 1 Grußwort von Landrat Michael Makiolla anlässlich des Empfangs des Landrats für die Selbsthilfe im Kreis Unna am 07. September 2016 auf Haus Opherdicke Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen
Grußwort von. Vera Reiß, Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Rheinland-Pfalz
 Grußwort von Vera Reiß, Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz anlässlich der Auftaktveranstaltung der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement 5. März 2015,
Grußwort von Vera Reiß, Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz anlässlich der Auftaktveranstaltung der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement 5. März 2015,
Minister für Bau, Landesentwicklung und Verkehr Christian Carius. Grußwort. Eröffnungsveranstaltung Akademie Ländlicher Raum Thüringen
 Minister für Bau, Landesentwicklung und Verkehr Christian Carius Grußwort Eröffnungsveranstaltung Akademie Ländlicher Raum Thüringen Demografischer Wandel das Schicksal der Thüringer Städte und Gemeinden?
Minister für Bau, Landesentwicklung und Verkehr Christian Carius Grußwort Eröffnungsveranstaltung Akademie Ländlicher Raum Thüringen Demografischer Wandel das Schicksal der Thüringer Städte und Gemeinden?
Vor 25 Jahren hat Ungarn ein bedeutendes
 Sperrfrist: 1. April 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 20-Jahr-Feier des
Sperrfrist: 1. April 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 20-Jahr-Feier des
Guido Sempell Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
 Guido Sempell Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 11 Kandidaten aus 5 Ländern (Juni 2009 Februar 2013) Ausgangsthese: UF ist ein dynamischer Raum im Übergang Ein Raum
Guido Sempell Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 11 Kandidaten aus 5 Ländern (Juni 2009 Februar 2013) Ausgangsthese: UF ist ein dynamischer Raum im Übergang Ein Raum
Leitbild für ein Integriertes. Wasserressourcen-Management Rhein-Main
 Leitbild für ein Integriertes Wasserressourcen-Management Rhein-Main Rede von Frau Staatssekretärin Dr. Tappeser anlässlich der Auftaktveranstaltung Leitbild für ein Integriertes Wasserressourcen-Management
Leitbild für ein Integriertes Wasserressourcen-Management Rhein-Main Rede von Frau Staatssekretärin Dr. Tappeser anlässlich der Auftaktveranstaltung Leitbild für ein Integriertes Wasserressourcen-Management
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Lokale Agenda 21
 Laudationes Kategorie Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Lokale Agenda 21 Laudator: Dr. Herbert O. Zinell Oberbürgermeister der Stadt Schramberg Vorsitzender des Kuratoriums der SEZ (Ablauf: Nennung
Laudationes Kategorie Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Lokale Agenda 21 Laudator: Dr. Herbert O. Zinell Oberbürgermeister der Stadt Schramberg Vorsitzender des Kuratoriums der SEZ (Ablauf: Nennung
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT
 INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
Kleinere Städte und Gemeinden in Bayern Bericht aus der Programmumsetzung. MR Armin Keller
 Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Kleinere Städte und Gemeinden in Bayern Bericht aus der Programmumsetzung MR Armin Keller www.innenministerium.bayern.de Ländlicher Raum, Bevölkerungsentwicklung
Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Kleinere Städte und Gemeinden in Bayern Bericht aus der Programmumsetzung MR Armin Keller www.innenministerium.bayern.de Ländlicher Raum, Bevölkerungsentwicklung
Das Regionale Energiekonzept FrankfurtRheinMain
 Gemeinsam mehr erreichen Das Regionale Energiekonzept FrankfurtRheinMain Teamwork von Stadt und Region Kassel, 11. November 2015 Kongress 100% Erneuerbare Energie Regionen Workshop: Geteiltes Wissen Gemeinsame
Gemeinsam mehr erreichen Das Regionale Energiekonzept FrankfurtRheinMain Teamwork von Stadt und Region Kassel, 11. November 2015 Kongress 100% Erneuerbare Energie Regionen Workshop: Geteiltes Wissen Gemeinsame
Es gilt das gesprochen Wort!
 Es gilt das gesprochen Wort! Rede von Herrn Oberbürgermeister Schramma als Vorstandsvorsitzender des Region Köln/Bonn e.v. anlässlich der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein
Es gilt das gesprochen Wort! Rede von Herrn Oberbürgermeister Schramma als Vorstandsvorsitzender des Region Köln/Bonn e.v. anlässlich der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein
Und wenn ich so zurückdenke wie alles begonnen hat ist dies schon sehr beeindruckend begonnen hat mit einer Vision von
 LR Mikl-Leitner Geschätzte Herrn Außenminister! Verehrter Herr Kommissar! Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! Hochwürdigster Herr Prälat! Exzellenzen, verehrte Festgäste! Auch ich darf Sie herzlich willkommen
LR Mikl-Leitner Geschätzte Herrn Außenminister! Verehrter Herr Kommissar! Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! Hochwürdigster Herr Prälat! Exzellenzen, verehrte Festgäste! Auch ich darf Sie herzlich willkommen
Die Stadt Norderstedt Auf dem Weg in die Digitale Zukunft. Digitales Leitbild 2020 Mobil Innovativ Wirtschaftlich
 Die Stadt Norderstedt Auf dem Weg in die Digitale Zukunft Digitales Leitbild 2020 Mobil Innovativ Wirtschaftlich Stadt Norderstedt Modellkommune E-Government Ausgangspunkt unseres digitalen Leitbildes
Die Stadt Norderstedt Auf dem Weg in die Digitale Zukunft Digitales Leitbild 2020 Mobil Innovativ Wirtschaftlich Stadt Norderstedt Modellkommune E-Government Ausgangspunkt unseres digitalen Leitbildes
Region München erfolgreich weiterentwickeln
 Stadtentwicklungsplanung Region München erfolgreich weiterentwickeln Anlage zum Regionsbericht 2010 Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Partnerinnen und Partner in der Region, unser gemeinsamer Lebens-
Stadtentwicklungsplanung Region München erfolgreich weiterentwickeln Anlage zum Regionsbericht 2010 Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Partnerinnen und Partner in der Region, unser gemeinsamer Lebens-
Grußwort von Dr. Armin Leon, Referatsleiter im MAIS, anlässlich des Workshops: Die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens als Planungsaufgabe
 VB 5 Grußwort von Dr. Armin Leon, Referatsleiter im MAIS, anlässlich des Workshops: Die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens als Planungsaufgabe am 21./22. Januar 2016 in Witten (Es gilt das gesprochene
VB 5 Grußwort von Dr. Armin Leon, Referatsleiter im MAIS, anlässlich des Workshops: Die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens als Planungsaufgabe am 21./22. Januar 2016 in Witten (Es gilt das gesprochene
Es gilt das gesprochene Wort!
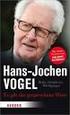 Es gilt das gesprochene Wort! 40-jähriges Bestehen der Freien Waldorfschule Würzburg am 30. Januar 2016, um 16.00 Uhr in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr
Es gilt das gesprochene Wort! 40-jähriges Bestehen der Freien Waldorfschule Würzburg am 30. Januar 2016, um 16.00 Uhr in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 19/690 Landtag 19. Wahlperiode
 BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 19/690 Landtag 19. Wahlperiode 16.08.16 Mitteilung des Senats vom 16. August 2016 Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 19/690 Landtag 19. Wahlperiode 16.08.16 Mitteilung des Senats vom 16. August 2016 Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die
Wirtschaftsflächenentwicklung in der Städteregion Ruhr 2030
 Wirtschaftsflächenentwicklung in der Städteregion Ruhr 2030 Masterplan Ruhr 2012 -Thesenpapier - Fachdialog Siedlungsentwicklung am 11.03.2013 in Hamm Städteregion Ruhr 2030 Forschungsprojekt Stadt 2030
Wirtschaftsflächenentwicklung in der Städteregion Ruhr 2030 Masterplan Ruhr 2012 -Thesenpapier - Fachdialog Siedlungsentwicklung am 11.03.2013 in Hamm Städteregion Ruhr 2030 Forschungsprojekt Stadt 2030
Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure
 Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure Themenblock 2 - Impuls Syke 1. Querschnittsworkshop 25. Oktober 2010, Jena Dr. Guido Nischwitz, IAW 0) Einführung Zum Verständnis (von Begriffen) Einbeziehung
Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure Themenblock 2 - Impuls Syke 1. Querschnittsworkshop 25. Oktober 2010, Jena Dr. Guido Nischwitz, IAW 0) Einführung Zum Verständnis (von Begriffen) Einbeziehung
Jahrestagung des wissenschaftlichen Beirates Zukunft der Kommunalfinanzen. 10. Juli :30 17:00 Uhr
 Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gemeinnützige Gesellschaft mbh Jahrestagung des wissenschaftlichen Beirates Zukunft der Kommunalfinanzen 10. Juli 2012 14:30 17:00 Uhr Dorint Hotel
Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gemeinnützige Gesellschaft mbh Jahrestagung des wissenschaftlichen Beirates Zukunft der Kommunalfinanzen 10. Juli 2012 14:30 17:00 Uhr Dorint Hotel
Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: Beginn der Rede!
 Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
Sehr geehrte Damen und Herren,
 Ombudschaft für junge Menschen Kinderrechte in der Jugendhilfe Fachtagung am 21. April 2009 in Köln Grußwort: Lorenz Bahr Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie als Vertreterinnen und Vertreter
Ombudschaft für junge Menschen Kinderrechte in der Jugendhilfe Fachtagung am 21. April 2009 in Köln Grußwort: Lorenz Bahr Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie als Vertreterinnen und Vertreter
Gemeinsam mehr erreichen Das Regionale Energiekonzept FrankfurtRheinMain
 Gemeinsam mehr erreichen Das Regionale Energiekonzept FrankfurtRheinMain Bürgerforum Butzbach, 15.10.2014 Grußwort Verbandsdirektor Ludger Stüve Regionalverband FrankfurtRheinMain 2 Klimawandel ist jetzt
Gemeinsam mehr erreichen Das Regionale Energiekonzept FrankfurtRheinMain Bürgerforum Butzbach, 15.10.2014 Grußwort Verbandsdirektor Ludger Stüve Regionalverband FrankfurtRheinMain 2 Klimawandel ist jetzt
Anrede, (Mitglieder der Verbandsversammlung, der Kreise und kreisfreien Städte im VRS (als Aufgabenträger) sowie der Verkehrsunternehmen),
 Leere Busse, volle Bahnen? Der demografische Wandel und seine Herausforderungen für die Verkehrsunternehmen im VRS, Grußwort VRS- Verbandsvorsteher Landrat Rosenke, 13.11.2013 14.30 Uhr in Köln Anrede,
Leere Busse, volle Bahnen? Der demografische Wandel und seine Herausforderungen für die Verkehrsunternehmen im VRS, Grußwort VRS- Verbandsvorsteher Landrat Rosenke, 13.11.2013 14.30 Uhr in Köln Anrede,
Begrüßungsworte Parlamentarischer Abend der Lebenshilfe NRW 2. Dezember 2015, Uhr, Restaurant des Landtags
 Begrüßungsworte Parlamentarischer Abend der Lebenshilfe NRW 2. Dezember 2015, 19.30 Uhr, Restaurant des Landtags Verehrter Herr Landesvorsitzender, lieber Bundestagskollege Uwe Schummer, liebe Kolleginnen
Begrüßungsworte Parlamentarischer Abend der Lebenshilfe NRW 2. Dezember 2015, 19.30 Uhr, Restaurant des Landtags Verehrter Herr Landesvorsitzender, lieber Bundestagskollege Uwe Schummer, liebe Kolleginnen
Seite 1. Grußwort PSt in Marks
 Seite 1 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Herr Lehrieder, sehr geehrter Herr Corsa, ich freue
Seite 1 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Herr Lehrieder, sehr geehrter Herr Corsa, ich freue
Anschwung für frühe Chancen Service-Programm zur Unterstützung von 600 Initiativen für frühkindliche Entwicklung
 Anschwung für frühe Chancen Service-Programm zur Unterstützung von 600 Initiativen für frühkindliche Entwicklung Ein gemeinsames Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Anschwung für frühe Chancen Service-Programm zur Unterstützung von 600 Initiativen für frühkindliche Entwicklung Ein gemeinsames Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Kommunales Bildungsmanagement für Einsteiger
 Werkstattgespräch 1 Kommunales Bildungsmanagement für Einsteiger Beispiel aus der kommunalen Praxis im Kreis Lippe Augsburg, 26. Juni 2015 Markus Rempe Leiter Stabsbereich Bildung Kreis Lippe Vorstandsvorsitzender
Werkstattgespräch 1 Kommunales Bildungsmanagement für Einsteiger Beispiel aus der kommunalen Praxis im Kreis Lippe Augsburg, 26. Juni 2015 Markus Rempe Leiter Stabsbereich Bildung Kreis Lippe Vorstandsvorsitzender
Erklärung der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österreichischen Landesparlamente sowie des Südtiroler Landtags Wolfsburger Erklärung
 Erklärung der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österreichischen Landesparlamente sowie des Südtiroler Landtags Wolfsburger Erklärung Starke Länder in einem starken Europa Modernen Formen
Erklärung der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österreichischen Landesparlamente sowie des Südtiroler Landtags Wolfsburger Erklärung Starke Länder in einem starken Europa Modernen Formen
Initiative Aktive Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
 Initiative Aktive Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern Ein Papier der Projektgruppe Aktive Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 1 in Zusammenarbeit
Initiative Aktive Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern Ein Papier der Projektgruppe Aktive Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 1 in Zusammenarbeit
- 1. Ansprache von Landrat Michael Makiolla zur Verabschiedung von Bürgermeister Jenz Rother am 20. Oktober 2015 in Holzwickede
 - 1 Ansprache von Landrat Michael Makiolla zur Verabschiedung von Bürgermeister Jenz Rother am 20. Oktober 2015 in Holzwickede Es gilt das gesprochene Wort! Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber
- 1 Ansprache von Landrat Michael Makiolla zur Verabschiedung von Bürgermeister Jenz Rother am 20. Oktober 2015 in Holzwickede Es gilt das gesprochene Wort! Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber
Leitbild. Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund. Grundsätze Leistungen Kompetenzen Organisation Personal Kooperation Führung
 Leitbild Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund Grundsätze Leistungen Kompetenzen Organisation Personal Kooperation Führung Grundsätze Wir sind ein interdisziplinär arbeitendes, sozialwissenschaftliches
Leitbild Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund Grundsätze Leistungen Kompetenzen Organisation Personal Kooperation Führung Grundsätze Wir sind ein interdisziplinär arbeitendes, sozialwissenschaftliches
EVALUIERUNG Leader 2008 bis 4/2013 LAG Rhön Grabfeld Fragebogen an die Mitglieder der LAG
 EVALUIERUNG Leader 2008 bis 4/2013 LAG Rhön Grabfeld Fragebogen an die Mitglieder der LAG Rücksendung des Fragebogens bitte bis Mittwoch, 17.04.2013. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. Mit Ihrer Beteiligung
EVALUIERUNG Leader 2008 bis 4/2013 LAG Rhön Grabfeld Fragebogen an die Mitglieder der LAG Rücksendung des Fragebogens bitte bis Mittwoch, 17.04.2013. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. Mit Ihrer Beteiligung
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Eröffnung der Berufsbildungskonferenz
 Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Eröffnung der Berufsbildungskonferenz am 12. Juni 2009 in Shenyang Es gilt das gesprochene Wort! 1 I.
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Eröffnung der Berufsbildungskonferenz am 12. Juni 2009 in Shenyang Es gilt das gesprochene Wort! 1 I.
Bürgerbusse im ländlichen Raum
 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg 30. November 2016 09:30 13:15 Uhr Informationsveranstaltung zum EU-Projekt RUMOBIL Bürgerbusse im ländlichen Raum Wilfried
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg 30. November 2016 09:30 13:15 Uhr Informationsveranstaltung zum EU-Projekt RUMOBIL Bürgerbusse im ländlichen Raum Wilfried
Stephan Steinlein. Staatssekretär. Eröffnung des. 4. Symposiums des Weltverbandes Deutscher. Auslandsschulen. Berlin-Brandenburgische Akademie der
 Stephan Steinlein Staatssekretär Eröffnung des 4. Symposiums des Weltverbandes Deutscher Auslandsschulen Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften am 24. April 2015 2 Sehr geehrter Herr Ernst,
Stephan Steinlein Staatssekretär Eröffnung des 4. Symposiums des Weltverbandes Deutscher Auslandsschulen Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften am 24. April 2015 2 Sehr geehrter Herr Ernst,
Kontaktnetzwerk IHK, Bremen Sept. 2016
 Kontaktnetzwerk IHK, Bremen Sept. 2016 I. GRUNDLAGEN, ZIELE & HANDLUNGSFELDER Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) Deklaration Biologische Vielfalt in Kommunen 260 Unterzeichnerkommunen
Kontaktnetzwerk IHK, Bremen Sept. 2016 I. GRUNDLAGEN, ZIELE & HANDLUNGSFELDER Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) Deklaration Biologische Vielfalt in Kommunen 260 Unterzeichnerkommunen
André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen
 André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Gelebte Reformation Die Barmer Theologische Erklärung 11. Oktober 2017, 9.00 Uhr, Wandelhalle Meine sehr
André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Gelebte Reformation Die Barmer Theologische Erklärung 11. Oktober 2017, 9.00 Uhr, Wandelhalle Meine sehr
Ministerialdirigent Andreas Minschke Abteilungsleiter Strategische Landesentwicklung, Kataster- und Vermessungswesen
 Nachgefragt: Die Demografie-Strategien der drei mitteldeutschen Länder v Demografischer Wandel im Freistaat Thüringen - Prognosen, Maßnahmen und Instrumente Ministerialdirigent Andreas Minschke Abteilungsleiter
Nachgefragt: Die Demografie-Strategien der drei mitteldeutschen Länder v Demografischer Wandel im Freistaat Thüringen - Prognosen, Maßnahmen und Instrumente Ministerialdirigent Andreas Minschke Abteilungsleiter
Regionale Standortentwicklung
 Regionale Standortentwicklung Rolle und der kommunalen Wirtschaftsförderung W Dr. Stefan Gärtner, Institut Arbeit und Technik Gliederung Gliederung I. Was ist Wirtschaftsförderung? II. Was sind die Rahmenbedingungen
Regionale Standortentwicklung Rolle und der kommunalen Wirtschaftsförderung W Dr. Stefan Gärtner, Institut Arbeit und Technik Gliederung Gliederung I. Was ist Wirtschaftsförderung? II. Was sind die Rahmenbedingungen
54 Unternehmen. 7 Städte. 1 Vision. 3 Industrie- und Handelskammern
 54 Unternehmen 7 Städte 3 Industrie- und Handelskammern 1 Vision UNSERE VISION: Mitteldeutschland zählt im Jahr 2020 zu den attraktivsten und innovativsten Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregionen
54 Unternehmen 7 Städte 3 Industrie- und Handelskammern 1 Vision UNSERE VISION: Mitteldeutschland zählt im Jahr 2020 zu den attraktivsten und innovativsten Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregionen
Kommunalreform in Dänemark
 Konrad-Adenauer-Stiftung Politik und Beratung Kommunalreform in Dänemark Bericht Mehr Informationen unter www.politik-fuer-kommunen.de Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Hauptabteilung Politik und Beratung
Konrad-Adenauer-Stiftung Politik und Beratung Kommunalreform in Dänemark Bericht Mehr Informationen unter www.politik-fuer-kommunen.de Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Hauptabteilung Politik und Beratung
Planungszellen zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz
 Planungszellen zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz Dr. Birgit Böhm 26.09.2009 Tagung Akteure verstehen, stärken und gewinnen! der Stiftung Mitarbeit in der Evangelischen Akademie Loccum
Planungszellen zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz Dr. Birgit Böhm 26.09.2009 Tagung Akteure verstehen, stärken und gewinnen! der Stiftung Mitarbeit in der Evangelischen Akademie Loccum
zu verbessern. Im Mittelpunkt steht dabei immer der betroffene Mensch.
 Pressemitteilung 10.10.2016 Beitritt der Stadt Mainz zur Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland anlässlich des Welthospiztages am 8. Oktober 2016 Oberbürgermeister
Pressemitteilung 10.10.2016 Beitritt der Stadt Mainz zur Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland anlässlich des Welthospiztages am 8. Oktober 2016 Oberbürgermeister
Der demographische Wandel und die Auswirkungen auf die Kommune Günter Tebbe. Lübeck, 1. Juli 2014
 Der demographische Wandel und die Auswirkungen auf die Kommune Günter Tebbe Lübeck, 1. Juli 2014 Menschen bewegen. Zukunft gestalten.»wir helfen der Politik, dem Staat und der Gesellschaft, Lösungen für
Der demographische Wandel und die Auswirkungen auf die Kommune Günter Tebbe Lübeck, 1. Juli 2014 Menschen bewegen. Zukunft gestalten.»wir helfen der Politik, dem Staat und der Gesellschaft, Lösungen für
Grußwort der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Svenja Schulze
 Grußwort der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Svenja Schulze anlässlich der Veranstaltung Aging Translational research as source of im Rahmen der Veranstaltungsreihe
Grußwort der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Svenja Schulze anlässlich der Veranstaltung Aging Translational research as source of im Rahmen der Veranstaltungsreihe
Kommunale Klimapartnerschaften mit. Kommunales Know-how internationale nutzen Ein Projekt im Auftrag des BMZ und in
 Kommunale Klimapartnerschaften mit Entwicklungs-und Schwellenländern: Kommunales Know-how internationale nutzen Ein Projekt im Auftrag des BMZ und in Kooperation mit der LAG21 NRW Dr. Stefan Wilhelmy Gelsenkirchen,
Kommunale Klimapartnerschaften mit Entwicklungs-und Schwellenländern: Kommunales Know-how internationale nutzen Ein Projekt im Auftrag des BMZ und in Kooperation mit der LAG21 NRW Dr. Stefan Wilhelmy Gelsenkirchen,
Einladung für die Workshops Regionen I bis III am 12. Oktober 2015, 20. November 2015 und 15. Januar 2016
 Geschäftsstelle Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe gemäß 3 Standortauswahlgesetz Arbeitsgruppe 1 Gesellschaftlicher Dialog, Öffentlichkeitsbeteiligung und Transparenz Einladung für die
Geschäftsstelle Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe gemäß 3 Standortauswahlgesetz Arbeitsgruppe 1 Gesellschaftlicher Dialog, Öffentlichkeitsbeteiligung und Transparenz Einladung für die
Kommunale Handlungskonzepte: Wohnen
 Matthias Klupp Kommunale Handlungskonzepte: Wohnen - Wo liegen die Probleme? Gelsenkirchen, 22.11.2007 22.11.07-1 Gegründet 1993 35 Mitarbeiter Büros in Hamburg und Leipzig Spezialisiert auf Wohnungs-
Matthias Klupp Kommunale Handlungskonzepte: Wohnen - Wo liegen die Probleme? Gelsenkirchen, 22.11.2007 22.11.07-1 Gegründet 1993 35 Mitarbeiter Büros in Hamburg und Leipzig Spezialisiert auf Wohnungs-
Es ist mir eine große Freude, heute das Zentrum für Israel-Studien an der Ludwig- Maximilians-Universität München mit Ihnen feierlich zu eröffnen.
 Sperrfrist: 3.Juni 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Zentrums
Sperrfrist: 3.Juni 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Zentrums
Gemeinsam in die Zukunft
 Gemeinsam in die Zukunft Pusteblume Bergen Katzenborn Wahlen Villa Regenbogen Losheim Sonnengarten Losheim Leitbild der kommunalen s der Gemeinde Losheim am See Vorwort Das vorliegende Leitbild präsentiert
Gemeinsam in die Zukunft Pusteblume Bergen Katzenborn Wahlen Villa Regenbogen Losheim Sonnengarten Losheim Leitbild der kommunalen s der Gemeinde Losheim am See Vorwort Das vorliegende Leitbild präsentiert
HERZLICH WILLKOMMEN ZUM STRATEGIEWORKSHOP ZUKUNFTSKOMPASS MÖCKMÜHL 2025
 KÖLN CIMA Beratung LEIPZIG + Management LÜBECK MÜNCHEN GmbH 2014 RIED (A) STUTTGART HERZLICH WILLKOMMEN ZUM STRATEGIEWORKSHOP ZUKUNFTSKOMPASS MÖCKMÜHL 2025 am 16. April 2014 Stadt- und Regionalmarketing
KÖLN CIMA Beratung LEIPZIG + Management LÜBECK MÜNCHEN GmbH 2014 RIED (A) STUTTGART HERZLICH WILLKOMMEN ZUM STRATEGIEWORKSHOP ZUKUNFTSKOMPASS MÖCKMÜHL 2025 am 16. April 2014 Stadt- und Regionalmarketing
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten
 Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Bayerische Klima-Allianz
 Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und des Landesverbandes der Campingwirtschaft in Bayern e.v. (LCB) für eine Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 3. August
Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und des Landesverbandes der Campingwirtschaft in Bayern e.v. (LCB) für eine Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 3. August
Zentren in schrumpfenden Regionen Pirmasens und Stendal
 Ulrike Milstrey Zentren in schrumpfenden Regionen Pirmasens und Stendal Vortrag auf dem 38. Brandenburger Regionalgespräch, IRS Erkner Forschungsfragen Inwieweit verschärft sich in Schrumpfungsregionen
Ulrike Milstrey Zentren in schrumpfenden Regionen Pirmasens und Stendal Vortrag auf dem 38. Brandenburger Regionalgespräch, IRS Erkner Forschungsfragen Inwieweit verschärft sich in Schrumpfungsregionen
Kommunales Bildungsmanagement
 Kommunales Bildungsmanagement Von der Idee zur Umsetzung im Kreis Lippe Markus Rempe Leiter Fachdienst Bildung Kreis Lippe Vorstandsvorsitzender Lippe Bildung eg Ludwigslust, 1. März 2017 Hand in Hand
Kommunales Bildungsmanagement Von der Idee zur Umsetzung im Kreis Lippe Markus Rempe Leiter Fachdienst Bildung Kreis Lippe Vorstandsvorsitzender Lippe Bildung eg Ludwigslust, 1. März 2017 Hand in Hand
Grundsatzprogramm des CDU Stadtverbandes Gladenbach
 Grundsatzprogramm des CDU Stadtverbandes Gladenbach Stand: Oktober 2012 Herausgeber CDU Stadtverband Gladenbach Vorstand vertreten durch die Vorsitzende Melanie Krämer-Kowallik In der Heeb 6 35075 Gladenbach
Grundsatzprogramm des CDU Stadtverbandes Gladenbach Stand: Oktober 2012 Herausgeber CDU Stadtverband Gladenbach Vorstand vertreten durch die Vorsitzende Melanie Krämer-Kowallik In der Heeb 6 35075 Gladenbach
Statement. der Ministerin für Schule und Weiterbildung. des Landes Nordrhein-Westfalen, Barbara Sommer. zur Eröffnung der Fachtagung
 Statement der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Barbara Sommer zur Eröffnung der Fachtagung "Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Schule - eine Standortbestimmung"
Statement der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Barbara Sommer zur Eröffnung der Fachtagung "Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Schule - eine Standortbestimmung"
Ratsvorsitzender der Metropolregion Nürnberg Landrat Armin Kroder (Nürnberger Land)
 Im Nürnberger Land haben wir mit dem Zukunftscoach erfolgreich auf den Schwerpunkt Bildung gesetzt. (Weiter-)Bildung für Menschen in allen Lebensphasen; die am Bildungsprozess Beteiligten vernetzen, usw.
Im Nürnberger Land haben wir mit dem Zukunftscoach erfolgreich auf den Schwerpunkt Bildung gesetzt. (Weiter-)Bildung für Menschen in allen Lebensphasen; die am Bildungsprozess Beteiligten vernetzen, usw.
Gemeinden im Klimawandel: Kommunale Betroffenheiten und Anpassungsbedarf Esther Chrischilles Kompetenzfeld Umwelt, Energie und Ressourcen
 Gemeinden im Klimawandel: Kommunale Betroffenheiten und Anpassungsbedarf Esther Chrischilles Kompetenzfeld Umwelt, Energie und Ressourcen KLIMZUG-Panel 22. Oktober, euregia 2012, Leipzig Gemeinden im Klimawandel
Gemeinden im Klimawandel: Kommunale Betroffenheiten und Anpassungsbedarf Esther Chrischilles Kompetenzfeld Umwelt, Energie und Ressourcen KLIMZUG-Panel 22. Oktober, euregia 2012, Leipzig Gemeinden im Klimawandel
Beurteilung möglicher Alternativen zu einer Fusion
 Anhang 2 Beurteilung möglicher Alternativen zu einer Fusion Als Alternative zu einer Gemeindefusion von Stetten, Lohn und Büttenhardt gibt es folgende mögliche Entwicklungen. keine Veränderung zu heute
Anhang 2 Beurteilung möglicher Alternativen zu einer Fusion Als Alternative zu einer Gemeindefusion von Stetten, Lohn und Büttenhardt gibt es folgende mögliche Entwicklungen. keine Veränderung zu heute
