Der Rauswurf der Milbe Züchtung varroaresistenter Bienen
|
|
|
- Angelika Böhler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Klimmek, Alexander Der Rauswurf der Milbe Züchtung varroaresistenter Bienen
2 I Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort Varroa-Toleranz Gotland Projekt Vererbung Zellteilung Zellverschmelzung Reifeteilung Vererbung des Geschlechts Vererbungsgesetze und -begriffe Mendelsche Regeln Uniformitätsgesetz Spaltungsgesetz Unabhängigkeitsgesetz Züchtung Heterosis /Heterosiseffekt Heterosiszüchtung Rekurrente Selektion Rekurrente reziproke Selektion Künstliche Besamung Quellen- und Literaturverzeichnis Bücher Webseiten Bilder Thesenpapier... Fehler! Textmarke nicht definiert. 10. Erklärung zur Urheberschaft... Fehler! Textmarke nicht definiert.
3 1 1. Vorwort Die Honigbiene ist ein überaus faszinierendes und komplexes Insekt. Jedoch sterben jährlich tausende Bienenvölker, auf Grund des Bienenstaatsfeindes Nummer 1: die Varroa-Milbe (Varroa destructor). Dieser Parasit stammt ursprünglich aus Südostasien, wo die östlichen Bienen seit Jahren ohne Probleme mit ihm lebten. Als sie aber durch weiträumige Bienentransporte auch nach Europa kamen, starben hierzulande viele Bienenvölker. Durch diese rasche globale Verbreitung der Milbe konnte keine langfristige Lösung zur Bekämpfung gefunden werden. Es wurden zwar Methoden entwickelt diesen Parasiten chemisch zu behandeln, jedoch hat dies womöglich dauerhafte Folgen auf die Honigbienen und deren Produkte, welche bisher noch unerforscht sind. Einige Imker versuchten deshalb Bienen zu züchten, die resistent gegen die Varroa-Milbe sind. Hierbei gab es unterschiedlichste Ansätze. Man sagt ja nicht umsonst: 2 Imker, 3 Meinungen. Ein Ansatz der natürlichen Selektion wurde im sogenannten Gotland Projekt auf einer schwedischen Insel vertieft. Im Rahmen meiner Facharbeit möchte ich genauer auf die Züchtung varroaresistenter und ertragreicher Honigbienen eingehen. Da ich selber eine kleine Imkerei habe, liegen mir bereits praktische Erfahrungen zu verschiedenen Züchtungsmethoden vor, welche aber auf der Züchtung leistungsstärkerer Bienen in der Honigproduktion basieren.
4 2 2. Varroa-Toleranz Das beste Beispiel für ein stabiles Parasit-Wirt-Gleichgewicht zwischen Varroa-Milben und Honigbienen ist die östliche Honigbiene. Sie hat es durch spezifische Wirtsfaktoren geschafft, die Milbenpopulation ausreichend zu kontrollieren, sodass die Schäden der Milbe im Bereich des Erträglichen liegen. Der Parasit pflanzt sich dort nur erfolgreich in Drohnenbrut fort, jedoch nicht in Arbeiterinnenbrut. Somit ist die Varroa-Reproduktion nur auf die Drohnenbrut begrenzt. Außerdem werden von der Varrose befallene Zellen erkannt und eingesargt, so dass die Puppe und die Varroa-Milbe dauerhaft in der Brutzelle eingeschlossen werden. Auf diese Weise wird ein Großteil der Milbenpopulation beseitigt. In Völkern von östlichen Honigbienen beobachtete man auch das effektive Hygieneverhalten namens Grooming. Hierrunter versteht man das Beseitigen von Milben, durch gegenseitiges Putzen der adulten Bienen. Ein weiteres Hygieneverhalten ist das VSH-Verhalten (Varroa Sensible Hygiene), wo die befallenen Drohnenzellen durch Arbeiterrinnen bestimmt, geöffnet und nach draußen gebracht werden. Alle diese Eigenschaften fehlen der europäische Honigbiene ganz oder sind nur ansatzweise vorhanden. Um dies zu ändern, wurden bereits mehrere Versuche unternommen, unsere Bienenvölker daraufhin zu selektieren und gezielt zu züchten. Auch auf der Basis natürlicher Selektion wurde versucht resistente Bienen zu finden, wie z.b. in Schweden im sogenannten Gotland-Projekt. 3. Gotland Projekt Im Normalfall werden Bienenvölker jährlich chemisch behandelt, damit die Varroa- Population unter der Schadensschwelle gehalten wird. Jedoch wird beim chemischen Behandeln den Bienenvölkern die Möglichkeit genommen, eine natürlichen Selektion zu bilden. Die Selektion sollte zu einem langfristigen Ausgleich zwischen Wirt und Parasit
5 3 führen. Diese Theorie wurde ( ) in einer Langzeituntersuchung auf der Insel Gotland in Schweden bestätigt. Für die Durchführung des Projekts wurden 150 Bienenvölker, verschiedenster nordeuropäischer Bienenrassen gewählt, welche unter einem Ausgangs-Varroa-Befall von 3% (3 Varroen je 100 Bienen) litten. Innerhalb von drei Jahren reduzierte sich die Anzahl der Völker durch hohe Winterverluste extrem. Von den 150 Bienenvölkern lebten nach drei Jahren nur noch 23 Völker. Seitdem hält sich die Anzahl der Bienenvölker auf einem niedrigen, jedoch stabilen Niveau. Man untersuchte daraufhin diese Völker genauer. Dabei wurde festgestellt, dass jene Völker, die eine relativ geringe Anzahl von Bienen aufweisen, überwintern. Somit werden die Überwinterungschancen der Milben reduziert. Darüberhinaus ist das Reproduktionsvermögen der Milbe in den Projektvölkern deutlich eingeschränkt. Allerdings sind diese Gotlandbienen aufgrund eines geringen Honigertrages und deren unerwünschte Verhaltensweisen (z.b.: Stechfreudigkeit) keine nachhaltige Lösung für die Imkerei. Es wurde genetisches Material an die Martin-Luther-Universität in Halle weitergegeben, um dort genauere genetische Untersuchungen durchzuführen. Diese Untersuchungen waren erfolgreich. Es konnte im Genom QTL s (Quantitative Trait Locus = Ort im Genom, der ein oder mehrere Gene enthält, die an der Ausprägung eines quantitativen Merkmals beteiligt sind. 1 ) auf drei Chromosomen identifiziert werden, die zur Herleitung eines Zuchtprogramms hilfreich sein könnten. Jedoch bedarf es hier noch weiterer Forschungen. Diese erfolgen auf der Grundlage von gewonnenen Kenntnissen aus der Imkerei. Nachfolgend möchte ich daher auf die Regeln der Vererbung, deren Anwendung bei der Züchtung und die künstliche Besamung der Honigbiene näher eingehen. 1
6 4 4. Vererbung Vererbung ist die Übertragung bestimmter Merkmale und Eigenschaften von den Vorfahren auf die Nachkommen 2 Die Lehre von der Vererbung und der Veränderlichkeit der Lebewesen wird als Genetik bezeichnet. Die ererbten Eigenschaften beruhen auf Genen oder Erbanlagen, deren Kombination und Wirkung bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegen. 4.1 Zellteilung Bei der Zellteilung verdichten sich die Chromatinfäden und gehen von der Funktionsform in die Transportform über. Es bilden sich die Chromosomen, deren Anzahl und Form für jede Tierart charakteristisch ist. Die Chromosomen liegen paarig vor bei der Biene sind das 16 Chromosomenpaare. Jeweils ein Teil von den 16 stammen vom Vater und der andere von der Mutter ab. So bestehen auch die Gene als Genpaare oder Allele. Beide Partner können eine andere Ausprägung des betreffenden Merkmals haben. Zum Beispiel kann das väterliche Gen, bezüglich der Farbe die Anlage braun, das mütterliche die Anlage schwarz, vererben. Daraufhin reproduzieren die Chromosomenpaare jeweils ein weiteres identisches Chromosomenpaar. So das nach der Teilung die Zellkerne der Tochterzelle die gleiche Anzahl von Chromosomenpaaren aufweisen, wie die der Mutterzelle. 4.2 Zellverschmelzung Zellverschmelzung ist die Voraussetzung für die Entstehung eines neuen Lebewesens. Dabei verschmelzen zwei Geschlechtszellen verschiedenen Geschlechtes, die durch das Zusammentreffen von Ei und Spermium vollzogen wird (Befruchtung). Das Spermium besteht aus Hals, Kopf und Schwanz. Das Ei besteht hingegen neben dem Erbgut aus nährstoffreichem Plasma, welches zum Entwickeln des Embryos benötigt wird. Die 2 Das Imkerbuch von Gisela Droege (S. 190)
7 5 Samenzelle dringt ohne Schwanz in das Ei ein und verschmilzt anschließend mit ihm. Bei der Biene geschieht dies etwa 3 bis 4 Stunden nach der Eiablage. 4.3 Reifeteilung Bei der diploiden weiblichen Geschlechtszelle wird während des Reifeteilungsprozesses der Geschlechtszellen die Chromosomenzahl auf die Hälfte reduziert. Hierbei bleibt es dem Zufall überlassen, wie viel und welche Chromosomen aus dem mütterlichen und aus dem väterlichen Chromosomensatz kommen. Die aus unbefruchteten Eiern entstehenden Drohnen sind von immer haploid, besitzen also 16 Einzelchromosomen. Hier findet keine Reifeteilung statt. Deshalb sind auch alle Spermien, die ein Drohn erzeugt, einander gleich und reinerbig: sie haben alle die gleichen Erbanlagen wie die Eizellen, aus der der Drohn entstanden ist. Sobald die Befruchtung stattgefunden hat, ist der diploide Chromosomensatz wieder hergestellt. Jeder weibliche Nachkomme der Biene hat die eine Hälfte der Erbanlagen von der Mutter und die andere Hälfte vom Vater erhalten. 4.4 Vererbung des Geschlechts In der Bienenzucht wird das Geschlecht nicht durch unterschiedliche Geschlechtschromosomen (X- bzw. Y-Chromosomen), sondern durch ein Geschlechtsgen oder Sexallel bestimmt. Denn das Y-Chromosom, welches meist entscheidend für das männliche Geschlecht ist, fehlt bei den Bienen. Ein weibliches Tier (Arbeitsbiene oder Weisel) entsteht, wenn im Zellkern zwei X- Chromosomen vorhanden sind (diploider Chromosomensatz). Dies ist bei befruchteten Eiern der Fall: sie enthalten von beiden Elternteilen ein X-Chromosom. Aus dem unbefruchteten Ei, mit nur einem X-Chromosom, entsteht eine Drohne. Voraussetzung für die Entwicklung eines weiblichen Tiers ist allerdings, dass sich die beiden X-Chromosomen teilweise unterscheiden (multiple Allelie). Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit hierfür relativ gering, dass bei der Befruchtung vollkommen gleiche X- Chromosomen zusammentreffen. Bei wiederholter und enger Verwandschaftspaarung tritt
8 6 dieser Fall häufiger auf. Infolgedessen entstehen Drohnenmaden mit einem diploiden Chromosomensatz, der durch die fehlende Unterschiedlichkeit der Sexallele zustandekommt. Diese Drohnenmaden werden schon im jüngsten Stadium von den Bienen aufgefressen. Durch die Inzucht kann es zu Brutausfällen kommen, welche bis zu 50% der Brut betreffen können. Dadurch wird, neben den Inzuchtdepressionen, durch mangelnde Volksstärke, die Leistungsfähigkeit eines Bienenvolkes stark eingeschränkt. Unter der Inzuchtdepression versteht man die Reduktion der Leistung von ingezüchteten Populationen Vererbungsgesetze und -begriffe Bei allen Lebewesen erfolgt die Vererbung nach denselben Grundgesätzen. Diese Grundsätze notierte Gregor Mendel Mitte des 19. Jahrhunderts in den nach ihn benannten Mendelschen Regeln. Sie weisen auch heute noch Gültigkeit auf, obwohl inzwischen weitere neue Kenntnisse in der Genetik getroffen wurden. In der Bienengenetik gibt es eine Reihe von biologischen Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind: Die Königin paart sich mit mehreren Drohnen. Dadurch tritt, außer bei der künstlichen Besamung mit Sperma von nur einem Drohn, eine stärkere Streuung der Merkmale auf. Da die Drohnen nur aus unbefruchteten Eiern bestehen, geben sie folglich nur mütterliches Erbgut weiter. Sie sind somit genetisch der Mutter gleichzusetzen. Es tritt auch keine Neukombination von Chromosomen ein, da bei der Spermareife die Reduktionsteilung unterbleibt. Die Drohnen haben nur einen halben (haploiden) Chromosomensatz, daher kann es nicht zu einer Überdeckung der Gene kommen (Dominanz). Deshalb kann ein Drohn nicht mischerbig sein. Arbeitsbienen haben einen diploiden Chromosomensatz, weshalb sie nur die Hälfte ihrer Erbanlage mit den haploiden Drohnen gemeinsam haben. Um den Drohn 3
9 7 züchterisch zu beurteilen, ist deshalb nicht die Leistung des eigenen Volkes, sondern desjenigen Volkes ausschlaggebend, dem die Mutter entspringt. Es gibt bei der Honigbiene zwei verschiedene weibliche Tiere. Die weibliche Larve kann sich auf derselben erblichen Grundlage unter Einfluss der Ernährung zur Königin oder zur Arbeiterin entwickeln. Das weitergegebene Erbgut von der Weisel 4 an die Arbeiterinnen tritt bei ihr größtenteils nicht in Erscheinung. Also können die Erbeigenschaften erst an deren Nachkommen untersucht werden. 5.1 Mendelsche Regeln Uniformitätsgesetz Bei der Verpaarung von zwei reinerbigen Lebewesen, die sich in bestimmten Merkmalen unterscheiden, sind die Nachkommen in diesem Merkmal untereinander gleich (uniform). Die Merkmale nehmen dabei entweder eine Zwischenstellung zu den Eltern ein (intermediärer Erbgang) oder gleichen einem Elternteil (dominanter Erbgang). Bei der intermediären Vererbung sind die Merkmale beider Partner gleich stark ausgeprägt. Demnach sind Bastarde im intermediärem Erbgang leicht zu erkennen. Jedoch wirken die Allele eines Gens nicht immer gleich stark. Ein Allel kann durch seine Dominanz das andere überdecken. Die schwächere, überdeckte Merkmalsprägung wird als rezessiv und die stärkere als dominant bezeichnet. Am Phänotyp lässt sich nicht erkennen, ob es in der F 1 -Generation (in Bezug auf das Merkmal) reinerbig ist. Mit dem Beispiel der Cordovan-Biene lässt sich die dominante Vererbung gut darstellen. Diese Rasse ist eine Mutation der Carnica-Biene, deren Chitin des Körperpanzers lederbraun aufgehellt ist. Das Merkmal der Cordovan-Biene ist rezessiv, das der Carnica hingegen ist dunkelbraun und dominant. Bei einer Kreuzung der Rassen sind die 4 die Weisel=Königin
10 8 Nachkommen dunkelbraun. Nur die Drohnen die aus unbefruchteten Eiern einer Cordovan- Weisel entstandenen sind, haben demnach einen lederbraun aufgehellten Chitin Panzer. Allgemein gilt: Kreuzt man Lebewesen einer Art, die sich in einem Merkmal unterscheiden, für das sie reinerbig sind, so sind die Nachkommen in der F 1 -Generation in Bezug auf dieses Merkmal untereinander gleich (=uniform). 5 Abbildung 1 5 Netzwerk Biologie von Antje Starke (S. 10)
11 Spaltungsgesetz Bei einer Kreuzung der F 1 -Tiere untereinander spalten die weiblichen Nachkommen der folgenden F 2 -Generation bei intermediärem Erbgang im Verhältnis 1:2:1 auf, das bedeutet: 25% der weiblichen Nachkommen sind reinerbig und gleichen dem einen Großelternteil 50% der weiblichen Nachkommen sind mischerbig und gleichen den Eltern (Zwischenstellung) 25% der weiblichen Nachkommen sind reinerbig und gleichen dem anderen Großelternteil Demnach sind je 50% der weiblichen Nachkommen reinerbig und mischerbig. Die 2. Mendelsche Regel gilt auch für den dominanten Erbgang. Die Aufspaltung geht genetisch ebenfalls im Verhältnis 1:2:1 vor sich. Jedoch spalten die weiblichen Nachkommen im Phänotyp im Verhältnis 1:3 auf. Während die Drohnen der mischerbigen Königin am Beispiel Cordovan teils reinerbig dunkel, teils reinerbig cordovan sind, zeigen sich unter den weiblichen Nachkommen 75% dunkel und 25% hell. Unter den Dunklen sind 50% mischerbig, 25% reinerbig genotypisch. Aufgrund der Reinerbigkeit der Drohnen lässt sich an der männlichen Nachkommenschaft prüfen, ob eine Weisel reinerbig oder mischerbig ist. Eine reinerbige Weisel bringt einheitliche Drohnen, eine mischerbige hingegen bringt unterschiedliche Drohnen hervor. Allgemein gilt: Kreuzt man die Mischlinge der F 1 - Generation (Tochtergeneration) untereinander, so spaltet sich die F 2 - Generation (Enkelgeneration) in einem bestimmten Zahlenverhältnis auf. Dabei treten auch die Merkmale der Elterngeneration wieder auf
12 10 Abbildung 2 Abbildung 3
13 Unabhängigkeitsgesetz Bei der Bildung von Geschlechtszellen spalten sich die Gene in verschiedenen Chromosomen unabhängig voneinander auf. So entstehen bei den Nachkommen unterschiedlich veranlagter Partner zahlreiche Neukombinationen der einzelnen Erbanlagen, da die mütterlichen und väterlichen Chromosomen in den Keimzellen zufällig verteilt sind. Allgemein gilt: Kreuzt man Lebewesen einer Art, die sich in mehreren Merkmalen reinerbig unterscheiden, so werden die einzelnen Gene bei der Bildung der Geschlechtszellen unabhängig voneinander verteilt. Bei der Befruchtung können die Gene dann in neuen Kombinationen zusammentreten. 7 Diese beschriebenen Gesetzmäßigkeiten finden bei der Züchtung der Honigbiene ihre Anwendung. 6. Züchtung Die Züchtung ist das zielgerichtete Anwenden genetischer Erkenntnisse zur Steigerung der Leistungen. 8 In der Imkerei ist man bestrebt eine Steigerung der Honig- und Wachsleistung der Biene sowie der Bestäubungsaktivität zu erreichen. Es wird versucht die Widerstandsfähigkeit der Honigbiene gegen Krankheiten und Parasiten, wie der Varroa-Milbe, zu stärken. Sanftmütige, wabenstete und schwarmträge Bienen ermöglichen die Imkerei effizienter zu betreiben. Deshalb ist neben einer guten Trachtgrundlage und der optimalen Technologie die Züchtung einer leistungsstarken Biene die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Bienenwirtschaft. 7 Netzwerk Biologie von Antje Starke (S. 13) 8 Das Imkerbuch von Gisela Droege (S. 198)
14 12 Für die gezielte Züchtung von leistungsstarken Bienen eignet sich die Form der Heterosiszüchtung. 6.1 Heterosis /Heterosiseffekt Unter Heterosis wird die genetisch bedingte Leistungsüberlegenheit von Kreuzungsprodukten gegenüber dem Ausgangsmaterial verstanden. Dieser von Schull (1914) geprägte und definierte Begriff gilt als Abkürzung für Stimulus der Heterozygotie. 9 Durch planmäßige Kombinationen verschiedenster Erbanlagen können auf Basis der Reinerbigkeit bedeutende Leistungssteigerungen erzielt werden. Unter dieser Leistungssteigerung, auch Heterosiseffekt genannt, versteht man den Leistungsanstieg der Nachkommen über den Mittelwert der Elternleistung. Viele positive Erscheinungen der Heterosis haben ihre Ursache im heterozygoten (mischerbigem) Erbgut. Ein Individuum ist heterozygot, wenn ein Gen in den diploiden Chromosomensätzen in zwei verschiedenen Ausprägungen (Allelen) vorliegt. Des Weiteren ist es möglich, dass Gene zusammentreffen, die sich in ihrer Wirkung verstärken. Das Vorhandensein dominanter Gene kann zu noch stärkeren Effekten führen. Beispiel: Es werden zwei reinerbige Tiere gekreuzt von denen jedes eine andere Ausprägung der betreffenden Anlage nachweist. Eltern: AbAb x abab F 1 -Generation: AbaB Es entsteht eine Überdominanz, da die Gene A des einen und B des anderen Elternteile dominant sind und sich somit gegenseitig verstärken. Laut dem Mendelschen Uniformitätsgesetz besitzt die F 1 -Generation einheitlich beide dominanten Gene. Demnach 9 Lexikon der Bienenkunde von Johannes Otto Hüsing/Joachim Nitschmann (S. 166)
15 13 wird die betreffende Anlage bei den Nachkommen stärker ausgeprägt, als bei den Eltern. Es können so auch Gene in ihrer Wirkung verstärkt werden. Nicht bei allen Kreuzungen von reinerbigen Tieren wird ein Heterosiseffekt hervorgerufen. Der Züchter ermittelt die zueinander passenden Partner, indem er die jeweiligen Kombinationen testet (Passertests). Allerdings geht in den Folgegenerationen der Heterosiseffekt durch Aufspaltung der Gene verloren. 6.2 Heterosiszüchtung Heterosiszüchtung ist die Anwendung von Zuchtverfahren zur Ausnutzung von Heterosis 10 Um den Heterosiseffekt zu erzielen, werden mehrere Linien einer Rasse in Inzucht gehalten. Voraussetzung hierfür ist die kontrollierte Verpaarung, bestenfalls auf dem Wege der künstlichen Besamung. Einige Linien fallen infolge der Inzuchtdepressionen aus. Die Kreuzungen der Inzuchtlinien werden aufgrund der Ergebnisse von Passertests ermittelt. Für die Ausnutzung von Heterosis in der Bienenzüchtung gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die rekurrente Selektion und die rekurrente reziproke Selektion Rekurrente Selektion Bei der rekurrenten Selektion wird eine Anzahl von Weiseln einer Linie an eine konstante Prüfungslinie, den Tester, in der Bienenzucht an die Vaterlinie einer Belegstelle, angepaart. Als Eltern für die Aufzucht der nächsten Generation werden dann von Generation zu Generation immer wieder solche Tiere gewählt, die mit der Prüfungslinie die besten 10 Lexikon der Bienenkunde von Johannes Otto Hüsing/Joachim Nitschmann (S.166, 167)
16 14 Kombinationen ergeben. Die Eltern werden also nicht nach ihrem Phänotyp (Eigenleistung), sondern nach der Leistung der Nachkommenschaft selektiert. Voraussetzung für eine erfolgreiche Nachkommenschaftsprüfung ist hierbei die ausreichende Langlebigkeit der zu prüfenden Weiseln. Auch Kurzleistungstests in der Frühtracht, Saugtests (Futteraufnahmegeschwindigkeit bei Jungbienen) und die Ermittlung der Brutentwicklung können die rechtzeitige Zuchtwertschätzung ermöglichen Rekurrente reziproke Selektion Für die rekurrente reziproke Selektion werden zwei Linien wechselseitig auf Kombinationseignung gezüchtet. Die Selektion wird in beiden Linien nach den Ergebnissen der Kreuzung durchgeführt. Beide Linien werden reziproke, also A-Weiseln x B-Drohnen und A-Drohnen x B-Weiseln, miteinander verpaart. Aufgrund der Kreuzung werden die besten Eltern selektiert und innerhalb der Linie gepaart, also A-Weiseln x A-Drohnen und B-Weiseln x B-Drohnen. Auch hier ist die Nachkommenschaftsprüfung eine wichtige Voraussetzung. Mit den Kreuzungsprodukten wird, wie auch bei der rekurrenten Selektion nicht weitergezüchtet. Um die erforderliche Anzahl von Vatertieren testen zu können, kann diese Methode nur im Zusammenhang mit der künstlichen Besamung erfolgen.
17 15 Abbildung 4 7. Künstliche Besamung Bei der natürlichen Paarung fliegt die Weisel zu einem Drohnensammelplatz und wird dort im Durchschnitt von 8 Drohnen im freien Flug unkontrolliert begattet. Jedoch ist ohne kontrollierte Paarung die Zuchtarbeit sehr erschwert. Dies bezieht sich nicht nur auf den Honigertrag und die Schwarmträgheit, sondern auch auf die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Parasiten z.b. gegen die Varrose. Deshalb ist die künstliche Besamung der Königin für das gezielte Züchten am effektivsten, denn sie ist die einzige Methode, wo die Zuchtarbeit kontrolliert und sicher vor äußeren Einflüssen abläuft.
18 16 Abbildung 5: Besamungsgerät nach Winkler Die künstliche Besamung der Bienenkönigin läuft instrumentell mit einem Besamungsapparat ab. Es handelt sich hierbei um ein Gestell mit Halterungen für einen Ventral- und einen Schachtelhaken, eine Besamungsspritze sowie die zu besamende Weisel. Außerdem wird noch ein Stereomikroskop mit 15 bis 20facher Vergrößerung benötigt, sowie eine Narkosevorrichtung zur Ruhigstellung der Königin. Bei der Gewinnung des Spermas werden geschlechtsreife Drohnen zum Ausstülpen des Begattungsschlauches gebracht. Dies wird verursacht, indem ihr Hinterleib massiert, gezupft und gedrückt wird. Das sich auf der Spitze des Begattungsschlauches befindende Sperma wird mit der Besamungsspritze angesaugt und für die nächste Besamung aufbewahrt. Um eine Königin künstlich zu begatten wird das Sperma von 8 bis 10 Drohnen benötigt.
19 17 Zur Besamung wird die Königin im Weiselhalter befestigt. Der Hinterleib ragt aus dem Halteröhrchen heraus, um später die Königin künstlich zu besamen. Über einen Narkosestöpsel wird die Weisel mit CO 2 narkotisiert. Die Stachelkammer der Weisel wird mit Hilfe der Haken des Besamungsapparates geöffnet und die Besamungsspritze wird in die Scheidenöffnung eingeführt. Eine Spritze drückt die in die Scheide hineinragende Scheidenklappe herunter, um anschließend die Spritze weit genug ins Innere zu befördern. Nach der Besamung wird die Weisel wieder in ihr Volk gesetzt.
20 18 8. Quellen- und Literaturverzeichnis Bücher Autor/-en Titel Jahr Ort Verleger Gisela Droege Das Imkerbuch 1984 Berlin VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag (S , 195, 198, 200, 201) Johannes Otto Hüsing, Joachim Nitschmann Antje Starke Lexikon der Bienenkunde Netzwerk Biologie (Lehrbuch) 1987 Leipzig Grafische Werke Zwickau (S. 166, 167, 200, 228, 220, 291, 359) 2006 Braunschweig Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH (S ) Webseiten Name der Website Letzter Zugriff URL Uni Hohenheim Imkerforum
21 19 Landlive / 3sat Apis-melliferamellifera mellifera.de/downloads/mechanismen-der- varroatoleranz.pdf Aristabeeresearch aristabeeresearch.org/de/varroa-resistenz/ Resistantbees Instrumentelle Besamung Transgen Wikipedia Wikipedia Frustfrei lernen Masterarbeit Eva Frey rce=web&cd=1&ved=0ahukewjgspr9opbrahve2rok Hf8zAL4QFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uni - hohenheim.de%2fqisserver%2frds%3fstate%3dmedial oader%26objectid%3d4768%26application%3dlsf&usg =AFQjCNEG9BRwLTj_rHj_U9NDhqwMXUMyOw&s
22 20 ig2=jm-vyrap2pvpgn4fxrcb7w Besamungsgerät dt/ Bilder Bezeichnung Quelle Abbildung 1 Das Imkerbuch von Gisela Droege (S. 192) Abbildung 2 Das Imkerbuch von Gisela Droege (S. 193) Abbildung 3 Das Imkerbuch von Gisela Droege (S. 193) Abbildung 4 Das Imkerbuch von Gisela Droege (S. 201) Abbildung 5: Besamungsapparat nach Winkler dt/wpcontent/uploads/kompl x511.jpg
Vererbungsgesetze, Modell
 R Vererbungsgesetze, Modell 65564.00 Betriebsanleitung Das Model besteht aus einem Satz von 204 Symbolkarten und 3 Kreuzungs- und Nachkommenslinien. 81 der Symbolkarten zeigen Erscheinungsbilder (Phänotypen),
R Vererbungsgesetze, Modell 65564.00 Betriebsanleitung Das Model besteht aus einem Satz von 204 Symbolkarten und 3 Kreuzungs- und Nachkommenslinien. 81 der Symbolkarten zeigen Erscheinungsbilder (Phänotypen),
Marco Plicht. Biologie
 Marco Plicht Biologie Zeichenlegende Die Uhr läuft mit: der Lernstoff ist aufgeteilt in Viertel-Stunden-Lernportionen. Zusammen ergibt das den 5h-Crashkurs! Weitere Titel dieser Reihe: Anatomie fast Chirurgie
Marco Plicht Biologie Zeichenlegende Die Uhr läuft mit: der Lernstoff ist aufgeteilt in Viertel-Stunden-Lernportionen. Zusammen ergibt das den 5h-Crashkurs! Weitere Titel dieser Reihe: Anatomie fast Chirurgie
Können Gene Depressionen haben?
 Können Gene Depressionen haben? DTzt. Chromosomen, Gene und so... Die Sache mit der Vererbung oder warum sieht eine Kuh aus wie eine Kuh? Die kleinste Datenbank Desoxyribonukleinsäure - DNA Speicher für
Können Gene Depressionen haben? DTzt. Chromosomen, Gene und so... Die Sache mit der Vererbung oder warum sieht eine Kuh aus wie eine Kuh? Die kleinste Datenbank Desoxyribonukleinsäure - DNA Speicher für
"Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr / Paket von 6 Sätzen
 "Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr. 2013336 / 2013337 Paket von 6 Sätzen Zusammensetzung Der Einzelsatz besteht aus: 2 blauen Sätzen mit 3 Chromosomen + 1 Geschlechtschromosom + 1 Stück von einem
"Chromosomen Didac 2" Einzelsatz Best.- Nr. 2013336 / 2013337 Paket von 6 Sätzen Zusammensetzung Der Einzelsatz besteht aus: 2 blauen Sätzen mit 3 Chromosomen + 1 Geschlechtschromosom + 1 Stück von einem
Züchterische Grundlagen Mendel-Regeln
 Züchterische Grundlagen Mendel-Regeln Ausbildung zum Bienenwirtschaftsmeister Mai 2012 Christian Boigenzahn Der Pionier Geboren 1822 in Brünn Studium der Physik, Mathematik u. Naturwissenschaften an der
Züchterische Grundlagen Mendel-Regeln Ausbildung zum Bienenwirtschaftsmeister Mai 2012 Christian Boigenzahn Der Pionier Geboren 1822 in Brünn Studium der Physik, Mathematik u. Naturwissenschaften an der
2. Übung: Chromosomentheorie
 Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Regeln zur Vererbung Autosomal rezessiv: - Merkmal tritt auf in Nachkommen nicht betroffener Eltern
Konzepte: 2. Übung: Chromosomentheorie Mitose/Meiose Geschlechtschromosomale Vererbung Chromosomentheorie Regeln zur Vererbung Autosomal rezessiv: - Merkmal tritt auf in Nachkommen nicht betroffener Eltern
Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern
 Züchterversammlung 2009 Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern (nach: Genetik und Züchtungslehre, von Heinrich Binder, Dr. med. vet., Dozent für Tierzucht am Tierspital ZH) überarbeitet
Züchterversammlung 2009 Grundlagen zur Vererbung von Eigenschaften und Fehlern (nach: Genetik und Züchtungslehre, von Heinrich Binder, Dr. med. vet., Dozent für Tierzucht am Tierspital ZH) überarbeitet
PSSM1 Fortpflanzung / Vererbung / Paarungsverbot
 F é d é r a t i o n p o u r l ' é l e v a g e, j e u x e t s p o r t H a f l i n g e r p u r - s a n g s e l e c t i o n - s e l l e, s u i s s e A d r e s s e : H a - p s s s., I m p a s s e d e s C h
F é d é r a t i o n p o u r l ' é l e v a g e, j e u x e t s p o r t H a f l i n g e r p u r - s a n g s e l e c t i o n - s e l l e, s u i s s e A d r e s s e : H a - p s s s., I m p a s s e d e s C h
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Genetik & Vererbung. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Genetik & Vererbung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Genetik & Vererbung Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Vorwort Seite 4 Einleitung Seite
Die Chromosomen sind im Zellkern immer paarweise vorhanden. In der menschlichen Zelle befinden sich 23 Chromosomenpaare. Diese bilden den diploiden
 Die Chromosomen Die Chromosomen sind Träger der Erbinformation. Unter dem Mikroskop erscheinen sie in verschiedenen Formen. Einmal als gekrümmte oder gedrungene Stäbchen, in deren Mitte sich eine Ein-schnürung
Die Chromosomen Die Chromosomen sind Träger der Erbinformation. Unter dem Mikroskop erscheinen sie in verschiedenen Formen. Einmal als gekrümmte oder gedrungene Stäbchen, in deren Mitte sich eine Ein-schnürung
Chromosomen & Populationsgenetik (1)
 Übungsblatt Molekularbiologie und Genetik für Studierende der Bioinformatik II 1 Name des Studierenden: Datum: 1 Karyogramme Chromosomen & Populationsgenetik (1) Bestimmen Sie den Karyotyp der folgenden
Übungsblatt Molekularbiologie und Genetik für Studierende der Bioinformatik II 1 Name des Studierenden: Datum: 1 Karyogramme Chromosomen & Populationsgenetik (1) Bestimmen Sie den Karyotyp der folgenden
Keispelt KV CAPELLEN 2015 BRUTHYGIENE UND VARROA SENSITIVE HYGIENIC IN DER PRAKTISCHEN ZUCHTAUSLESE. Paul Jungels
 BRUTHYGIENE UND VARROA SENSITIVE HYGIENIC IN DER PRAKTISCHEN ZUCHTAUSLESE Paul Jungels Die bis am die Grenzen der möglichen Vereinfachung geführten Beispiele zeigen dennoch konkret, wie der Imkerzüchter
BRUTHYGIENE UND VARROA SENSITIVE HYGIENIC IN DER PRAKTISCHEN ZUCHTAUSLESE Paul Jungels Die bis am die Grenzen der möglichen Vereinfachung geführten Beispiele zeigen dennoch konkret, wie der Imkerzüchter
Station 1. Aufgaben zu den Mendelschen Regeln
 Station 1 Aufgaben zu den Mendelschen Regeln Arbeitsblatt 1 zu Station 1 Aufgabe 1 Formuliere die erste Mendelsche Regel. Aufgabe 2 Erläutere die folgenden Fachbegriffe. Name homozygot heterozygot reinerbig
Station 1 Aufgaben zu den Mendelschen Regeln Arbeitsblatt 1 zu Station 1 Aufgabe 1 Formuliere die erste Mendelsche Regel. Aufgabe 2 Erläutere die folgenden Fachbegriffe. Name homozygot heterozygot reinerbig
ERBKRANKHEITEN (mit den Beispielen Albinismus, Chorea Huntington, Bluterkrankheit u. Mitochondriopathie)
 ERBKRANKHEITEN (mit den Beispielen Albinismus, Chorea Huntington, Bluterkrankheit u. Mitochondriopathie) Als Erbkrankheit werden Erkrankungen und Besonderheiten bezeichnet, die entweder durch ein Gen (monogen)
ERBKRANKHEITEN (mit den Beispielen Albinismus, Chorea Huntington, Bluterkrankheit u. Mitochondriopathie) Als Erbkrankheit werden Erkrankungen und Besonderheiten bezeichnet, die entweder durch ein Gen (monogen)
Wie werden Keimzellen gebildet?
 Wie werden Keimzellen gebildet? Keimzellen (Samenzellen und Eizelle) werden über eine neue Kernteilungsform erzeugt: die MEIOSE ( Reifeteilung I und II) Eizelle mit Zellkern Samenzellen mit Erbmaterial
Wie werden Keimzellen gebildet? Keimzellen (Samenzellen und Eizelle) werden über eine neue Kernteilungsform erzeugt: die MEIOSE ( Reifeteilung I und II) Eizelle mit Zellkern Samenzellen mit Erbmaterial
Grundlagen der Vererbung beim Hund
 Grundlagen der Vererbung beim Hund Züchterstammtisch: 10. August 2013 Referentin: Diana Ringpfeil Tätigkeit: Tierärztin Mail: Ringpfeil@arcor.de Referent: Kay Rostalski Diana Ringpfeil, Tierärztin, Kay
Grundlagen der Vererbung beim Hund Züchterstammtisch: 10. August 2013 Referentin: Diana Ringpfeil Tätigkeit: Tierärztin Mail: Ringpfeil@arcor.de Referent: Kay Rostalski Diana Ringpfeil, Tierärztin, Kay
Genetik einmal anders erklårt:
 Genetik einmal anders erklårt: Die Gene sind an allem Schuld! Warum sind manche Menschen groä und andere klein, manche haben blondes, glattes andere gelocktes, braunes Haar? Die Gene sind an allem Schuld.
Genetik einmal anders erklårt: Die Gene sind an allem Schuld! Warum sind manche Menschen groä und andere klein, manche haben blondes, glattes andere gelocktes, braunes Haar? Die Gene sind an allem Schuld.
Kreuzung zweier Pflanzen, einer gelbsamigen und einer grünsamigen Erbsenrasse
 Arbeitsblatt 1 Kreuzung zweier Pflanzen, einer gelbsamigen und einer grünsamigen Erbsenrasse P = Parentalgeneration (Elterngeneration), F 1 = 1. Filialgeneration (1. Tochtergeneration) 1. Beschreibe die
Arbeitsblatt 1 Kreuzung zweier Pflanzen, einer gelbsamigen und einer grünsamigen Erbsenrasse P = Parentalgeneration (Elterngeneration), F 1 = 1. Filialgeneration (1. Tochtergeneration) 1. Beschreibe die
Begleittext zum Foliensatz Erbgänge beim Menschen
 Für ein besseres Verständnis der Folien werden vorab einige Begriffe definiert: Gen Genom Allel Ein Gen ist die physikalische und funktionelle Einheit der Vererbung. Biochemisch ist es eine geordnete Abfolge
Für ein besseres Verständnis der Folien werden vorab einige Begriffe definiert: Gen Genom Allel Ein Gen ist die physikalische und funktionelle Einheit der Vererbung. Biochemisch ist es eine geordnete Abfolge
Evolution, Genetik und Erfahrung
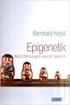 Chromosomen, Fortpflanzung und Genkopplung Entscheidende Entdeckung: Gene sind auf Chromosomen lokalisiert! 1 CHROMOSOM fadenförmige Strukturen im Kern der Zellen (wikipedia) Chromosomen in Körperzellen
Chromosomen, Fortpflanzung und Genkopplung Entscheidende Entdeckung: Gene sind auf Chromosomen lokalisiert! 1 CHROMOSOM fadenförmige Strukturen im Kern der Zellen (wikipedia) Chromosomen in Körperzellen
Drohnenflugweiten und Paarungsdistanzen von Königinnen H. Pechhacker; hc.pechhacker@aca.at
 Drohnenflugweiten und Paarungsdistanzen von Königinnen H. Pechhacker; hc.pechhacker@aca.at Zur Geschichte: Die Brüder Hans und Friedrich Ruttner betrieben bereits in der ersten Hälfte der 1950-iger Jahre
Drohnenflugweiten und Paarungsdistanzen von Königinnen H. Pechhacker; hc.pechhacker@aca.at Zur Geschichte: Die Brüder Hans und Friedrich Ruttner betrieben bereits in der ersten Hälfte der 1950-iger Jahre
GENETIK und VERERBUNG
 GENETIK und VERERBUNG 1. Einleitung Epidermolysis bullosa (EB) ist eine Erkrankung, die genetisch bedingt ist, das heißt also, dass die Ursache dafür in den Erbanlagen eines Menschen zu finden ist. Die
GENETIK und VERERBUNG 1. Einleitung Epidermolysis bullosa (EB) ist eine Erkrankung, die genetisch bedingt ist, das heißt also, dass die Ursache dafür in den Erbanlagen eines Menschen zu finden ist. Die
Kleine Einführung in die Vererbungslehre Rezessiver Erbgang, Mendel sche Regeln 1 und 2
 1 Kleine Einführung in die Vererbungslehre Rezessiver Erbgang, Mendel sche Regeln 1 und 2 Gisela Kemper, Bergkirchen Die Tatsache, dass bei vielen unserer Rassehunde leider eine Zunahme der Erbdefekte
1 Kleine Einführung in die Vererbungslehre Rezessiver Erbgang, Mendel sche Regeln 1 und 2 Gisela Kemper, Bergkirchen Die Tatsache, dass bei vielen unserer Rassehunde leider eine Zunahme der Erbdefekte
Wie kann man große Hunde züchten? Spielregeln zum Simulationsversuch
 Wie kann man große Hunde züchten? Spielregeln zum Simulationsversuch Aufgabe: Spielt das Spiel: Wie kann man große Hunde züchten? Ein Größenmerkmal wird durch einen farbigen Chip simuliert. Es gibt vier
Wie kann man große Hunde züchten? Spielregeln zum Simulationsversuch Aufgabe: Spielt das Spiel: Wie kann man große Hunde züchten? Ein Größenmerkmal wird durch einen farbigen Chip simuliert. Es gibt vier
1. Mendelsche Vererbung, Stammbäume:
 1. Mendelsche Vererbung, Stammbäume: typische Stammbäume atypische Stammbäume 2. Allelische und nicht-allelische Mutationen, Komplementationstests 3. Hardy-Weinberg Gleichgewicht 4. Mutation und Selektion,
1. Mendelsche Vererbung, Stammbäume: typische Stammbäume atypische Stammbäume 2. Allelische und nicht-allelische Mutationen, Komplementationstests 3. Hardy-Weinberg Gleichgewicht 4. Mutation und Selektion,
Tierzüchtung. Anforderung des Marktes. Zuchtziel. Zuchtverfahren Leistungsprüfung
 Tierzüchtung nforderung des Marktes Zuchtziel Zuchtverfahren Leistungsprüfung Selektion Verpaarung Populationsgenetik Rechentechnik Mathem. Statistik iotechnologie der Fortpflanzung -Züchtungstechniken
Tierzüchtung nforderung des Marktes Zuchtziel Zuchtverfahren Leistungsprüfung Selektion Verpaarung Populationsgenetik Rechentechnik Mathem. Statistik iotechnologie der Fortpflanzung -Züchtungstechniken
Inhalt des Vortrags. o genetische Grundlagen. o Wie findet man Erbfehler? o Zusammenfassung. Was ist ein Haplotyp?
 Inhalt des Vortrags o genetische Grundlagen Was ist ein Haplotyp? o Wie findet man Erbfehler? basierend auf Phänotypen: Zwergwuchs basierend auf Genotypen: Braunvieh Haplotyp II o Zusammenfassung einige
Inhalt des Vortrags o genetische Grundlagen Was ist ein Haplotyp? o Wie findet man Erbfehler? basierend auf Phänotypen: Zwergwuchs basierend auf Genotypen: Braunvieh Haplotyp II o Zusammenfassung einige
X-chromosomaler Erbgang
 12 Deutsche Gesellschaft für Humangenetik e.v.: Web: www.gfhev.de X-chromosomaler Erbgang Orphanet Frei zugängliche Webseite; dort finden Sie Informationen zu seltenen Erkrankungen, klinischen Studien,
12 Deutsche Gesellschaft für Humangenetik e.v.: Web: www.gfhev.de X-chromosomaler Erbgang Orphanet Frei zugängliche Webseite; dort finden Sie Informationen zu seltenen Erkrankungen, klinischen Studien,
Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick-
 Seite 1 Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick- Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2013 Quellennachweis und weiterführende Links s. Text Herzlichen Dank
Seite 1 Züchtungsverfahren im Pflanzenbau -Ein Überblick- Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2013 Quellennachweis und weiterführende Links s. Text Herzlichen Dank
Unerfüllter Kinderwunsch. Ursachen erkennen, Lösungen finden. Informationen für Paare, die auf ein Baby warten
 Unerfüllter Kinderwunsch Ursachen erkennen, Lösungen finden Informationen für Paare, die auf ein Baby warten Das lange Warten auf ein Baby. Was können Sie tun? Wann sollten Sie sich untersuchen lassen?
Unerfüllter Kinderwunsch Ursachen erkennen, Lösungen finden Informationen für Paare, die auf ein Baby warten Das lange Warten auf ein Baby. Was können Sie tun? Wann sollten Sie sich untersuchen lassen?
Vererbung und Epilepsie
 epi-info Vererbung und Epilepsie www.diakonie-kork.de 1 Was versteht man unter Vererbung, und welche Hauptformen gibt es? Vererbung ist die Weitergabe von Merkmalen von Eltern an ihre Kinder. Dies erfolgt
epi-info Vererbung und Epilepsie www.diakonie-kork.de 1 Was versteht man unter Vererbung, und welche Hauptformen gibt es? Vererbung ist die Weitergabe von Merkmalen von Eltern an ihre Kinder. Dies erfolgt
2.Vererbung. 2.1 Vererbung Weitergabe von Merkmalen an die Nachkommen
 2.Vererbung 2.1 Vererbung Weitergabe von Merkmalen an die Nachkommen In Pauls Nachbarschaft ist eine Familie mit 2 Kindern eingezogen. Eine der beiden Töchter hat Paul schon kennen gelernt. Sofort waren
2.Vererbung 2.1 Vererbung Weitergabe von Merkmalen an die Nachkommen In Pauls Nachbarschaft ist eine Familie mit 2 Kindern eingezogen. Eine der beiden Töchter hat Paul schon kennen gelernt. Sofort waren
Proseminarvortrag. Markov-Ketten in der Biologie (Anwendungen)
 Proseminarvortrag Markov-Ketten in der Biologie (Anwendungen) von Peter Drössler 20.01.2010 2 Markov-Ketten in der Biologie (Peter Drössler, KIT 2010) Inhalt 1. Das Wright-Fisher Modell... 3 1.1. Notwendige
Proseminarvortrag Markov-Ketten in der Biologie (Anwendungen) von Peter Drössler 20.01.2010 2 Markov-Ketten in der Biologie (Peter Drössler, KIT 2010) Inhalt 1. Das Wright-Fisher Modell... 3 1.1. Notwendige
In unseren Beispielen bilden Valeria und Arnold ein theoretisches Paar - und geben wir zu, ein Paar das viel Pech im Leben hat das selber und auch
 In unseren Beispielen bilden Valeria und Arnold ein theoretisches Paar - und geben wir zu, ein Paar das viel Pech im Leben hat das selber und auch Ihre Familien an zahlreichen genetischen Krankheiten leiden.
In unseren Beispielen bilden Valeria und Arnold ein theoretisches Paar - und geben wir zu, ein Paar das viel Pech im Leben hat das selber und auch Ihre Familien an zahlreichen genetischen Krankheiten leiden.
Königinnenaufzucht/ Ablegerbildung
 Dr. Peter Rosenkranz LA Bienenkunde, Universität Hohenheim, D-70599 Stuttgart peter.rosenkranz@uni-hohenheim.de L A N D E S A N S TA LT F Ü R B IENENKUNDE / Ablegerbildung Bienenblock SS 2012 Dr. Peter
Dr. Peter Rosenkranz LA Bienenkunde, Universität Hohenheim, D-70599 Stuttgart peter.rosenkranz@uni-hohenheim.de L A N D E S A N S TA LT F Ü R B IENENKUNDE / Ablegerbildung Bienenblock SS 2012 Dr. Peter
Johann Gregor Mendel ( ) Sudetendeutsche Persönlichkeiten August 2015
 August 2015 (1822-1884) Johann Mendel wurde am 22. Juli 1822 in Heinzendorf (heute: Hynčice) im sog. Kuhländchen, einem fruchtbaren Hügelgelände im östlichen Nordmähren in der heutigen Tschechischen Republik,
August 2015 (1822-1884) Johann Mendel wurde am 22. Juli 1822 in Heinzendorf (heute: Hynčice) im sog. Kuhländchen, einem fruchtbaren Hügelgelände im östlichen Nordmähren in der heutigen Tschechischen Republik,
Domestikation. Haustierwerdung. Haustiere:
 Domestikation Haustierwerdung Haustiere: Teile von Wildarten Umweltbedingung ist der Hausstand Reichtum an gesteuerten erblichen Entwicklungsmöglichkeiten Mensch lenkt die Entwicklung in Bahnen Vielseitiger
Domestikation Haustierwerdung Haustiere: Teile von Wildarten Umweltbedingung ist der Hausstand Reichtum an gesteuerten erblichen Entwicklungsmöglichkeiten Mensch lenkt die Entwicklung in Bahnen Vielseitiger
Mendelsche Genetik, Kopplung und genetische Kartierung
 Mendelsche Genetik, Kopplung und genetische Kartierung Gregor Mendel Thomas Hunt Morgan Definitionen Diploide Eukaryonten: Das Genom besteht aus einem (haploiden) mütterlichen und aus einem väterlichen
Mendelsche Genetik, Kopplung und genetische Kartierung Gregor Mendel Thomas Hunt Morgan Definitionen Diploide Eukaryonten: Das Genom besteht aus einem (haploiden) mütterlichen und aus einem väterlichen
Inzuchtdepression beim Landseer?
 Inzuchtdepression beim Landseer? Vor einiger Zeit wurde die Frage diskutiert, ob der Landseer evtl. von einer Inzuchtdepression betroffen ist, weil z.b. 50% der gedeckten Hündinnen leer geblieben sind.
Inzuchtdepression beim Landseer? Vor einiger Zeit wurde die Frage diskutiert, ob der Landseer evtl. von einer Inzuchtdepression betroffen ist, weil z.b. 50% der gedeckten Hündinnen leer geblieben sind.
Züchtertagung 2012 des Deutschen Imkerbundes in Bodenwerder
 Züchtertagung 2012 des Deutschen Imkerbundes in Bodenwerder Am 9. und 10. April fand in der Münchhausenstadt Bodenwerder die Frühjahrs-Züchtertagung des Deutschen Imkerbundes (D.I.B.) statt. Gastgeber
Züchtertagung 2012 des Deutschen Imkerbundes in Bodenwerder Am 9. und 10. April fand in der Münchhausenstadt Bodenwerder die Frühjahrs-Züchtertagung des Deutschen Imkerbundes (D.I.B.) statt. Gastgeber
Autotrophe Ernährung. Heterotrophe Ernährung. Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien
 2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
Neuer Gentest für erbliche Augenerkrankung
 Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung Abschlussbericht Neuer Gentest für erbliche Augenerkrankung aus der gkf-info 34 Dezember 2011 Info 33 Dezember 2011 Grußwort Abschlussbericht Neuer Gentest
Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung Abschlussbericht Neuer Gentest für erbliche Augenerkrankung aus der gkf-info 34 Dezember 2011 Info 33 Dezember 2011 Grußwort Abschlussbericht Neuer Gentest
Gene, Umwelt & Verhalten I: Formal- und Quantitative Genetik
 Gene, Umwelt & Verhalten I: Formal- und Quantitative Genetik 1. Einleitung und Grundbegriffe 2. Grundlegendes zu den Trägern der Erbinformation 2.1. Chromosomen 2.2. DNA und Gen 2.3. Die Vervielfältigung,
Gene, Umwelt & Verhalten I: Formal- und Quantitative Genetik 1. Einleitung und Grundbegriffe 2. Grundlegendes zu den Trägern der Erbinformation 2.1. Chromosomen 2.2. DNA und Gen 2.3. Die Vervielfältigung,
Didaktische FWU-DVD. Die Zelle Reifeteilung Meiose
 46 02830 Didaktische FWU-DVD Die Zelle Zur Bedienung Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung (DVD-Player) oder der Maus (Computer) können Sie Menüpunkte und Buttons ansteuern und mit der OK-Taste bzw. Mausklick
46 02830 Didaktische FWU-DVD Die Zelle Zur Bedienung Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung (DVD-Player) oder der Maus (Computer) können Sie Menüpunkte und Buttons ansteuern und mit der OK-Taste bzw. Mausklick
Autosomal-dominanter Erbgang
 12 Autosomal-dominanter Erbgang Bearbeitetes Informationsblatt herausgegeben vom Guy s and St. Thomas Hospital, London und dem London IDEAS Genetic Knowledge Park, entsprechend deren Qualitätsstandards.
12 Autosomal-dominanter Erbgang Bearbeitetes Informationsblatt herausgegeben vom Guy s and St. Thomas Hospital, London und dem London IDEAS Genetic Knowledge Park, entsprechend deren Qualitätsstandards.
Von der Eizelle zum Welpen
 Manuela Walter Landstr. 34, CH-5322 Koblenz / Switzerland Tel./Fax P: +41(0)56 246 00 38 Natel: +41(0)79 344 30 09 e-mail: olenjok@hotmail.com website: www.olenjok-husky.ch Von der Eizelle zum Welpen Ein
Manuela Walter Landstr. 34, CH-5322 Koblenz / Switzerland Tel./Fax P: +41(0)56 246 00 38 Natel: +41(0)79 344 30 09 e-mail: olenjok@hotmail.com website: www.olenjok-husky.ch Von der Eizelle zum Welpen Ein
Stammbaumanalyse und Vererbungsmuster
 Stammbaumanalyse und Vererbungsmuster Bei den meisten Tieren und Pflanzen lässt sich der eines Merkmals in der Regel zweifelsfrei durch mehr oder weniger umfangreiche Kreuzungsexperimente erheben. Bei
Stammbaumanalyse und Vererbungsmuster Bei den meisten Tieren und Pflanzen lässt sich der eines Merkmals in der Regel zweifelsfrei durch mehr oder weniger umfangreiche Kreuzungsexperimente erheben. Bei
Molekulargenetische Untersuchungen und Ermittlung von Zuchtwerten zur idiopathischen Epilepsie beim Border Collie in Deutschland
 Molekulargenetische Untersuchungen und Ermittlung von Zuchtwerten zur idiopathischen Epilepsie beim Border Collie in Deutschland Gitte Anders Dies ist der Titel einer Forschungsarbeit, die sich aus den
Molekulargenetische Untersuchungen und Ermittlung von Zuchtwerten zur idiopathischen Epilepsie beim Border Collie in Deutschland Gitte Anders Dies ist der Titel einer Forschungsarbeit, die sich aus den
3 empfindet Ausbildung als langweilig, bricht Studium mit. Universität Edinburgh. 3 schreibt sich in Cambridge ein, studiert Botanik, schliesst
 Stichwortliste zu Charles Darwin 3 geboren 1809 Shrewsbury, Westengland 3 frühes Interesse an der Natur 3 Vater Arzt schickt Charles zum Medizinstudium an die Universität Edinburgh 3 empfindet Ausbildung
Stichwortliste zu Charles Darwin 3 geboren 1809 Shrewsbury, Westengland 3 frühes Interesse an der Natur 3 Vater Arzt schickt Charles zum Medizinstudium an die Universität Edinburgh 3 empfindet Ausbildung
Erklärung und Beispiele zur Farbverpaarung weißer und schwarzer Großspitze
 Erklärung und Beispiele zur Farbverpaarung weißer und schwarzer Großspitze Farbübergreifende Verpaarungen der Schwarzen und Weißen Großspitze sind dringend notwendig um die geringe Zuchtbasis der Großspitze,
Erklärung und Beispiele zur Farbverpaarung weißer und schwarzer Großspitze Farbübergreifende Verpaarungen der Schwarzen und Weißen Großspitze sind dringend notwendig um die geringe Zuchtbasis der Großspitze,
In unseren Beispielen bilden Valeria und Arnold ein theoretisches Paar - und geben wir zu, ein Paar das viel Pech im Leben hat das selber und auch
 Praktikum In unseren Beispielen bilden Valeria und Arnold ein theoretisches Paar - und geben wir zu, ein Paar das viel Pech im Leben hat das selber und auch Ihre Familien unter zahlreichen genetischen
Praktikum In unseren Beispielen bilden Valeria und Arnold ein theoretisches Paar - und geben wir zu, ein Paar das viel Pech im Leben hat das selber und auch Ihre Familien unter zahlreichen genetischen
Bei Einbeziehung von neun Allelen in den Vergleich ergibt sich eine Mutation in 38 Generationen (350:9); das entspricht ca. 770 Jahren.
 336 DNA Genealogie Das Muster genetischer Variationen im Erbgut einer Person - zu gleichen Teilen von Mutter und Vater ererbt - definiert seine genetische Identität unveränderlich. Neben seiner Identität
336 DNA Genealogie Das Muster genetischer Variationen im Erbgut einer Person - zu gleichen Teilen von Mutter und Vater ererbt - definiert seine genetische Identität unveränderlich. Neben seiner Identität
Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn
 Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn 1 für die Sekundarstufe I Klassenstufe 5 Optional: Hund oder Katze; Rind oder 10 F 1.4, F2.4, Pferd F2.6, F3.2 -Tierhaltung und Tierpflege
Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn 1 für die Sekundarstufe I Klassenstufe 5 Optional: Hund oder Katze; Rind oder 10 F 1.4, F2.4, Pferd F2.6, F3.2 -Tierhaltung und Tierpflege
Genotyp und Phänotyp. In der Genetik steht der Ausdruck Genotyp (auch Erbbild ) für die Gesamtheit der
 Genotyp und Phänotyp In der Genetik steht der Ausdruck Genotyp (auch Erbbild ) für die Gesamtheit der chromosomengebundenen Erbanlagen in der Zelle eines Organismus, seine Gene. Der Ausdruck Phänotyp (auch
Genotyp und Phänotyp In der Genetik steht der Ausdruck Genotyp (auch Erbbild ) für die Gesamtheit der chromosomengebundenen Erbanlagen in der Zelle eines Organismus, seine Gene. Der Ausdruck Phänotyp (auch
Neu Imker Kurs 2015:
 Neu Imker Kurs 2015: Begrüßung Neu Imker Kurs 2015: 18. April 2015: Biologie des VOLKES Arbeiten am Bienenvolk Empfehlung geeigneter Bienenbeuten Biologie des BIENEN-VOLKES mit Innendienst-Bienen mit Außendienst-Bienen
Neu Imker Kurs 2015: Begrüßung Neu Imker Kurs 2015: 18. April 2015: Biologie des VOLKES Arbeiten am Bienenvolk Empfehlung geeigneter Bienenbeuten Biologie des BIENEN-VOLKES mit Innendienst-Bienen mit Außendienst-Bienen
Faktor-V-Leiden Mutation: Diagnose und Klinik
 INRswiss-Tag Solothurn, 21. November 2009 Faktor-V-Leiden Mutation: Diagnose und Klinik Dr. Giuseppe Colucci Universitätsklinik für Hämatologie und Hämatologisches Zentrallabor Inselspital Bern Faktor-V-Leiden
INRswiss-Tag Solothurn, 21. November 2009 Faktor-V-Leiden Mutation: Diagnose und Klinik Dr. Giuseppe Colucci Universitätsklinik für Hämatologie und Hämatologisches Zentrallabor Inselspital Bern Faktor-V-Leiden
Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8
 Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Einfache Organisationsstufen von Lebewesen Prokaryoten Einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern und keine membranumhüllten Zellorganellen
Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Einfache Organisationsstufen von Lebewesen Prokaryoten Einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern und keine membranumhüllten Zellorganellen
IV. Übungsaufgaben für die Jahrgangstufe 9 & 10
 IV. Übungsaufgaben für die Jahrgangstufe 9 & 10 Von der Erbanlage zum Erbmerkmal: 34) Welche Aufgaben haben Chromosomen? 35) Zeichne und benenne die Teile eines Chromosoms, wie sie im Lichtmikroskop während
IV. Übungsaufgaben für die Jahrgangstufe 9 & 10 Von der Erbanlage zum Erbmerkmal: 34) Welche Aufgaben haben Chromosomen? 35) Zeichne und benenne die Teile eines Chromosoms, wie sie im Lichtmikroskop während
Übungsaufgaben zum Zellzykler 1/5 Jahrgangsstufe
 Übungsaufgaben zum Zellzykler 1/5 Jahrgangsstufe 9 + 11 Übungsaufgaben zum Kapitel Genetik mit Hilfe des Lernprogramms Zellzykler Tipp: Vergleiche auf der KGA-Biologie-Unterrichtsmaterialseite im Lehrplan
Übungsaufgaben zum Zellzykler 1/5 Jahrgangsstufe 9 + 11 Übungsaufgaben zum Kapitel Genetik mit Hilfe des Lernprogramms Zellzykler Tipp: Vergleiche auf der KGA-Biologie-Unterrichtsmaterialseite im Lehrplan
Arbeitsblatt. Übersetzt von Julia Heymann
 Arbeitsblatt Übersetzt von Julia Heymann Ein Set aus 14 Streifen repräsentiert die Chromosomen der Drachenmutter (weiblich), das andere, anders gefärbte, die Chromosomen vom Drachenvater (männlich). Jeder
Arbeitsblatt Übersetzt von Julia Heymann Ein Set aus 14 Streifen repräsentiert die Chromosomen der Drachenmutter (weiblich), das andere, anders gefärbte, die Chromosomen vom Drachenvater (männlich). Jeder
Optimale Produktliniengestaltung mit Genetischen Algorithmen
 Optimale Produktliniengestaltung mit Genetischen Algorithmen 1 Einleitung 2 Produktlinienoptimierung 3 Genetische Algorithmen 4 Anwendung 5 Fazit Seite 1 Optimale Produktliniengestaltung mit Genetischen
Optimale Produktliniengestaltung mit Genetischen Algorithmen 1 Einleitung 2 Produktlinienoptimierung 3 Genetische Algorithmen 4 Anwendung 5 Fazit Seite 1 Optimale Produktliniengestaltung mit Genetischen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
Collage kommt neu! Farben-Einmaleins. für Cockerzüchter. Von Bianka Titus-Langer
 Collage kommt neu! Foto: Bianka Titus-Langer Farben-Einmaleins für Cockerzüchter Von Bianka Titus-Langer Um die Farbvererbung im Allgemeinen und im Besonderen beim Cocker Spaniel zu verstehen, ist es zunächst
Collage kommt neu! Foto: Bianka Titus-Langer Farben-Einmaleins für Cockerzüchter Von Bianka Titus-Langer Um die Farbvererbung im Allgemeinen und im Besonderen beim Cocker Spaniel zu verstehen, ist es zunächst
Kapitel 08.03: Mendel und die klassische Genetik
 Kapitel 08.03: Mendel und die klassische Genetik 1 Kapitel 08.03: Mendel und die klassische Genetik Kapitel 08.03: Mendel und die klassische Genetik 2 Inhalt Kapitel 08.03: Mendel und die klassische Genetik...1
Kapitel 08.03: Mendel und die klassische Genetik 1 Kapitel 08.03: Mendel und die klassische Genetik Kapitel 08.03: Mendel und die klassische Genetik 2 Inhalt Kapitel 08.03: Mendel und die klassische Genetik...1
Verhalten (Ethologie)
 (Ethologie) Was ist Verhalten? Unter Verhalten versteht man in der Ethologie Bewegungen, Körperhaltungen und Lautäußerungen eines Tieres sowie äußerlich erkennbare Veränderungen, die der Kommunikation
(Ethologie) Was ist Verhalten? Unter Verhalten versteht man in der Ethologie Bewegungen, Körperhaltungen und Lautäußerungen eines Tieres sowie äußerlich erkennbare Veränderungen, die der Kommunikation
Intersexuelle Selektion
 Sexuelle Selektion Bewirkt Ausbildung von Ornamenten beim konkurrierenden Geschlecht Frage: Was haben die Weibchen von diesen Ornamenten? Älteste Erklärung: Runaway Process Von R.A. Fisher 1930 formuliert
Sexuelle Selektion Bewirkt Ausbildung von Ornamenten beim konkurrierenden Geschlecht Frage: Was haben die Weibchen von diesen Ornamenten? Älteste Erklärung: Runaway Process Von R.A. Fisher 1930 formuliert
Genetik Großübersicht
 1 Genetik Großübersicht Systematik der Lebewesen Die fünf Reiche: Pflanzen, Tiere, Einzeller, Pilze, Bakterien Die Art ist die kleinste Einheit im System der Pflanzen und Tiere. Sie umfasst die Gesamtheit
1 Genetik Großübersicht Systematik der Lebewesen Die fünf Reiche: Pflanzen, Tiere, Einzeller, Pilze, Bakterien Die Art ist die kleinste Einheit im System der Pflanzen und Tiere. Sie umfasst die Gesamtheit
1. Genetische Vielfalt innerhalb einer Population
 Biologie für Nebenfächler Prof. Dr. W. Stephan 1. Genetische Vielfalt innerhalb einer Population Zentraler Begriff der Populationsgenetik und Evolutionsbiologie Ohne genet. Variation gäbe es keine Evolution
Biologie für Nebenfächler Prof. Dr. W. Stephan 1. Genetische Vielfalt innerhalb einer Population Zentraler Begriff der Populationsgenetik und Evolutionsbiologie Ohne genet. Variation gäbe es keine Evolution
Vögel sehen die Welt bunter
 Vögel sehen die Welt bunter Einführung Der Spektrum-Artikel "Vögel sehen die Welt bunter" ist ein hoch interessanter Artikel, der gleichzeitig mehrere abiturrelevante Bereiche der Oberstufen-Biologie berührt
Vögel sehen die Welt bunter Einführung Der Spektrum-Artikel "Vögel sehen die Welt bunter" ist ein hoch interessanter Artikel, der gleichzeitig mehrere abiturrelevante Bereiche der Oberstufen-Biologie berührt
Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz - ESchG)
 Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz - ESchG) ESchG Ausfertigungsdatum: 13.12.1990 Vollzitat: "Embryonenschutzgesetz vom 13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2746), das zuletzt durch Artikel
Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz - ESchG) ESchG Ausfertigungsdatum: 13.12.1990 Vollzitat: "Embryonenschutzgesetz vom 13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2746), das zuletzt durch Artikel
Energie aus Wildpflanzen
 Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Bienenkundliche Begleituntersuchung im Rahmen des Projektes Energie aus Wildpflanzen Untersuchungsjahr 2010 Fachzentrum Bienen Dr. Ingrid Illies 1 Einleitung
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Bienenkundliche Begleituntersuchung im Rahmen des Projektes Energie aus Wildpflanzen Untersuchungsjahr 2010 Fachzentrum Bienen Dr. Ingrid Illies 1 Einleitung
Dr. Peter Rosenkranz; Eva Frey Eva Frey. LA Bienenkunde, Universität Hohenheim, D-70599 Stuttgart
 Dr. Peter Rosenkranz; Eva Frey Eva Frey LA Bienenkunde, Universität Hohenheim, D-70599 Stuttgart peter.rosenkranz@uni-hohenheim.de Eva.frey@uni-hohenheim.de Grundkurs Imkerei I Frühjahrsarbeiten L A N
Dr. Peter Rosenkranz; Eva Frey Eva Frey LA Bienenkunde, Universität Hohenheim, D-70599 Stuttgart peter.rosenkranz@uni-hohenheim.de Eva.frey@uni-hohenheim.de Grundkurs Imkerei I Frühjahrsarbeiten L A N
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
DIE BARTAGAME, ZWERGBARTAGAME & AUSTRALISCHE TAUBAGAME
 Christian Freynik Oliver Drewes DIE BARTAGAME, ZWERGBARTAGAME & AUSTRALISCHE TAUBAGAME Pogona henrylawsoni VORWORT Dieses Buch basiert auf der Publikation Die Zwergbartagame von Christian Freynik, das
Christian Freynik Oliver Drewes DIE BARTAGAME, ZWERGBARTAGAME & AUSTRALISCHE TAUBAGAME Pogona henrylawsoni VORWORT Dieses Buch basiert auf der Publikation Die Zwergbartagame von Christian Freynik, das
..den Sinneszellen. zu schützen. optimal zuzuführen. die Qualität des Reizes festzustellen die Quantität des Reizes festzustellen
 9.1 Welche Funktionen haben Sinneszellen und Sinnesorgan? Sinneszellen nehmen die Reize auf und wandeln die Information in elektrische Signale um. Die Sinnesorgane dienen unter anderem dazu. Beispiel Auge
9.1 Welche Funktionen haben Sinneszellen und Sinnesorgan? Sinneszellen nehmen die Reize auf und wandeln die Information in elektrische Signale um. Die Sinnesorgane dienen unter anderem dazu. Beispiel Auge
Positionen. Fachthema: Reproduktionsmedizin Ethik, Beratung, Recht
 Fachthema: Reproduktionsmedizin Ethik, Beratung, Recht 21. Mai 2005 Grand Hotel am Dom in Erfurt Positionen Bundesregierung Nationaler Ethikrat Bundesärztekammer Bundesverband Reproduktionsmedizinischer
Fachthema: Reproduktionsmedizin Ethik, Beratung, Recht 21. Mai 2005 Grand Hotel am Dom in Erfurt Positionen Bundesregierung Nationaler Ethikrat Bundesärztekammer Bundesverband Reproduktionsmedizinischer
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Drohnenbrut schneiden
 Drohnenbrut schneiden Drohnenbrut schneiden eine biotechnische Maßnahme zur Bekämpfung der Varroa-Entwicklung. Folie 2 Drohnenbrut schneiden Hintergrund und Ziel Drohnenbrut ist für Milben attraktiver
Drohnenbrut schneiden Drohnenbrut schneiden eine biotechnische Maßnahme zur Bekämpfung der Varroa-Entwicklung. Folie 2 Drohnenbrut schneiden Hintergrund und Ziel Drohnenbrut ist für Milben attraktiver
VORANSICHT. Die Honigbiene mehr als nur ein Honigproduzent. Das Wichtigste auf einen Blick. III Tiere Beitrag 12 Die Honigbiene (Klasse 5/6) 1 von 28
 III Tiere Beitrag 12 Die Honigbiene (Klasse 5/6) 1 von 28 Die Honigbiene mehr als nur ein Honigproduzent Ein Beitrag von Claudia Ritter und Joachim Poloczek, Winterbach Mit Illustrationen von Julia Lenzmann,
III Tiere Beitrag 12 Die Honigbiene (Klasse 5/6) 1 von 28 Die Honigbiene mehr als nur ein Honigproduzent Ein Beitrag von Claudia Ritter und Joachim Poloczek, Winterbach Mit Illustrationen von Julia Lenzmann,
Bienengesundheit in der Schweiz - Schritte in Politik und Verwaltung -
 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW - Schritte in Politik und Verwaltung - Katja Knauer, BLW, Nachhaltiger Pflanzenschutz Scnat Fachsymposium «Bienen und Bestäuber»,
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW - Schritte in Politik und Verwaltung - Katja Knauer, BLW, Nachhaltiger Pflanzenschutz Scnat Fachsymposium «Bienen und Bestäuber»,
erläutern Eigenschaften des genetischen Codes und charakterisieren mit dessen Hilfe Experimentelle Entschlüsselung (SF)
 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q1 : Genetik Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen 1.1 Vom Gen zum Genprodukt Wiederholung - DNA und Replikation Aufgaben DNA und Replikation
Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q1 : Genetik Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen 1.1 Vom Gen zum Genprodukt Wiederholung - DNA und Replikation Aufgaben DNA und Replikation
Der Kleine Beutenkäfer (Aethinatumida)
 Der Kleine Beutenkäfer (Aethinatumida) Birgit Esterl Gesetzliche Lage in Österreich Laut Bienenseuchengesetz sind der Befall und Verdacht auf den Kleinen Beutenkäfer anzeigepflichtig. Meldepflicht gilt
Der Kleine Beutenkäfer (Aethinatumida) Birgit Esterl Gesetzliche Lage in Österreich Laut Bienenseuchengesetz sind der Befall und Verdacht auf den Kleinen Beutenkäfer anzeigepflichtig. Meldepflicht gilt
Labortechniken (2) Amplifikationskurve (linear linear) Realtime-PCR
 Realtime PCR Quantitative PCR Prinzip: Nachweis der PCR-Produkte in Echtzeit und Quantifizierung anhand eines fluoreszenten Reporters R Q Taq-Polymerase Synthese- und Nuklease-Einheit R=Reporter, Q=Quencher
Realtime PCR Quantitative PCR Prinzip: Nachweis der PCR-Produkte in Echtzeit und Quantifizierung anhand eines fluoreszenten Reporters R Q Taq-Polymerase Synthese- und Nuklease-Einheit R=Reporter, Q=Quencher
Die α (alpha)-thalassämien- Informationen für Patienten
 Die Alpha Thalassämien Seite 1 von 1 Die α (alpha)-thalassämien- Informationen für Patienten Erstellung Prüfung Prof. Dr. med. Roswitha Dickerhoff Prof. Dr. med. R. Dickerhoff Gültigkeitsbeginn 01.05.2013
Die Alpha Thalassämien Seite 1 von 1 Die α (alpha)-thalassämien- Informationen für Patienten Erstellung Prüfung Prof. Dr. med. Roswitha Dickerhoff Prof. Dr. med. R. Dickerhoff Gültigkeitsbeginn 01.05.2013
h. g. f. e. Vater: e. O M Rh- f. A M Rh+ g. O MN Rh+ h. B MN Rh+ AB N Rh- B MN Rh-
 5. Übung 1) Neben dem ABO- Genlokus bes8mmen auch der Rhesus- (Rh) und der MN- Genlokus die Blutgruppe beim Menschen (d.h. die Ausprägung von An8genen auf der Oberfläche von Erythrozyten). Im Falle des
5. Übung 1) Neben dem ABO- Genlokus bes8mmen auch der Rhesus- (Rh) und der MN- Genlokus die Blutgruppe beim Menschen (d.h. die Ausprägung von An8genen auf der Oberfläche von Erythrozyten). Im Falle des
Humangenetik 3. 1 Sexuelle Fortpflanzung
 Humangenetik 3. 1 Sexuelle Fortpflanzung Lehrplaneinheit Keimzellenbildung und Befruchtung 1 3. Genetik Hinweise Bedeutung der Meiose ohne Betrachtung der einzelnen Phasen Bedeutung der Meiose (Reduktion
Humangenetik 3. 1 Sexuelle Fortpflanzung Lehrplaneinheit Keimzellenbildung und Befruchtung 1 3. Genetik Hinweise Bedeutung der Meiose ohne Betrachtung der einzelnen Phasen Bedeutung der Meiose (Reduktion
Medienbegleitheft zur DVD MITOSE MEIOSE
 Medienbegleitheft zur DVD 12310 MITOSE MEIOSE Medienbegleitheft zur DVD 23 Minuten, Produktionsjahr 2008 Informationen für Lehrer Serie: Modern Biology Series MEIOSE 15 Minuten Verlag: BENCHMARK MEDIA
Medienbegleitheft zur DVD 12310 MITOSE MEIOSE Medienbegleitheft zur DVD 23 Minuten, Produktionsjahr 2008 Informationen für Lehrer Serie: Modern Biology Series MEIOSE 15 Minuten Verlag: BENCHMARK MEDIA
Jahrgangsstufe 9. Inhaltsfeld Individualentwicklung des Menschen. Unterrichtsverlauf Inhalte Fortpflanzung, Entwicklung und Geburt (s.
 Jahrgangsstufe 9 Inhaltsfeld Individualentwicklung des Menschen Fortpflanzung, Entwicklung und Geburt (s. Sexualkunde) Grundlagen gesundheitsbewusster Ernährung Bau und Funktion der Niere Bedeutung der
Jahrgangsstufe 9 Inhaltsfeld Individualentwicklung des Menschen Fortpflanzung, Entwicklung und Geburt (s. Sexualkunde) Grundlagen gesundheitsbewusster Ernährung Bau und Funktion der Niere Bedeutung der
Temperaturabhängige Geschlechtsbestimmung
 Temperaturabhängige Geschlechtsbestimmung Bei manchen Arten wird das Geschlecht durch Umweltbedingungen festgelegt, z. B. durch die Temperatur während der Entwicklung des Embryos im Ei. Drei Typen der
Temperaturabhängige Geschlechtsbestimmung Bei manchen Arten wird das Geschlecht durch Umweltbedingungen festgelegt, z. B. durch die Temperatur während der Entwicklung des Embryos im Ei. Drei Typen der
2495/AB XX. GP - Anfragebeantwortung 1 von 5 2495/AB XX.GP
 2495/AB XX. GP - Anfragebeantwortung 1 von 5 2495/AB XX.GP Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen und
2495/AB XX. GP - Anfragebeantwortung 1 von 5 2495/AB XX.GP Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen und
Entwicklungsstörung. Abklären, erkennen, vorsorgen. Informationen für Eltern mit einem Sorgenkind
 Entwicklungsstörung Abklären, erkennen, vorsorgen Informationen für Eltern mit einem Sorgenkind Entwicklungsstörungen haben oft genetische Ursachen Was sind genetisch bedingte Störungen und Erkrankungen?
Entwicklungsstörung Abklären, erkennen, vorsorgen Informationen für Eltern mit einem Sorgenkind Entwicklungsstörungen haben oft genetische Ursachen Was sind genetisch bedingte Störungen und Erkrankungen?
Evolutionäre Psychologie
 Evolutionäre Psychologie Von Habib Günesli 15.11.2006 Zum Inhalt Drei Artikel Evolutionsbiologische Mutmaßungen über Vaterschaft Rolle des Vaters für die frühe Entwicklung des Kindes Eltern-Kind-Beziehung
Evolutionäre Psychologie Von Habib Günesli 15.11.2006 Zum Inhalt Drei Artikel Evolutionsbiologische Mutmaßungen über Vaterschaft Rolle des Vaters für die frühe Entwicklung des Kindes Eltern-Kind-Beziehung
Gendiagnose. Als nächstes möchte ich einige Verfahren von Gentests nennen und erläutern.
 Gendiagnose Gentest Der Gentest ist ein molekularbiologisches Verfahren. Bei diesem wird die DNA untersucht, um Rückschlüsse auf genetische Aspekte zu erhalten. Gentests haben vielfältige Anwendungsmöglichkeiten,
Gendiagnose Gentest Der Gentest ist ein molekularbiologisches Verfahren. Bei diesem wird die DNA untersucht, um Rückschlüsse auf genetische Aspekte zu erhalten. Gentests haben vielfältige Anwendungsmöglichkeiten,
Inhaltsverzeichnis. Zellen und Ökosysteme. M Arbeiten mit Basiskonzepten 8 M Aufgaben richtig verstehen 10
 Inhaltsverzeichnis M Arbeiten mit Basiskonzepten 8 M Aufgaben richtig verstehen 10 Zellen und Ökosysteme 1 Die Vielfalt der Zellen 1.1 Zellen 14 1.2 Pflanzen- und Tierzellen 16 1.3 Zelldifferenzierung
Inhaltsverzeichnis M Arbeiten mit Basiskonzepten 8 M Aufgaben richtig verstehen 10 Zellen und Ökosysteme 1 Die Vielfalt der Zellen 1.1 Zellen 14 1.2 Pflanzen- und Tierzellen 16 1.3 Zelldifferenzierung
Transgene Pflanzen und Bienen
 Transgene Pflanzen und Bienen,,Wenn die Biene von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr,
Transgene Pflanzen und Bienen,,Wenn die Biene von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr,
Erfolgreiche Königinnenzucht
 Frühjahrsversammlung Restaurant Brandenberg Zug, 05.03.2013 Zuger Kantonaler Imkerverein Cyrill Arnet Das Jahr der Zucht Das 2013 ist das erklärte Jahr der Königinnenzucht im Zuger Kantonalen Imkerverein!
Frühjahrsversammlung Restaurant Brandenberg Zug, 05.03.2013 Zuger Kantonaler Imkerverein Cyrill Arnet Das Jahr der Zucht Das 2013 ist das erklärte Jahr der Königinnenzucht im Zuger Kantonalen Imkerverein!
