~~1J~(Q)~~[L~~~~ ~~ W~~O \YAYl~[L[Q) (ill[njcq] [nj
|
|
|
- Clemens Pohl
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ~~1J~(Q)~~[L~~~~ ~~ W~~O \YAYl~[L[Q) (ill[njcq] [nj
2 Nationalpark ~ Bayerischer Wald ~ Klima und Böden Waldstandorte von w. Elling, E. Bauer, G. Klemm, H. Koch Oberforstdirektion Regensburg Heft Schriftenreihe des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
3 Nationalpark ~ Bayerischer Wald ~ Klima und Böden Waldstandorte von w. Elling, E. Bauer, G. Klemm, H. Koch Oberforstdirektion Regensburg Heft 1 Schriftenreihe des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
4 Impressum Herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 2. verbesserte Auflage Dezember 1987 (1. Auflage 1976) Alle Rechte vorbehalten! Zu beziehen bei: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Freyunger Straße 2, Grafenau Druck: Morsak Verlag, 8352 Grafenau Titelbild: Foto: Rachelgipfel H. Bibelriether
5 Vorworte Im Juni 1969 beschloß der Bayerische Landtag einstimmig die Errichtung des Nationalparks Bayerischer Wald. Bereits Monate vorher erteilte die Bayerische Staatsforstverwaltung den Auftrag, eine umfangreiche Standortserkundung im geplanten Nationalparkgebiet zu erarbeiten. Die Untersuchungen umfaßten Erkundungen des Geländeklimas, eine Kartierung der Böden und bemühten sich, die ursprüngliche Zusammensetzung der Wälder zu rekonstruieren. Die Kenntnis der natürlichen Lebensgrundlagen für Pflanzen und Tiere wurden zu einem wichtigen Grundstein für die Arbeit im Nationalpark Bayerischer Wald. Die Veröffentlichung dieser ersten Forschungsergebnisse erfolgte im Heft 1 der wissenschaftlichen Reihe der Nationalparkverwaltung. Die Erstauflage war rasch vergriffen. Da das Interesse nach wie vor groß ist, wurde eine Neuauflage erstellt. Dabei war es möglich, die mehrfarbigen Standorts- und Klimakarten, auf die in der ersten Auflage nur hingewiesen werden konnte, nunmehr als Beilage den Interessenten zur Verfügung zu stellen. Der kostenaufwendige Neudruck war nur möglich durch die Unterstützung des "Vereins der Freunde des Ersten Deutschen Nationalparks Bayerischer Wald e)./.".ihm ist auch zu verdanken, daß der Verkaufspreis trotz der großzügigen Ausstattung im Rahmen gehalten werden konnte. Dafür sei dem,yerein der Freunde des Nationalparks Bayerischer Wald" geziemend gedankt. Grafenau, im Juni 1987 Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald Die erste Auflage dieser Arbeit ist im Jahr 1976 als Heft 1 der Schriftenreihe "Nationalpark Bayerischer Wald" unter gleichem Titel in zwei verschiedenen Ausgaben erschienen: - Vollständige Ausgabe mit Textteil, 65 Abbildungen (schwarz-weiß) und 65 Tabellen. - Kurzausgabe bestehend aus dem Textteil und einer Reihe großformatiger Fotos (farbig und schwarz-weiß). Die vorliegende 2. Auflage umfaßt Textteil, Abbildungen (schwarz-weiß) und Tabellen. Eine wesentliche Bereicherung stellt der Druck mehrerer Karten dar, der bei der ersten Auflage nicht möglich war. Im übrigen unterscheidet sich diese Auflage von der ersten nur durch Korrekturen, drucktechnische Verbesserungen und Ergänzungen des Literaturverzeichnisses. Weihenstephan im März 1987 Prof. Dr. Elling im Namen der Autoren 3
6 Urwald am Rachelsee Foto: H. Bibelriether 4
7 Inhaltsverzeichnis Einleitung 53 - Ökologische Bedeutung des Aufgabe der Standortserkundung Kaltluftstaus Durchführung der Standortstemperatur nach PALLMANN im Bestimmung der wirksamen Mittelerkundung Juli und August Zweck der Messungen Geographische Einführung 55 - Methodik der Messungen Lage, Naturraum 60 - Die Eignung der PALLMANN Landschaftsgestalt Methode für die geländeklimatolo Bewaldung gischen Untersuchungen Flußgebiete 61 - Festlegung der Meßstationen 62 - Durchführung der Messungen Klima 63 - Ergebnisse der Messungen der wirksamen Mitteltemperatur Einzelne Klimafaktoren der Luft Strahlung 68 - Vergleich der wirksamen Mittel Bewölkung und Sonnenschein dauer temperatur der Luft mit den Wind Temperaturmessungen des Wetter Lufttemperatur dienstes Großklima 72 - Karte der wirksamen Mittel Geländeeinfluß (nach der Literatur) temperatur der Luft 27 - Entstehung von Kaltluft durch 72 - Ergebnisse der Messungen der Ausstrahlung wirksamen Mitteltemperatur 27 - Bewegung der Kaltluft im Humus 33 - Tagesgang der Temperaturen nach 74 - Ergebnisse der Messungen der Höhenlagen wirksamen Mitteltemperatur 33 - Minima der Temperaturen nach in 30 cm Bodentiefe Höhenlagen - Bemerkungen zur statistischen 34 - Maxima der Temperaturen nach Auswertung von JOACHIM Höhenlagen BACHLER 34 - Mitteltemperaturen nach Phänologische Beobachtungen Höhenlagen an der Buche Spezielle Untersuchungen über das 76 - Kartierung des Buchenaustriebs Wärmeklima des Nationalparks Kartierung des Bereichs sichtbarer 76 - Zeitlicher Ablauf des Buchenaus- Frostschäden an der Buche im triebs 1970 Herbst Zur Frage nach dem Einfluß der Tägliche Messungen der Minimal- Temperaturverhältnisse auf den temperatur der Luft in 1,2 m Höhe Zeitpunkt des Buchenaustriebs 46 - Durchführung der Messungen 80 - Beobachtungen über die Dauer 48 - Auswertung der Messungen der Vegetationszeit der Buche 48 - Eigenarten der einzelnen Täler Bodentemperatur 50 - Zusammenfassung der Ergebnisse Luftfeuchte 52 - Diskussion der Ergebnisse Nebel und Nebelniederschlag 53 - Minimumtemperaturen im Juli und Nebel August Nebelniederschlag 5
8 Niederschläge Schäden durch Dürre Schneeverhältnisse Ausscheidung von Höhenstufen Schneefall Schneedecke Geologie 94 - Beginn, Ende und Dauer der Schneedecke Grundgebirge 98 - Höhe der Schneedecke Entstehung und Bau des Grund Spezielle Untersuchungen über die gebirges Schneedecke im Nationalparkgebiet Gesteine des Grundgebirges im Zweck der Aufnahmen der Schnee- Nationalparkgebiet decke im Winter 1969/ Cordieritgneise Methode der Kartierung der Glimmergneis geschlossenen Schneedecke Körnelgneis (Schneehöhen) am 4. März Kristallgranite und am 14. April Fein- bis mittelkörnige Granite Methode der Kartierung der Sonstige Gesteine durchbrochenen Schneedecke am Zersatz der kristallinen Gesteine 11. Mai 1970, 25. Mai 1970 und am Ablagerungen aus den Eiszeiten 16. Juni Bildungen der eiszeitlichen Gletscher Ergebnisse der Kartierung der Eiszeitliche Gletscher im National- Schneedecke im Jahre 1970 parkgebiet Kartierung der durchbrochenen Der Rachelseegletscher Schneedecke am 3. März Der nördliche Rachelgletscher Diskussion der Ergebnisse Der Gletscher im Tal des Großen Messung der Schneedichte Schwarz bachs Wasservorrat der Schneedecke Andere eiszeitliche Bildungen Bedeutung der Wasserspeicherung Verfestigter Schutt in der Schneedecke Frost- und FlieBerden Witterungseinflüsse als Ursachen von Blockschutt Schäden an Waldbäumen Böden Schäden durch Sturm (Windwurf und Windbruch) Methode der Bodenkartierung Angaben aus der Literatur Beschreibung der Bodenformen Auswertung der Akten Fels- und Blockböden Herbst- und Winterstürme aus Blockfeld Westen und Südwesten Block-Humus-Boden Herbst- und Winterstürme aus Fels-Humus-Boden Osten bis Nordosten (Böhmwind) Fels-Lehm-Mosaik Sommerstürme bei Gewittern, Block-Lehm-Mosaik vorwiegend aus Südwesten bis Sand- und Lehmböden Westen Sand und Schotter Gefährdung der Baumarten Lehm über Sand Schäden durch Schnee, Lehm Rauhreif und Rauheis Lehm mit Wasserzug Schäden durch Winterfrost Tiefgründiger Lehm über verfestigtem Schäden durch Spätfrost Schutt 6
9 Mittelgründiger Lehm über Der Einfluß des Menschen auf den verfestigtem Schutt Wald bis zur Mitte des 19. Jahr Gebleichter, mittelgründiger Lehm hunderts über verfestigtem Schutt Naß böden 7.4 Bestandsformen um die Mitte des Mineralischer Naßboden Jahrhunderts Flaches Niedermoor Karte der Bestandsformen Mittleres und tiefes Niedermoor Statistik der Bestandsformen nach Hochgelegenes Quellmoor Höhenstufen Übergangsmoor Bestandsformen nach Standorts Hochmoor einheiten Moränenbereich Standorte der Fels- und Lehmböden Standorte der Fels- und Blockböden Bodenreaktion Standorte der Naßböden Humusverhältnisse Baumdimensionen Bodenzonierung bei den Sand- und Lehmböden Uteraturverzeichnis Höhenabhängige Zonen Ergebnisse der Kartierung Ergebnisse der Bodenanalyse Zur Frage der Entstehungsweise der Lockerbraunerde Geländeabhängige Zonen Ernährungszustand der Fichte nach Nadelanalysen Sand- und Lehmböden Stickstoff Stickstoffernährung und Humuszustand Stickstoffernährung und Höhenwachstum der Fichte Phosphor Kalium Calcium Fels- und Blockböden Naßböden Standortseinheiten Versuch einer Rekonstruktion der ursprünglichen Zusammensetzung der Wälder Zweck der Untersuchung Quellen 7
10 Verzeichnis der Abbildungen s. Abb. s. Abb. 14 Lage und Einteilung des Nationalpark- Geländeklassen Gipfellagen, Hänge, gebietes Täler) 20 2 Monatsmittel der Bewölkung in Zehnteln Ausgleichsfunktionen für den Zusamder Himmelsfläche ( ) menhang zwischen See höhe und wirk Mittlere Monatssummen der Sonnen- samer Mitteltemperatur (et Luft, Gelänschein dauer ( ) deklasse Hänge nach Hauptexpositionen getrennt) 22 4 Mittlere Zahl der heiteren Tage ( ) Zusammenhang zwischen der Mitteltemperatur der Luft (Celsius-Zehntelgrade) und in et nach Vergleichsmes Mittlere Zahl der trüben Tage ( ) sungen an den Stationen Großer Falken Monats- und Jahresmittel der Lufttempe- stein, Freyung und Zwiesel berg während ratur ( ) in Abhängigkeit von der Monate Juli und August 1970 der Seehöhe (gilt nicht für Inversions Vergleich der Mittelwerte der Lufttempelagen) ratur im Juli und August 1970 nach 38 7 Andauer eines Tagesmittels der Lufttem- Messungen des Wetterdienstes mit Mesperatur von 10 C sungen an PALLMANN-Stationen in 41 8 Mittlere Tagesgänge der Lufttemperatur Gipfellagen. am Großen Falkenstein in der Vegeta Ausgleichsfunktionen für den Zusamtionszeit Mai bis Oktober 1955 menhang zwischen Seehöhe und wirk- (nach BAUMGARTNER, 1960 (b) samer Mitteltemperatur (et) in der Luft 42 9 Beispiele für Höhenprofile der Minima und im Humus an Hängen. der Lufttemperatur in 1,2 m Höhe nach Beobachtungen über die Dauer der wolkenlosen Nächten und einer windigen Vegetationszeit der Buche Schlechtwetternacht ( ) Täglicher Gang der relativen Feuchtig Mittleres Minimum der Lufttemperatur keit an einem typisch heiteren Frühjahrsin 1,2 m Höhe nach den 10 wolkenlosen tag (Mittel 1931 und 1932) Nächten im Mai/Juni 1971 (Lusenabhang, Prozentuale Verteilung von Regen- oder Schwarzach- und Flanitztal) Nebeltagen im Zeitraum bis Fortsetzung von am Westhang des Großen Falken- (Tal der Großen Ohe) stein. lang der Meßstrecke am Großen Falkenstein Fortsetzung von Verteilung der Regenmengen und des (Sagwasser- und Reschwassertal) Gesamtniederschlags aus Regen, Nebel PALLMANN-Station zur Messung der und Tau von Mai bis Oktober 1955 entwirksamen Mitteltemperatur der Luft Wirksame Mitteltemperatur der Luft in 2 m Höhe nach PALLMANN auf Berg Jahressumme des Niederschlags im gipfeln im Juli und August 1970 Mittel der Periode Ausgleichsfunktionen für den Niederschlagssumme der Monate Zusammenhang zwischen Seehöhe und Mai-Juli im Mittel der Periode wirksamer Mitteltemperatur (et Luft, Mittlerer Jahresgang des Niederschlags 8
11 s. Abb. s. Abb. im Zeitraum (Nationalpark- einzelnen Monaten des Jahres gebiet) Windrichtungen bei Sturmschäden Mittlerer Jahresgang des Niederschlags Windrichtungen bei Sturmschäden im im Zeitraum (Alpen und Oktober - März (a) und Juni bis Schwarzwald) August (b) Mittlerer Jahresgang des Nieder Höhenerstreckung von Schäden durch schlags im Zeitraum Schnee, Rauhreif und Rauheis (Nördliches Südwestdeutschland und Harz) Granitblock mit Gletscherschliff im Tal des Reschwassers Mittlere monatliche Schneedeckenhöhe (ern) in verschiedenen Höhenlagen des Vorkommen der Bodenformen im Inneren Bayer. Waldes aufgrund Gelände 20jähriger Beobachtungen nach CASPAR Gehalt organischer Substanz (nasse (1962) Veraschung) in verschiedenen Boden Schmelzteller um Buchen tiefen Schneehöhenkurven im Winter 1969/ Stickstoffgehalt von Fichtennadeln in Abhängigkeit von der Höhenlage Messung der Schneedichte mit der Schneesonde "Vogels berg" (14. April Höhenbonität der Fichtenbestände, 1970) in denen Nadelproben entnommen wurden, in Abhängigkeit von deren Entwicklung der in der Schneedecke Höhenlage gebundenen Wassermenge nach Einzugsgebieten im Jahr Probeflächen in den Revieren Schönau, -65 Riedlhütte, Klingenbrunn und Finsterau Häufigkeit von Sturmschäden in den 9
12 Verzeichnis der Tabellen s. Tab. s. Tab Flächen und Flächenanteile der verschie Beschreibung der Stationen zur Messung denen Höhenlagen im Nationalparkgebiet der Minima der Lufttemperaturen 21 2 Monats- und Jahresmittel der Bewölkung Minima der Lufttemperaturen in 1,2 m in Zehnteln der Himmelsfläche Höhe nach den 10 wolkenlosen Nächten 23 3 Mittlere Monats- und Jahressummen der im Mai/Juni 1971 Sonnenscheindauer Minima der Lufttemperatur in 1,2 m Höhe 24 4 Mittlere Zahl der heiteren Tage nach gelegentlichen Ablesungen im ( ) Juli/August Mittlere Zahl der trüben Tage ( ) Verzeichnis der PALLMANN-Stationen 29 6 Mittlere Windverhältnisse an der Station Zusammenhänge zwischen wirksamer GroBer Falkenstein Mitteltemperatur (Luft) und Seehöhe 30 7 Mittlere Windverhältnisse an der Station Zusammenhänge zwischen wirksamer Zwiesel Mitteltemperatur (Humus) und Seehöhe 31 8 Mittlere Windverhältnisse an der Station Beobachtungen über die Dauer der Passau-Oberhaus 32 9 Häufigkeit des Auftretens von Windge- schwindigkeiten (%0) über 49 km/h) Zahl der Tage mit Regen oder Nebel am Monats- und Jahresmittel der Lufttempe- Westhang des GroBen Falkenstein in der ratur C Zeit vom Vegetationszeit der Buche an SW-Expositionen und in Tallagen mit Kaltluftstau in den Jahren 1970 und Mitteltemperatur der Luft in den Monaten Mittlere Monats- und Jahressummen des Mai - August und November - Februar Niederschlags für die Periode Mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag 3712/1 Mittlere Jahresschwankung der ~ 0,1 mm ( ) Lufttemperatur Mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag 37 2 Mittlerer Beginn, mittleres Ende und ~ 1,0 mm ( ) mittlere Dauer eines Tagesmittels von 96 ~ 5, ~ Mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag ~ 10,0 mm ( ) Absolut höchste Maxima der Lufttemperatur und zugehöriges Jahr Schäden durch Hochwasser Absolut tiefste Minima der Luft Mittlere Zahl der Tage mit Schneefall temperatur und zugehöriges Jahr ( ) Die tiefsten Minimumtemperaturen Mittlere Zahl der Tage mit Schneeregen (0 C) in den einzelnen Monaten der Jahre ( ) am Westhang des GroBen Schneeanteil am Gesamtniederschlag Falkenstein in 1,2 m Höhe über dem in % ( , ) Boden Mittlere Zahl der Tage mit Schneedecke Monatsmittel der täglichen Temperatur- ~Ocm höchstwerte 1955 an den Klimastatio GröBte und kleinste Zahl der Tage mit nen am Westhang des GroBen Falken- Schneedecke ~ 0 cm stein 10 ~ I ;
13 s. Tab. s. Tab Zahl der Tage mit Schneedecke Flächen der Sturmschäden von 1925 ~ 0 cm im Winter 1969/70 und Mittlere und extreme Daten der Schnee Schäden durch Schnee, Duft- und deckenzeit für Schneehöhen ~ 0 cm Eisanhang Mittlere und extreme Daten der längsten Schäden durch Spätfrost Schneedeckenperiode Monats- und Jahressummen des Dauer der längsten Schneedecken- Niederschlags im langjährigen Mittel periode im Winter 1969/70 und in den Jahren mit relativ trockener Mittlere monatliche und jährliche Vegetationszeit an der Station Metten Schneedeckenhöhe(cm) (313 m) im Zeitraum Mittlere monatliche Schneedecken Kurzübersicht über die Klimaverhältnisse höhe (cm) im Winter 1969/70 in den Höhenstufen Mittlere monatliche Maxima der Flächen und Flächenanteile der Höhen- Schneedecken höhe (cm) stufen, Bodenformen und Standortseinheiten Größte und kleinste Monats- und Jahresmaxima der Schneehöhe in cm Flächen und Flächenanteile der Höhenstufen, Bodenformen und Standortseinheiten Monatsmaxima der Schneehöhe in cm im Winter 1969/70 im Gebietsabschnitt I, außerhalb des Mittlere monatliche und jährliche Nationalparkes Schneedichte Ergebnisse der Nadel- und Durchschnittliche Höhe der Schnee- Humusanalysen decke innerhalb der Abschmelzstufen Profilbeschreibungen und Ergebnisse der Ergebnisse der Schneedichte-Messungen Bodenanalysen Fläche der Einzugsgebiete (Gesamt Bestandsformen 1855 staatswaldfläche und Enklaven) Bestandsformen 1855, getrennt nach In der Schneedecke gespeicherte Höhenstufen Wassermengen Bestandsformen Flächen der Teile des Reschwasserein Bestandsformen 1972, getrennt nach zugsbereiches, die oberhalb des untersuchten Gebiets liegen und dort gespeicherte Wassermengen (Schätzung) Schäden durch Sturm Flächen der Sturmschäden von 1868 und 1870 und der anschließenden Borken käferkalam ität Höhenstufen Baumhöhen und Baumstärken im Bayerischen Wald 11
14 Verzeichnis der Karten Vorbemerkung: Es liegen die Karten Nr und 12 bei, die Karten Nr. 11, 13, 14 und 15 befinden sich bei der Nationalparkverwaltung Bayer. Wald in Grafenau. Maßstab 1 :50000 Karte Nr. 1 : Höhenstufen 2: Wirksame Mitteltemperaturen nach PALLMANN 3: Buchenaustrieb : Schneedecke am 4. März : Schneedecke am 14. April : Schneedecke am 11. Mai : Schneedecke am 25. Mai : Schneedecke am 16. Juni : Schneedecke am 3. März : Großschäden durch Stürme 11: Böden Maßstab 1 : : Bestandsformen : Typen der Sturmschäden a) Herbst- und Winterstürme aus W - SW (Okt. - März) b) Herbst- und Winterstürme aus o - NO (Okt. - März) c) Sommerstürme bei Gewittern (Juni - August) Karte Nr. 14: Bodeneinschläge, Meßstationen usw. (6 Blätter) 15: Standortskarte 12
15 1. Einleitung 1.1 Aufgabe der Standortserkundung Die Standortserkundung, die nach und nach im gesamten Staatswald Bayerns durchgeführt wird, soll die Lebensgrundlagen der Wälder erfassen. Ihre Ergebnisse, welche beispielsweise über bestimmte Klimafaktoren, über die Böden oder über die ursprüngliche Baumarten-Zusammensetzung der Wälder Auskunft geben, werden in Karten und erläuternden Texten dargestellt. Im Nationalpark Bayerischer Wald hat die Oberforstdirektion Regensburg im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine Standortserkundung durchgeführt. Die gesamte Planung kann hier nur auf gründliche ökologische Kenntnisse aufbauen. Das gilt besonders für die künftige Behandlung der Waldbestände, die für den Nationalpark Bayerischer Wald eine zentrale Rolle spielt. Wiederholte kartenmäßige Aufnahmen der geschlossenen und der abschmelzenden Schneedecke, phänologische Beobachtungen, Messungen der nächtlichen Minimumtemperaturen und der wirksamen Mitteitemperaturen nach PALLMANN ermöglichen nun detaillierte Aussagen über das Geländeklima im Nationalparkgebiet. Die Auswertung von Akten der Oberforstdirektion Regensburg gab Aufschluß darüber, wie in den letzten 100 Jahren Sturm, Schneebruch, Frost und Dürre in das Leben der Wälder eingegriffen hatten. Den größten Arbeitsaufwand verursachte eine Kartierung der Böden nach ökologischen Gesichtspunkten im Maßstab 1: Ergänzend wurden Nadelanalysen und einige Bodenanalysen durchgeführt. Die Informationen über das Geländeklima und über die Böden sind zu einer Standortsgliederung verarbeitet. Schließlich ermöglichten es die vollständig erhaltenen Aufnahmeergebnisse der ersten gründlichen Forsteinrichtung, die Baumarten-Zusammensetzung der Wälder um die Mitte des vorigen Jahrhunderts anzugeben; aufgrund der damaligen Altbaumbestände wurden "Näherungswerte" für die natürliche Baumartenzusammensetzung der Wälder auf den einzelnen Standorten ermittelt. Die Standortserkundung beschäftigte sich also mit drei Bereichen, mit dem Geländeklima, mit den Böden und mit dem Versuch, die ursprüngliche Zusammensetzung der Wälder zu rekonstruieren. Diese drei Bereiche stehen aber nicht isoliert nebeneinander, sondern haben intensive Wechselbeziehungen. So helfen beispielsweise die geländeklimatologischen Ergebnisse zu einem besseren Verständnis der Verbreitung bestimmter Bodenformen und die Baumartenzusammensetzung der Wälder ist eng mit den Eigenschaften der Standorte gekoppelt. Die hier vorgelegten Ergebnisse der Standorterkundung sollen einen Beitrag zur gesamt-ökologischen Erforschung des Nationalparks Bayerischer Wald liefern. Sie sind deshalb in Karten, Abbildungen und Tabellen so ausführlich wiedergegeben, daß sie von anderen Disziplinen weiterverwertet werden können. 1.2 Durchführung der Standortserkundung Die Standortserkundung wurde von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des erstgenannten Verfassers durchgeführt: Dr. Wolfram Elling Edmund Bauer Gerald Klemm Dr. Herbert Koch Im Sommer 1971 wirkten außerdem Werner Bierstedt und Hans Waldhier bei der Bodenkartierung mit. Während der Vorerkundung wurde anhand von Boden einschlägen eine Gliederung der Böden erarbeitet. Es schloß sich die Kartierung der Böden im Maßstab 1:10000 an. Nebenher lief eine Reihe geländeklimatologischer Untersuchungen. Die Auswertung des Materials fand während der Wintermonate in der Oberforstdirektion Regensburg statt. Der zeitliche Ablauf der Arbeiten kann aus der folgenden Übersicht entnommen werden: Vorerkundung: Elling Elling, Bauer, Klemm, Koch Kartierung: Elling, Bauer, Klemm, Koch Elling, Bierstedt, Waldhier September - November 1969 Mai - Juni 1970 Juli - Dezember 1970 Mai - August
16 Abb. 1: Lage und Einteilung des Nationalparkgebietes in Gebiets-Abschnitte ) I"'".-1 ;\. I Untersuchun gsgebiet A- I\. A..1. A. A- A. A I I :11. I \ I I I Il A.. Abschnitt V j\.. I\.. St.Oswald 0 I\.. ) I, I \,..."..\'}-.../... J J.. 0 Schö nanger ;/ c:1-j-'~'~,~,_ "~{/ --'- - '1.--~):~lS,;;; ::~J/., _,~',;;.J,... ' --,'r' Neudorf i -'-'~~/~ "-\,r" ' / 0,\ Hohenau '---' f J,,..., Auswertungen: Koch Dezember April 1970 Elling, Bauer, Klemm März - April 1970 Elling, Bauer, Klemm, Koch Dezember März 1971 Bauer, Wald hier November April 1972 Elling (mit Unterbrechungen) November August 1973 Der vorliegende Text stammt vom erstgenannten Verfasser. Die kartenmäßige Aufnahmen der Schneedecke, die phänologischen Beobachtungen und die Messungen der Minimumtemperaturen konnten nur durch den Einsatz aller Forstbeamten des Nationalparkgebietes realisiert werden; ihnen sei hier ganz besonders gedankt. Soweit bisher chemische Analysen (Nadel- und Bodenanalysen) durchgeführt werden konnten, erfolgten sie im Labor der Oberforstdirektion Regensburg. Wir danken dafür Frau A. Messenzehl. 14
17 Ein großer Teil der Untersuchungen wäre ohne spezielle Beratung ist nicht möglich gewesen. Vor allem Prof. Dr. A. BAUMGARTNER vom Institut für Meteorologie in München und Prof. Dr. K. KREUTZER vom Institut für Bodenkunde und Standortslehre, ebenfalls in München, haben durch Rat und Hilfe die Arbeiten gefördert. Weiter sind zu nennen Prof. Dr. W. laatsch, der leiter des Instituts für Bodenkunde und Standortslehre in München, Dr. h. c. Georg PRIEHÄUSSER in Zwiesel, Dr. W. BAUBERGER vom Bayerischen Geologischen landesamt in München, überregierungschemierätin Dr. L. Bauer von der landesstelle für Gewässerkunde und Wasserwirtschaftliehe Planung Baden-Württemberg in Karlsruhe sowie Prof. Dr. F. FRANZ und Dr. J. BACHlER vom Institut der Ertragskunde in München. Dem Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes und dem Wetteramt München sowie der landesstelle für Gewässerkunde in München verdanken wie Beobachtungsdaten. Die Firma CARl ZEISS in überkochen stellte ein Kreispolarimeter leihweise zur Verfügung. Allen Genannten danken wir für ihre Hilfe. 15
18 2. Geographische Einführung 2.1 Lage, Naturraum Südöstlich der Cham-Further Senke teilt die Grenze zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei einen einheitlichen Naturraum. Sie folgt etwa der Kammlinie des Mittelgebirgszuges, der früher zusammenfassend als Böhmerwald bezeichnet wurde (siehe z. B: Anonym, Die Forstverwaltung Bayerns, 1844). Heute versteht man unter Böhmerwald im allgemeinen nur noch den Teil, der auf tschechoslowakischem Staatsgebiet liegt und nennt die Abhänge auf der deutschen Seite den Hinteren oder Inneren Bayerischen Wald. (FEHN 1959, CZAJKA und KLiNK 1967). Dieser Begriff meint nur den Hauptabhang des Gebirges, gegen Südwesten und Süden schließen sich das Hügelland der Regen-Senke und die Wegscheider Hochfläche sowie jenseits der Regen-Senke der Vordere Bayerische Wald an. Der Nationalpark Bayerischer Wald mit seinen Hauptbergen Rachel (1453 m) und Lusen (1373 m) nimmt den mittleren Abschnitt des Inneren Bayerischen Waldes ein. Das Untersuchungsgebiet (Nationalparkgebiet) der vorliegenden Arbeit greift teilweise über die Grenzen des Nationalparks hinaus. Es reicht von der böhmischen Grenze und dem Kleinen Regen im Norden bis herunter zum Süd rand des geschlossenen StaatswaIdes, den die Orte Spiegelau, St. Oswald, Neuschönau und Schön brunn ungefähr markieren. Im Westen schließen jenseits der Flanitz die Besitzungen des Freiherrn von Poschinger und auf der anderen Seite der Bahnlinie Spiegelau-Frauenau weitere Staatswaldungen an. Die Ostgrenze folgt der Straße von Finsterau zur Ödung Buchwald in Böhmen und dem Lauf des Reschwassers. Die beschriebene, ha umfassende Fläche ist gemeint, wenn in dieser Arbeit von Nationalparkgebiet oder Untersuchungsgebiet die Rede ist; auf sie beziehen sich sämtliche Karten und Erhebungen. Zur Erleichterung des Überblicks ist das Nationalparkgebiet entsprechend den bisherigen Forstamtsbereichen in sechs Gebiets-Abschnitte gegliedert (siehe Abb. 1): Gebiets-Abschnitt I (bisher Forstamt Buchenau, Abk.: Bu) Gebiets-Abschnitt 11 (bisher Forstamt Klingenbrunn, Abk.: Kli) 417 ha 1845 ha Gebiets-Abschnitt 111 (bisher Forstamt Spiegelau, Abk.: Sp) Gebiets-Abschnitt IV (bisher Forstamt St. Oswald, Abk.: St.O) Gebiets-Abschnitt V (bisher Forstamt Mauth-West, Abk.: M-W) Gebiets-Abschnitt VI (bisher Forstamt Mauth-Ost, Abk.: M-O) insgesamt 2915 ha 3395 ha 3065 ha ha ha Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich zwischen seinem höchsten Punkt, dem Rachelgipfel (1453 m) und dem tiefsten Punkt (667 m) bei der Schönauer Mühle an der Kleinen Ohe über einen Höhenunterschied von fast 800 m. 2.2 Landschaftsgestalt In den abgerundeten Formen seiner Berge zeigt der Bayerische Wald die Kennzeichen eines schon lange Zeit der Verwitterung und Abtragung unterliegenden Gebirges. Bei genauerem Zusehen erkennt man auf verschiedenen Niveaus plateauartige Verebnungen, die als eine Treppe alter Rumpfflächen aufgefaßt werden (ERGENZINGER 1965). Die Anteile der einzelnen Höhenstufen an der Fläche des Nationalparkgebiets zeigt die folgende Aufstellung, die mit Hilfe des Polarplanimeters aus der Karte 1: gewonnen ist (siehe auch Tab. 1): Bei einem Gebirge, dessen Hänge sich mit gleichmäßigem Gefälle zu den Gipfeln hinaufziehen, müßten die Flächen der einzelnen Stufen mit der Höhe kontinuierlich abnehmen. Hier dagegen zeigt sich ein sprunghafter Rückgang der Flächenanteile bei etwa 900 m sowie bei etwa 1300 m und deutet die typische Geländegestalt an: Vorberge, flache Hänge und Täler unterhalb 900 m, ein steiler Anstieg zwischen 900 und 1100 m, von einzelnen Gipfeln überragte flache Rücken und Plateaus zwischen 1100 und 1300 m. Fast ein Viertel der Fläche, nämlich die weiten Talkessel an der Schwarzach und der Großen Ohe, sowie das Hügelland um Altschönau und Neuschönau, liegt 700 bis 800 m hoch. Ein weiteres Viertel nehmen die Vorberge (Bocksberg, Jägerriegel, Siebenruck) und der flachere, untere Teil des Haupt- 16
19 Tabelle 1 Flächen und Flächenanteile der verschiedenen Höhenlagen im Nationalparkgebiet Höhenlage liebhts-ablchnitt I Gebl.ts-Absdlnl tt Il Gebiets-Ablehnl tt III (blsh. FA. adwiiu) (bi.,.. FA.K1f1ljtllbnm (blah.fa. Splege lau) m ha % ha % ha % Geb1ets-Abschnl tt IV G.b1ets-Abschnl tt V Gtblets-Abschnl tt VI Nationalpark- (bllh. FA.St.Dsn ld) (bllh. FA. lautfi.,.. t) (blsh.fa. ~lauth-ost) gebiet ha % ha 'fo ha -~ ha % , :; ') hag ~ ) , ~ 3 ~01 25 'H ' ,5 insgesamt ~ 100 hanges ein (800 bis 900 m). Die 900 m-höhenlinie trennt also das Gebiet in zwei nahezu flächengleiche Teile. Oberhalb werden die Hänge steiler, abzulesen an den wesentlich geringeren Anteilen der Stufen 900 bis 1000 mund 1000 bis 1100 m. Relativ große Flächen liegen noch zwischen 1100 und 1300 m, weil sich hier das Gelände zu den typischen Hochlagen-Plateaus verbreitert. Nur noch einzelne Gipfel ragen darüber hinaus. Zwischen Rachel und Lusen bildet die Haupthöhe des Grenzgebirges einen schmalen Rücken, der steil gegen Südwesten und flach gegen Nordosten abfällt. Auf der böhmischen Seite und östlich des Lusen schließen sich weitflächige Hochlagen-Plateaus an. 2.3 Bewaldung Der Wald, der das gesamte Nationalparkgebiet bedeckt, ist nur durch die Rodungsinseln um die Ort- schaften Wald häuser, Altschönau, Guglöd und Glashütte unterbrochen. Sehr spät erst begann die Besiedelung. Die genannten Orte verdanken ihre Entstehung entweder dem Goldenen Steig oder ehemaligen Glashütten. 2.4 Flußgebiete Die Staatsgrenze gegen die Tschechoslowakei weicht im Untersuchungsgebiet nur geringfügig von der Wasserscheide zwischen den Einzugsgebieten der Eibe und der Donau ab. Nur ein schmaler Geländestreifen im Westen entwässert über die Flanitz zum Regen. Alle anderen Bäche und Flüsse, nämlich die Schwarzach, die Große Ohe, die Kleine Ohe, das Sagwasser, das Reschwasser und der Teufelsbach münden in die IIz. 17
20 Nationalpark mit Rachelsee. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist fast ausschließlich mit Wald bedeckt. Foto: H. Bibelriether 18
21 3. Klima Ziel der folgenden Abschnitte ist es, das Klima als Standortfaktor zu erfassen. Bei dieser ökologischen Betrachtungsweise geht es also nicht primär um meteorologische oder klimatologische Zusammenhänge, sondern um die Wirkungen des Klimas auf das Leben von Pflanzen und Tieren. Ein solches Vorhaben stößt in mehrfacher Hinsicht auf Schwierigkeiten, die teilweise von der Zerlegung des Komplexes Klima in einzelne, untereinander verkoppelte Faktoren herrühren, teilweise auch von unserer lückenhaften Kenntnis über die spezifischen Reaktionen der Lebewesen auf bestimmte Umwelteinflüsse. Daher ist es hier besonders nötig, sich stets der Gefahr von Fehlinterpretationen bewußt zu bleiben. Die Ergebnisse von Beobachtungen und Messungen werden daher im folgenden Text ausführlich wiedergegeben und streng von ökologischen Erklärungsversuchen getrennt. Die Stellung des Bayerischen Waldes im mitteleuropäischen Klimabereich hat BAUMGARTNER (1970) vom Standpunkt des Meteorologen folgendermaßen gekennzeichnet: "Der Raum liegt im Bereich des planetarischen Westwindgürtels, allerdings bereits so weit landeinwärts, daß sich die kontinentalen meteorologischen Einflüsse, vorwiegend aus Südosten, bemerkbar machen. Die Grenzzone gegensätzlicher Klimaeigenschaften wird durch den querliegenden Höhenzug des Böhmerwaldes verschärft. Im Sommer liegt der Bayer. Wald häufig an der Ostflanke westlicher Hochdruckgebiete und im Stau der von Westen her auflaufenden Fronten. Dies ist die eine Quelle für relativ großen Niederschlagsreichtum im Sommer. Die andere sind die Vb-Regenwetterlagen, die aus feuchter Luft aus dem MitteImeerraum kommend, auf dem Weg nach Nordosten auch über den Bayer. Wald ziehen und Täler und Höhen tagelang mit Wolken und Regen verhängen. Im Winter liegt die Landschaft weiter und häufiger im Bereich des kalten europäischen Hochdruckgebietes. Bei klarem Himmel kommt es zu tiefen Nachttemperaturen. Die pendelnde Grenzlage zwischen maritimen und kontinentalen Einflüssen und die Tiefdruckgebiete aus dem Adriaraum sind die Ursache verhältnismäßig großen Schneereichtums. Das Böhmerwaldgebirge erfüllt klimatisch ähnliche Funktionen wie hydrologisch: es ist Wasser- und Klimascheide zugleich. So sind zum Beispiel die Niederschlagsmengen und Schneehöhen auf der Ostseite des Böhmerwaldes bedeutend geringer als auf der Westseite." Die Besprechung der einzelnen klimatischen Faktoren geht aus von den Meßwerten der Stationen des Deutschen Wetterdienstes. Der Vergleich mit benachbarten Gebieten soll das Besondere herausarbeiten und zugleich eine Hilfe für die ökologische Beurteilung der einzelnen Klimafaktoren sein. Eine solche großräumige Betrachtungsweise kann sich nicht nur auf die Klimastationen im Nationalparkgebiet und seiner unmittelbaren Umgebung stützen, sondern muß den ganzen Bayerischen Wald bis hinunter in die Donauniederung und in die Cham-Further-Senke berücksichtigen. Glücklicherweise brauchen wir uns im Bayerischen Wald nicht mit einer groben Klimacharakterisierung anhand der Meßwerte der amtlichen Wetterstationen zu begnügen. Zur Abwandlung des Großklimas durch das bergige Gelände sind gerade hier grundlegende Untersuchungen durchgeführt worden. GEIGER, WOELFLE und SEIP (1933 und 1934) haben auf Meßprofilen vom Tal bis zum Gipfel des Großen Arber Lufttemperatur und Luftfeuchte gemessen. In einem mehrjährigen, ökologisch ausgerichteten Untersuchungsprogramm haben BAUMGARTNER (1958 a, 1958 b, 1960 b, 1961, 1962, 1964, 1970) BAUMGART NER, KLEINLEIN und WALDMANN (1956), BAUM GARTNER und HOFMANN (1957) und WALDMANN (1959) Regenmengen, Nebel und Nebelniederschlag, Sonnen bestrahlung bei verschiedener Geländeform, Luft- und Bodentemperaturen, Schneehöhen und Ausaperung, sowie die Zeitpunkte des Austreibens von Pflanzen bestimmt und teilweise kartenmäßig dargestellt. Auf den von den geannten Autoren angewandten Verfahren fußen vielfach die speziellen Untersuchungen im Nationalpark. Bei einem Höhenbereich von fast 800 m und sehr unterschiedlichen Geländeformen bestehen bedeutende klimatische Unterschiede innerhalb des Gebietes. Sie zu erfassen und - soweit möglich - kartenmäßig darzustellen, ist ein Ziel dieser Arbeit. Soweit genügend Material vorhanden ist, gliedert sich demnach die Besprechung jedes Klimafaktors in drei Teile: a) Großklima nach Meßwerten des Deutschen Wetterdienstes b) Abwandlung des Klimas durch das Gelände (nach der Literatur) c) spezielle Untersuchungen über das Geländeklima 19
22 des Nationalparkgebietes. 3.1 Einzelne Klimafaktoren Abb.2: Monatsmittel der Bewölkung in Zehnteln der Himmelsfläche ( ) nach Unterlagen des Deutschen Wetterdienstes Strahlung Die von der Sonne ausgehende Strahlung hält unser gesamtes Wettergeschehen in Gang. Sie bildet außerdem die Energiegrundlage aller Lebensvorgänge, ist also auch ökologisch von zentraler Bedeutung. An der Bodenoberfläche lassen sich verschiedene Strahlungsströme unterscheiden (GIGGER 1961): 1. Direkte Sonnenstrahlung 2. Ungerichtete Himmelsstrahlung, entstanden durch Zerstreuung der Sonnenstrahlung in der Atmosphäre 3. An der Erdoberfläche zurückgeworfene Reflexstrahlung 4. Ausstrahlung von der Erdoberfläche zur Atmosphäre 5. Gegenstrahlung von der Atmosphäre zur Erdoberfläche Bei den Nummern 1-3 handelt es sich um kurzweilige, bei Nr. 4 und 5 um langweilige Strahlung. Diese tritt bei Tag und Nacht auf,jene nur tagsüber. Aus den genannten Größen ergibt sich die Strahlungsbilanz an der Erdoberfläche. Aus dem Gebiet des Bayerischen Waldes liegen derzeit noch keine Meßergebnisse über den Faktor Strahlung vor. Es sind aber Untersuchungen durch BAUM GARTNER im Gang. Als Hilfsgrößen werden daher vorerst die Bewölkung und die Sonnenscheindauer sowie die Zahlen der heiteren und trüben Tage herangezogen Bewölkung und Sonnenscheindauer Die Bewölkung wird von den Beobachtern der Wetterstationen in Zehnteln (neuerdings in Achteln) der Himmelsfläche geschätzt, ist also keine gemessene Größe. Sie ist zudem sehr von der Geländelage abhängig. Täler und Mulden mit häufiger Nebelbildung sowie Kammlagen der Gebirge, die zeitweise in die Wolken hineinreichen, liefern höhere Werte der Bewölkung. Trotzdem ergibt sich für die in Tabelle 2 aufgeführten Orte ein sehr ähnlicher Jahresgang der Himmelsbedeckung mit einem Maximum im Winter (Nov. - Jan.) Zehntel Gr:Falkens tein (1307m).. Zwiesel(590mJ Pass au-ob erha us(409m) Monate J S 0 N 0 und einem sekundären Maximum im Sommer (Juni, Juli); die Übergangsjahreszeiten, vor allem der März und der September sind relativ wolkenarm. Im Winter ragen die Berge häufig über die Nebel-und Hochnebeldecken hinaus, unter denen das Flachland liegt. Im Sommer stauen oder bilden sich die Wolken oft an den Gebirgen und verursachen dort eine höhere Himmelsbedeckung als im Flachland. Abb. 2 macht dies für 3 Stationen des Bayer. Waldes deutlich. Die tatsächliche Sonnenscheindauer hängt von der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer und dem Grad der Bewölkung ab. Noch klarer, als bei der mittleren Bewölkung zeigt sich hier (Tab. 3), daß die Gebirge im Winter mehr, im Sommer weniger Sonne erhalten als die Niederungen. So hatte beispielsweise während der Periode Regensburg im Dezember eine durchschnittliche Sonnenscheindauer von 32 Stunden, auf dem Großen Falkenstein waren es dagegen 77 Stunden (siehe Abb. 3). Im Bergland bewirken Hangrichtung, Hangneigung und Horizonteinengung wesentliche Unterschiede für den Gewinn an direkter Sonnenstrahlung. Auf die übrigen Strahlungsströme (siehe oben) hat die Geländeform 20
23 Tabelle 2 Monats- und Jahresmittel der Bewölkung in Zehnteln der Himmelsfläche (Zeitraum , nach Unterlagen des Deutschen Wetterdienstes) S t a t ion Seehöhe Jan. Febr. März Apr. Cham 411 1,8 1,5 6,3 6,5 GroSer Falkenstein ,4 1,2 6,5 6,6 Höllenstein - Kr ,1 6,1 5,5 5,9 Metten 313 1,9 1,1 6,2 6,4 Passau-Oberhaus 409 1,1 1,2 6,1 6,2 Regensburg 331 1,1 1,5 6,1 6,1 Zwiesel 590 1,4 6,9 5,9 6,3 Zum Versleioha a) Alpen und Alpenvorland HohenpeiSenberg 911 1,5 1,2 6,1 1,1 Kohlgrub, Bad 810 1,1 1,0 6,4 6,6 Mittelberg ,9 6,1 6,1 6,4 MUnchen-Riem 524 1,6 1,2 6,4 6,4 Wendelstein ,1 6,6 6,4 6,9 Zugspi tze ,5 6,5 6,4 1,0 b) ~~~w~~!~~~!~~~!~~~ Feldberg ,1 1,4 1,0 1,2 Freudenstadt-Kienberg 191 1,8 1,2 6,4 6,4 Kahl/Main 110 1,5 6,9 5,1 5,5 WUrz burg-stein 259 7,6 6,9 5,8 5,6 Wasserkuppe 921 8,2 1,4 6,8 6,5 Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Dez. Jahr 6,2 6,4 6,3 6,1 5,1 6,6 8,0 8,3 6,8 6,6 1,0 6,8 6,5 5,9 6,1 1,1 1,1 6,1 5,5 6,0 6,1 5,8 5,1 6,1 1_,1 1,8 6,3 6,2 6,1 6,4 6,2 5,9 6,6 8,3 8,6 6,9 6,3 6,6 6,2 6,1 5,1 6,4 8,0 8,4 6,1 6,0 6,5 6,1 6,1 5,6 6,5 8,2 8,5 6,1 6,1 6,6 6,4 6,0 5,1 5,9 1,3 1,5 6,5 6,9 1,3 6,1 6,4 5,9 6,2 1,4 1,2 6,9 6,4 1,1 6,6 6,2 5,9 5,9 6,9 6,8 6,6 6,1 6,6 6,0 5,1 5,5 5,1 6,1 6,6 6,3 6,4 6,8 6,3 6,0 5,6 6,1 1,9 1,9 6,1 6,9 1,4 1,1 6,5 5,9 5,6 6,1 6,4 6,5 1,2 1,8 1,3 6,9 6,0 5,5 5,9 6,1 6,6 1,2 1,5 6,9 1,0 6,5 6,3 1,2 1,2 7,1 6,2.6,8 6,2 6,2 5,8 6,1 1, ,5 5,9 5,8 5,8 5,5 6,5 7,8 8,1 6,4 5,6 6,1 5,8 5,6 5,5 6,2 7,8 1,6 S,4 6,5 1,0 1,1 6, ,8 8,2 8,' 7,2 nur einen geringen Einfluß. Anhand der Daten über die direkte Sonnenstrahlung lassen sich daher gelände bedingte Unterschiede in der Strahlungszufuhr weitgehend erfassen und kartenmäßig darstellen (BAUM GARTNER 1960 a, LEE und BAUMGARTNER 1966). Es wäre sehr wertvoll, wenn Besonnungskarten, wie sie BAUMGARTNER für das Falkensteingebiet und LEE und BAUMGARTNER für das Fichtelgebirge vorgelegt haben, auch für den Nationalpark erarbeitet werden könnte. Das Meteorologische Institut München arbeitet bereits an solchen Karten. Sie sollten differenziert nach Jahreszeiten und für den Durchschnitt des Jahres erstellt werden. Für die Klärung glazial-geologischer Fragen, sowie für das Verständnis der Schnee-, schmelze, phänologischer Beobachtungen und biologischer Vorgänge - um nur einige Beispiele zu nennen - wären sie von unersetzlichem Wert. Bei der Interpretation einer solchen Karte muß man jedoch stets beachten, daß mit der direkten Sonnenstrahlung nur ein Strahlungsstrom erfaßt ist. Da die Energie aus der ungerichteten Himmelsstrahlung in derselben Größenordnung liegt und allen Hangrichtungen etwa in gleicher Weise zugute kommt, mildert sie die Gegensätze, die durch unterschiedliche Besonnung entstehen. Die mittleren Zahlen der heiteren und der trüben Tage während des Zeitraums wurden erst kurz vor Abschluß des Manuskripts bekannt. Sie sind aus den Tab. 4 und 5 und den Abb. 4 und 5 zu entnehmen Wind Über die durchschnittlichen Windverhältnisse geben die Tabelle 6 bis 8 Auskunft, die auf den Beobachtun- 21
24 Abb. 3: Mittlere Monatssummen der Sonnenscheindauer ( ) nach Unterlagen des Deutschen Wetterdienstes Abb.4: Mittlere Zahl der heiteren Tage ( ) nach Unterlagen des Deutschen Wetterdienstes Stunden Gr. Falkenstein (1307m) Passau-Oberhaus(409mJ Regensburg (337m) Anzahl der Tage Großer Falkenstein Passau-Oberhaus - '----- Zwiesel 2{x~~ ~~--~-+~ ~... ~.\...,...,... \ ',\ \' mo+---~ ~:~\r---1 \\ ".\ \:::,"',{// FMAMJ J ASOND Monate Monate J F M A M J ] ASO N 0 J F gen an den Stationen Großer Falkenstein, Zwiesel und Passau-Oberhaus beruhen. Betrachten wir zunächst die Ergebnisse vom Großen Falkenstein. Die Wetterwarte stand auf dem Gipfel des Berges. Die Windregistrierungen finden oberhalb der Wipfelhöhe des umgebenden Waldes statt, sind also weitgehend frei von störenden Geländeeinflüssen. Die Verteilung der Winde auf Himmelsrichtungen zeigt zunächst das starke Vorherrschen der Westwinde, wie es für Mitteleuropa geläufig ist. Am stärksten vertreten sinq die SW- und W-Winde. Eine zweite bevorzugte Richtung ist NO. Bei den am häufigsten vorkommenden Windrichtungen SW, W und NO, also Winden, die das Gebirge überqueren, werden gleichzeitig die höchsten mittleren Windstärken erreicht. Noch deutlicher wird diese Tendenz, wenn man die Häufigkeit des Auftretens von Windgeschwindigkeiten über 49 km/h bei den einzelnen Himmelsrichtungen betrachtet (Tab. 9). Über 80% der Winde mit Geschwindigkeit über 49 km/h wehen aus W, SW oder NO. Wir werden diesen Windrichtungen bei Sturmschäden im Wald wieder begegnen (s. Abschnitt 3.2.1). Wind beobachtungen von Stationen in Tälern zeigen häufig einen deutlichen Geländeeinfluß, weil der Verlauf des Tales die Luftströmungen lenkt. Die Station Zwiesel, in einem weiten Talkessel gelegen, beobachtet gegenüber dem Großen Falkenstein zwar geringere Windstärken und häufiger Windstille, es treten aber auch hier die bevorzugten Windrichtungen NO, SW und W ganz deutlich hervor. Die Ostwinde fallen durch ihre hohe mittlere Windgeschwindigkeit auf. Windgeschwindigkeiten von 49 km/h und darüber sind im 8jährigen Zeitraum nur noch aus Wund SW sowie 0 und NO beobachtet worden. Auch an der Station Passau-Oberhaus ist eine deutliche Bevorzugung der W- und SW- sowie der NO- und O-Richtung bemerkbar. Die höchsten mittleren Windstärken der Monate konzentrieren sich auf die W- und 22
25 Tabe"e 3 Mittlere Monats- und Jahressummen der Sonnenscheindauer (Stunden) (Zeitraum , nach Unterlagen des Deutschen Wetterdienstes) Station Seehöhe Jan. Febr. März Apr. Gro8er Falkenstein Passau-Oberhaus Regensburg Zum Vergleicbl a) Alpen und Alpenvorland Hobenpei8enberg Isny Münoben-Nymphenburg Oberstdorf Wendelstein 1839/ Zugspi tze b) Südwestdeutsohlanl Feldberg Freudenstadt- Kienb.l Wasserkuppe Würz burg-stein Mai Juni Juli Aug. Sept Okt Nov Dez Jahr ~ O-Richtung, wobei sicherlich der Verlauf des Donautales eine Rolle spielt. Windgeschwindigkeiten über 49 km/h wurden nur vereinzelt beobachtet und zwar ausschließlich aus W, SW und O Lufttemperatur Die Temperatur der Luft und des Bodens greifen durch Steuerung biologischer Vorgänge in vielfältiger Weise in das Leben der Pflanzen ein. Noch wesentlicher sind für die physiologischen Vorgänge aber die Temperaturen, die einzelne Teile einer Pflanze unter dem Einfluß der jeweiligen Strahlungsbedingungen und der Außentemperatur annehmen. Wenn nun in den folgenden Abschnitten vor allem die Temperaturverhältnisse in der Luft und im Boden besprochen werden, muß stets die begrenzte Aussagefähigkeit dieser Daten bedacht werden Großklima Die Monats- und Jahresmittel der Lufttemperatur in der Periode für den Bayerischen Wald, so- wie für einige Vergleichsstationen sind aus Tab. 10 zu entnehmen. Schon eine flüchtige Übersicht über die Werte aus höheren Lagen zeigt, daß bei den hier anzutreffenden geringen Temperaturen zahlreiche Pflanzen nicht mehr gedeihen oder am Rande ihrer Existenzmöglichkeit stehen. Die Wärme wird hier zu einem ausgesprochenen Minimumfaktor unter den Wachstumsbedingungen. Um den Abfall der Mitteltemperaturen mit dem Anstieg ins Gebirge deutlich zu machen, ist die Abb. 6 gezeichnet worden. Es sind hierfür nur 4 Stationen herangezogen, deren Temperaturmessungen nicht wesentlich durch lokale Inversionen (Kaltluftstau) beeinträchtigt sind (BAUMGARTNER 1961). Beim Jahresmittel ergibt sich ein Rückgang der Temperatur um 0,49 0 C je 100 m Höhendifferenz. Das stimmt gut mit dem vertikalen Temperaturgradienten von -0,48 0 C/1 00 m überein, den BAUMGARTNER (1970) auf Grund der bei MANIG (1950) veröffentlichten Mittelwerte der Periode erhielt. Aus den Temperaturprofilen der Monatsmittel lassen sich die nach der Jahreszeit recht unterschiedlichen Temperaturgradienten ablesen. Es können auch Zwi- 23
26 schenwerte der Mitteltemperatur für andere Höhenlagen entnommen werden. Dabei ist aber zu beachten, daß die Darstellung nur für Stationen gilt, an denen Kaltluftstau und Kaltluftfluß keine wesentliche Rolle spielen, d. h. also im wesentlichen für die Hanglagen und Hochlagen des Gebirges. Vom Bayerischen Wald heißt es im Volksmund, es sei dort "drei Vierteljahr Winter und ein Vierteljahr kalt". Wie verhält es sich nun damit? Ist es im Bayerischen Wald in gleicher Höhenlage kälter als beispielsweise in den Bayerischen Alpen oder im Schwarzwald? Aus den Jahresmitteltemperaturen, die vom Deutschen Wetterdienst für die Periode errechnet wurden, geht hervor, daß die Volksmeinung richtig ist. Unterstellt man einen vertikalen Temperaturgradienten von -0,49 C je 100 m Höhenanstieg, und beschränkt man sich auf Stationen oberhalb 900 m Seehöhe in freier Lage, so ist es an den Alpenstationen um 0,8 bis 1,7 C wärmer als in den entsprechenden Höhenlagen des Bayerischen Waldes. Gleiche Mitteltemperatur MeBstation Seehöhe m Tabelle 4 Mittlere Zahl der heiteren Tage (Zeitraum: ; nach Unterlagen des Deutschen Wetterdienstes) Jan Febl Mär2 A.pr. Mai Juni Juli A.ug Sept Okt. Nov. Dez. Jahr Cham (2.1 ) (4.9) (39.0) GroBer Falkenstein Metten Höllenstein- Kraftwerk Passau- Oberhaus Regensburg Zwiesel Zum Vars:leic~ a) Alpen und ialpenvorlajd HohenpeiBenbt jrg Kohl gru 0, Bad 810 2,6 2,4 4,0 4,0 3,5 1,3 3,1 3,3 5,8 5,3 3,0 3,3 41,6 1.1i ttelberg ,8 3,6 5,0 4,5 3,8 2,1 3,4 4,5 5,1 6,6 3,0 4,6 49,6 MUnchen-Riem 524 2,0 2,4 4,1 3,4 2,8 1,9 3,6 3,6 6,4 4,4 1,2 1, 3 31,1,Vendelstein ,1 4,3 5,3 3,3 1,9 1,4 2,6 3,5 5,8 1,8 4,9 4,1 49,6 Zugspitze ,2 4,1 4,9 3,1 1,8 0,8 2,4 2,1 5,2 B,4 5,2 5,6 48,4 b ),Südwestdeu schland Kahl 110 2,1 (2,1 4,9 5,3 4,2 3,6 4,5 3,6 5,9 3,6 1, 1 1, 1 (43,2 Würzburg-Ste n 259 2,2 2,8 5,1 5,2 3,9 2,3 3,0 2,8 5,5 3,8 1,3 1,0 38,9 24
Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität
![Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität](/thumbs/26/9283097.jpg) Übung 5 : Theorie : In einem Boden finden immer Temperaturausgleichsprozesse statt. Der Wärmestrom läßt sich in eine vertikale und horizontale Komponente einteilen. Wir betrachten hier den Wärmestrom in
Übung 5 : Theorie : In einem Boden finden immer Temperaturausgleichsprozesse statt. Der Wärmestrom läßt sich in eine vertikale und horizontale Komponente einteilen. Wir betrachten hier den Wärmestrom in
Orkantief "Lothar" vom 26.12.1999. G. Müller-Westermeier
 Abb.1 Orkantief "Lothar" vom 26.12.1999 G. Müller-Westermeier Zerstörte Boote am Genfer See, Schweiz Foto: dpa Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 entwickelte sich unter einer sehr kräftigen Frontalzone
Abb.1 Orkantief "Lothar" vom 26.12.1999 G. Müller-Westermeier Zerstörte Boote am Genfer See, Schweiz Foto: dpa Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 entwickelte sich unter einer sehr kräftigen Frontalzone
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Wasserkraft früher und heute!
 Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen
 geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
Dezember 2015 meteorologisch gesehen
 Dezember 2015 meteorologisch gesehen In der Naturwissenschaft ist nicht nur die Planung und Durchführung von Experimenten von großer Wichtigkeit, sondern auch die Auswertung und die grafische Darstellung
Dezember 2015 meteorologisch gesehen In der Naturwissenschaft ist nicht nur die Planung und Durchführung von Experimenten von großer Wichtigkeit, sondern auch die Auswertung und die grafische Darstellung
Waldstandorte und Klimawandel
 Waldstandorte und Klimawandel Norbert Asche, Gelsenkirchen 1 AFSV 2009 Waldstandort und seine Merkmale Klima als eine treibende Kraft der Standortentwicklung Klimaentwicklung und Standortmerkmale Ergebnisse
Waldstandorte und Klimawandel Norbert Asche, Gelsenkirchen 1 AFSV 2009 Waldstandort und seine Merkmale Klima als eine treibende Kraft der Standortentwicklung Klimaentwicklung und Standortmerkmale Ergebnisse
Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien
 Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
Schattenwurf von Windkraftanlagen: Erläuterung zur Simulation
 Bayerisches Landesamt für Umwelt Windkraft Schattenwurf von Windkraftanlagen: Erläuterung zur Simulation Die Bewegung der Rotoren von Windkraftanlagen (WKA) führt zu einem bewegten Schattenwurf, der mit
Bayerisches Landesamt für Umwelt Windkraft Schattenwurf von Windkraftanlagen: Erläuterung zur Simulation Die Bewegung der Rotoren von Windkraftanlagen (WKA) führt zu einem bewegten Schattenwurf, der mit
Die Sterne als Kalender und Uhr verwenden
 Die Sterne als Kalender und Uhr verwenden Information zum VHS-Kurs am 7. März 2003, Carsten Moos Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Die Bedeutung des Polarsterns 2 3 Das Finden des großen Wagens und des
Die Sterne als Kalender und Uhr verwenden Information zum VHS-Kurs am 7. März 2003, Carsten Moos Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Die Bedeutung des Polarsterns 2 3 Das Finden des großen Wagens und des
Vermögensbildung: Sparen und Wertsteigerung bei Immobilien liegen vorn
 An die Redaktionen von Presse, Funk und Fernsehen 32 02. 09. 2002 Vermögensbildung: Sparen und Wertsteigerung bei Immobilien liegen vorn Das aktive Sparen ist nach wie vor die wichtigste Einflussgröße
An die Redaktionen von Presse, Funk und Fernsehen 32 02. 09. 2002 Vermögensbildung: Sparen und Wertsteigerung bei Immobilien liegen vorn Das aktive Sparen ist nach wie vor die wichtigste Einflussgröße
Die Arbeit des Regenwurms im Boden
 Die Arbeit des Regenwurms im Boden Kurzinformation Um was geht es? Regenwürmer zersetzen organisches Material und durchmischen den Boden. Jeder Gärtner weiß, dass sie eine wichtige Rolle im Boden spielen.
Die Arbeit des Regenwurms im Boden Kurzinformation Um was geht es? Regenwürmer zersetzen organisches Material und durchmischen den Boden. Jeder Gärtner weiß, dass sie eine wichtige Rolle im Boden spielen.
Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder im Ballungsraum
 Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder im Ballungsraum Norbert Asche, LB WuH, Gelsenkirchen 1 Klimawandel wird bewirkt durch - natürliche Ursachen - durch Menschen Umwandlung von Wald in Kulturlandschaft
Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder im Ballungsraum Norbert Asche, LB WuH, Gelsenkirchen 1 Klimawandel wird bewirkt durch - natürliche Ursachen - durch Menschen Umwandlung von Wald in Kulturlandschaft
Das Klima im Exkursionsgebiet
 Das Klima im Exkursionsgebiet Einführung Das Klima des Exkursionsgebietes ist aufgrund der Morphologie zwar unterschiedlich aber durchweg als gemäßigtes Klima zu bezeichnen. Der Föhnprozess ist einer der
Das Klima im Exkursionsgebiet Einführung Das Klima des Exkursionsgebietes ist aufgrund der Morphologie zwar unterschiedlich aber durchweg als gemäßigtes Klima zu bezeichnen. Der Föhnprozess ist einer der
Professionelle Seminare im Bereich MS-Office
 Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Psychologie im Arbeitsschutz
 Fachvortrag zur Arbeitsschutztagung 2014 zum Thema: Psychologie im Arbeitsschutz von Dipl. Ing. Mirco Pretzel 23. Januar 2014 Quelle: Dt. Kaltwalzmuseum Hagen-Hohenlimburg 1. Einleitung Was hat mit moderner
Fachvortrag zur Arbeitsschutztagung 2014 zum Thema: Psychologie im Arbeitsschutz von Dipl. Ing. Mirco Pretzel 23. Januar 2014 Quelle: Dt. Kaltwalzmuseum Hagen-Hohenlimburg 1. Einleitung Was hat mit moderner
Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
 Sozialberichterstattung NRW. Kurzanalyse 02/2010 09.07.2010 12.07.2010 Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008
Sozialberichterstattung NRW. Kurzanalyse 02/2010 09.07.2010 12.07.2010 Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008
14. Minimale Schichtdicken von PEEK und PPS im Schlauchreckprozeß und im Rheotensversuch
 14. Minimale Schichtdicken von PEEK und PPS im Schlauchreckprozeß und im Rheotensversuch Analog zu den Untersuchungen an LDPE in Kap. 6 war zu untersuchen, ob auch für die Hochtemperatur-Thermoplaste aus
14. Minimale Schichtdicken von PEEK und PPS im Schlauchreckprozeß und im Rheotensversuch Analog zu den Untersuchungen an LDPE in Kap. 6 war zu untersuchen, ob auch für die Hochtemperatur-Thermoplaste aus
"Zeitlicher Zusammenhang von Schadenshäufigkeit und Windgeschwindigkeit"
 22. FGW-Workshop am 06. Mai 1997 "Einfluß der Witterung auf Windenergieanlagen" am Institut für Meteorologie, Leipzig Dipl.-Ing. Berthold Hahn, Institut für Solare Energieversorgungstechnik e.v., Kassel
22. FGW-Workshop am 06. Mai 1997 "Einfluß der Witterung auf Windenergieanlagen" am Institut für Meteorologie, Leipzig Dipl.-Ing. Berthold Hahn, Institut für Solare Energieversorgungstechnik e.v., Kassel
Anwendungshinweise zur Anwendung der Soziometrie
 Anwendungshinweise zur Anwendung der Soziometrie Einführung Die Soziometrie ist ein Verfahren, welches sich besonders gut dafür eignet, Beziehungen zwischen Mitgliedern einer Gruppe darzustellen. Das Verfahren
Anwendungshinweise zur Anwendung der Soziometrie Einführung Die Soziometrie ist ein Verfahren, welches sich besonders gut dafür eignet, Beziehungen zwischen Mitgliedern einer Gruppe darzustellen. Das Verfahren
QM: Prüfen -1- KN16.08.2010
 QM: Prüfen -1- KN16.08.2010 2.4 Prüfen 2.4.1 Begriffe, Definitionen Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung ist das Prüfen. Sie wird aber nicht wie früher nach der Fertigung durch einen Prüfer,
QM: Prüfen -1- KN16.08.2010 2.4 Prüfen 2.4.1 Begriffe, Definitionen Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung ist das Prüfen. Sie wird aber nicht wie früher nach der Fertigung durch einen Prüfer,
Protokoll des Versuches 7: Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie
 Name: Matrikelnummer: Bachelor Biowissenschaften E-Mail: Physikalisches Anfängerpraktikum II Dozenten: Assistenten: Protokoll des Versuches 7: Umwandlung von elektrischer Energie in ärmeenergie Verantwortlicher
Name: Matrikelnummer: Bachelor Biowissenschaften E-Mail: Physikalisches Anfängerpraktikum II Dozenten: Assistenten: Protokoll des Versuches 7: Umwandlung von elektrischer Energie in ärmeenergie Verantwortlicher
Bevölkerung mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung 2012
 Statistische Übersicht inkl. dem Vergleich zwischen und zur (Aus-)Bildungssituation von jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 1 in den Bundesländern nach dem Mikrozensus Erstellt im Rahmen
Statistische Übersicht inkl. dem Vergleich zwischen und zur (Aus-)Bildungssituation von jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 1 in den Bundesländern nach dem Mikrozensus Erstellt im Rahmen
Daten sammeln, darstellen, auswerten
 Vertiefen 1 Daten sammeln, darstellen, auswerten zu Aufgabe 1 Schulbuch, Seite 22 1 Haustiere zählen In der Tabelle rechts stehen die Haustiere der Kinder aus der Klasse 5b. a) Wie oft wurden die Haustiere
Vertiefen 1 Daten sammeln, darstellen, auswerten zu Aufgabe 1 Schulbuch, Seite 22 1 Haustiere zählen In der Tabelle rechts stehen die Haustiere der Kinder aus der Klasse 5b. a) Wie oft wurden die Haustiere
TOP SELECT PLUS Newsletter Nr.2
 TOP SELECT PLUS Newsletter Nr.2 Anspruch und Wirklichkeit - TOP SELECT PLUS Montag, 4. Juni 2012 Vermögensverwaltungen gibt es wie Sand am Meer. Darunter befinden sich solche, die ihrem Namen alle Ehre
TOP SELECT PLUS Newsletter Nr.2 Anspruch und Wirklichkeit - TOP SELECT PLUS Montag, 4. Juni 2012 Vermögensverwaltungen gibt es wie Sand am Meer. Darunter befinden sich solche, die ihrem Namen alle Ehre
Programm 4: Arbeiten mit thematischen Karten
 : Arbeiten mit thematischen Karten A) Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung an der Wohnbevölkerung insgesamt 2001 in Prozent 1. Inhaltliche und kartographische Beschreibung - Originalkarte Bei dieser
: Arbeiten mit thematischen Karten A) Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung an der Wohnbevölkerung insgesamt 2001 in Prozent 1. Inhaltliche und kartographische Beschreibung - Originalkarte Bei dieser
Meet the Germans. Lerntipp zur Schulung der Fertigkeit des Sprechens. Lerntipp und Redemittel zur Präsentation oder einen Vortrag halten
 Meet the Germans Lerntipp zur Schulung der Fertigkeit des Sprechens Lerntipp und Redemittel zur Präsentation oder einen Vortrag halten Handreichungen für die Kursleitung Seite 2, Meet the Germans 2. Lerntipp
Meet the Germans Lerntipp zur Schulung der Fertigkeit des Sprechens Lerntipp und Redemittel zur Präsentation oder einen Vortrag halten Handreichungen für die Kursleitung Seite 2, Meet the Germans 2. Lerntipp
Klimasystem. Das Klima der Erde und wie es entsteht: Definition Klima
 Das Klima der Erde und wie es entsteht: Definition Klima Unter dem Begriff Klima verstehen wir die Gesamtheit der typischen Witterungsabläufe an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Region über
Das Klima der Erde und wie es entsteht: Definition Klima Unter dem Begriff Klima verstehen wir die Gesamtheit der typischen Witterungsabläufe an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Region über
1 Mathematische Grundlagen
 Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
13.12.2009 Climate lie
 E-Mail: angela.merkel@bundestag.de PERSÖNLICH Frau Dr. Angela Merkel, MdB Platz der Republik 1 Paul-Löbe-Haus (Zi.: 3.441) 11011 Berlin 13.12.2009 Climate lie Warum sind im Sommer und im Winter die CO2
E-Mail: angela.merkel@bundestag.de PERSÖNLICH Frau Dr. Angela Merkel, MdB Platz der Republik 1 Paul-Löbe-Haus (Zi.: 3.441) 11011 Berlin 13.12.2009 Climate lie Warum sind im Sommer und im Winter die CO2
Data Mining: Einige Grundlagen aus der Stochastik
 Data Mining: Einige Grundlagen aus der Stochastik Hagen Knaf Studiengang Angewandte Mathematik Hochschule RheinMain 21. Oktober 2015 Vorwort Das vorliegende Skript enthält eine Zusammenfassung verschiedener
Data Mining: Einige Grundlagen aus der Stochastik Hagen Knaf Studiengang Angewandte Mathematik Hochschule RheinMain 21. Oktober 2015 Vorwort Das vorliegende Skript enthält eine Zusammenfassung verschiedener
Frische Luft in den Keller sobald die Sonne scheint ist Pflicht.
 Frische Luft in den Keller sobald die Sonne scheint ist Pflicht. Diese Meinung herrscht vor seit Jahrhunderten. Frische Luft kann nie schaden. Gerhard Weitmann Bautenschutz Augsburg Jan. 2015 1 Frische
Frische Luft in den Keller sobald die Sonne scheint ist Pflicht. Diese Meinung herrscht vor seit Jahrhunderten. Frische Luft kann nie schaden. Gerhard Weitmann Bautenschutz Augsburg Jan. 2015 1 Frische
Praktikum Schau Geometrie
 Praktikum Schau Geometrie Intuition, Erklärung, Konstruktion Teil 1 Sehen auf intuitive Weise Teil 2 Formale Perspektive mit Aufriss und Grundriss Teil 3 Ein niederländischer Maler zeigt ein unmögliches
Praktikum Schau Geometrie Intuition, Erklärung, Konstruktion Teil 1 Sehen auf intuitive Weise Teil 2 Formale Perspektive mit Aufriss und Grundriss Teil 3 Ein niederländischer Maler zeigt ein unmögliches
Schritt für Schritt zur Krankenstandsstatistik
 Schritt für Schritt zur Krankenstandsstatistik Eine Anleitung zur Nutzung der Excel-Tabellen zur Erhebung des Krankenstands. Entwickelt durch: Kooperationsprojekt Arbeitsschutz in der ambulanten Pflege
Schritt für Schritt zur Krankenstandsstatistik Eine Anleitung zur Nutzung der Excel-Tabellen zur Erhebung des Krankenstands. Entwickelt durch: Kooperationsprojekt Arbeitsschutz in der ambulanten Pflege
Pressemitteilung. Unternehmer bevorzugen Unternehmensübergabe innerhalb der Familie
 Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth Bayreuth, 26. September 2012 Pressemitteilung Unternehmer bevorzugen Unternehmensübergabe
Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth Bayreuth, 26. September 2012 Pressemitteilung Unternehmer bevorzugen Unternehmensübergabe
Bergwelt Wetter-Klima
 Wetter- und Klimaforscher werden aktiv Arbeitsauftrag: Sch arbeiten die Aufgaben in Workshop-Gruppen selbstständig durch, unter zu Hilfename von Atlanten, Internet, Arbeitsblättern und Folien Ziel: Exploratives
Wetter- und Klimaforscher werden aktiv Arbeitsauftrag: Sch arbeiten die Aufgaben in Workshop-Gruppen selbstständig durch, unter zu Hilfename von Atlanten, Internet, Arbeitsblättern und Folien Ziel: Exploratives
Zeichen bei Zahlen entschlüsseln
 Zeichen bei Zahlen entschlüsseln In diesem Kapitel... Verwendung des Zahlenstrahls Absolut richtige Bestimmung von absoluten Werten Operationen bei Zahlen mit Vorzeichen: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren
Zeichen bei Zahlen entschlüsseln In diesem Kapitel... Verwendung des Zahlenstrahls Absolut richtige Bestimmung von absoluten Werten Operationen bei Zahlen mit Vorzeichen: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren
Mathematik. UND/ODER Verknüpfung. Ungleichungen. Betrag. Intervall. Umgebung
 Mathematik UND/ODER Verknüpfung Ungleichungen Betrag Intervall Umgebung Stefan Gärtner 004 Gr Mathematik UND/ODER Seite UND Verknüpfung Kommentar Aussage Symbolform Die Aussagen Hans kann schwimmen p und
Mathematik UND/ODER Verknüpfung Ungleichungen Betrag Intervall Umgebung Stefan Gärtner 004 Gr Mathematik UND/ODER Seite UND Verknüpfung Kommentar Aussage Symbolform Die Aussagen Hans kann schwimmen p und
Sonderrundschreiben. Arbeitshilfe zu den Pflichtangaben in Immobilienanzeigen bei alten Energieausweisen
 Sonderrundschreiben Arbeitshilfe zu den Pflichtangaben in Immobilienanzeigen bei alten Energieausweisen Sonnenstraße 11-80331 München Telefon 089 / 5404133-0 - Fax 089 / 5404133-55 info@haus-und-grund-bayern.de
Sonderrundschreiben Arbeitshilfe zu den Pflichtangaben in Immobilienanzeigen bei alten Energieausweisen Sonnenstraße 11-80331 München Telefon 089 / 5404133-0 - Fax 089 / 5404133-55 info@haus-und-grund-bayern.de
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald -
 Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Info zum Zusammenhang von Auflösung und Genauigkeit
 Da es oft Nachfragen und Verständnisprobleme mit den oben genannten Begriffen gibt, möchten wir hier versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Stück Wasserrohr mit der
Da es oft Nachfragen und Verständnisprobleme mit den oben genannten Begriffen gibt, möchten wir hier versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Stück Wasserrohr mit der
Fehler und Probleme bei Auswahl und Installation eines Dokumentenmanagement Systems
 Fehler und Probleme bei Auswahl und Installation eines Dokumentenmanagement Systems Name: Bruno Handler Funktion: Marketing/Vertrieb Organisation: AXAVIA Software GmbH Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Fehler und Probleme bei Auswahl und Installation eines Dokumentenmanagement Systems Name: Bruno Handler Funktion: Marketing/Vertrieb Organisation: AXAVIA Software GmbH Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE im Bundes-Land Brandenburg vom Jahr 2014 bis für das Jahr 2020 in Leichter Sprache
 Für Ihre Zukunft! Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE im Bundes-Land Brandenburg vom Jahr 2014 bis für das Jahr 2020 in Leichter Sprache 1 Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE
Für Ihre Zukunft! Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE im Bundes-Land Brandenburg vom Jahr 2014 bis für das Jahr 2020 in Leichter Sprache 1 Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE
Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege
 Aktuelle Berichte Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege 19/2015 In aller Kürze Im Bereich der Weiterbildungen mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf für Arbeitslose
Aktuelle Berichte Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege 19/2015 In aller Kürze Im Bereich der Weiterbildungen mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf für Arbeitslose
Die Klimaforscher sind sich längst nicht sicher. Hans Mathias Kepplinger Senja Post
 1 Die Klimaforscher sind sich längst nicht sicher Hans Mathias Kepplinger Senja Post In: Die Welt, 25. September 2007 - Dokumentation der verwandten Daten - 2 Tabelle 1: Gefährlichkeit des Klimawandels
1 Die Klimaforscher sind sich längst nicht sicher Hans Mathias Kepplinger Senja Post In: Die Welt, 25. September 2007 - Dokumentation der verwandten Daten - 2 Tabelle 1: Gefährlichkeit des Klimawandels
Kulturelle Evolution 12
 3.3 Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution 12 Seit die Menschen Erfindungen machen wie z.b. das Rad oder den Pflug, haben sie sich im Körperbau kaum mehr verändert. Dafür war einfach
3.3 Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution 12 Seit die Menschen Erfindungen machen wie z.b. das Rad oder den Pflug, haben sie sich im Körperbau kaum mehr verändert. Dafür war einfach
1 topologisches Sortieren
 Wolfgang Hönig / Andreas Ecke WS 09/0 topologisches Sortieren. Überblick. Solange noch Knoten vorhanden: a) Suche Knoten v, zu dem keine Kante führt (Falls nicht vorhanden keine topologische Sortierung
Wolfgang Hönig / Andreas Ecke WS 09/0 topologisches Sortieren. Überblick. Solange noch Knoten vorhanden: a) Suche Knoten v, zu dem keine Kante führt (Falls nicht vorhanden keine topologische Sortierung
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit
 Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Das große ElterngeldPlus 1x1. Alles über das ElterngeldPlus. Wer kann ElterngeldPlus beantragen? ElterngeldPlus verstehen ein paar einleitende Fakten
 Das große x -4 Alles über das Wer kann beantragen? Generell kann jeder beantragen! Eltern (Mütter UND Väter), die schon während ihrer Elternzeit wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Eltern, die während
Das große x -4 Alles über das Wer kann beantragen? Generell kann jeder beantragen! Eltern (Mütter UND Väter), die schon während ihrer Elternzeit wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Eltern, die während
Weltweite Wanderschaft
 Endversion nach dem capito Qualitäts-Standard für Leicht Lesen Weltweite Wanderschaft Migration bedeutet Wanderung über große Entfernungen hinweg, vor allem von einem Wohnort zum anderen. Sehr oft ist
Endversion nach dem capito Qualitäts-Standard für Leicht Lesen Weltweite Wanderschaft Migration bedeutet Wanderung über große Entfernungen hinweg, vor allem von einem Wohnort zum anderen. Sehr oft ist
Das Leitbild vom Verein WIR
 Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Stellen Sie bitte den Cursor in die Spalte B2 und rufen die Funktion Sverweis auf. Es öffnet sich folgendes Dialogfenster
 Es gibt in Excel unter anderem die so genannten Suchfunktionen / Matrixfunktionen Damit können Sie Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs suchen. Als Beispiel möchte ich die Funktion Sverweis zeigen.
Es gibt in Excel unter anderem die so genannten Suchfunktionen / Matrixfunktionen Damit können Sie Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs suchen. Als Beispiel möchte ich die Funktion Sverweis zeigen.
Um Ihre Ziele durchzusetzen! Um Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen! Um in Begegnungen mit anderen Ihre Selbstachtung zu wahren!
 Handout 19 Interpersonelle Grundfertigkeiten Einführung Wozu brauchen Sie zwischenmenschliche Skills? Um Ihre Ziele durchzusetzen! Um Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen! Um in Begegnungen mit anderen
Handout 19 Interpersonelle Grundfertigkeiten Einführung Wozu brauchen Sie zwischenmenschliche Skills? Um Ihre Ziele durchzusetzen! Um Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen! Um in Begegnungen mit anderen
Festigkeit von FDM-3D-Druckteilen
 Festigkeit von FDM-3D-Druckteilen Häufig werden bei 3D-Druck-Filamenten die Kunststoff-Festigkeit und physikalischen Eigenschaften diskutiert ohne die Einflüsse der Geometrie und der Verschweißung der
Festigkeit von FDM-3D-Druckteilen Häufig werden bei 3D-Druck-Filamenten die Kunststoff-Festigkeit und physikalischen Eigenschaften diskutiert ohne die Einflüsse der Geometrie und der Verschweißung der
Fachbericht zum Thema: Anforderungen an ein Datenbanksystem
 Fachbericht zum Thema: Anforderungen an ein Datenbanksystem von André Franken 1 Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis 1 2 Einführung 2 2.1 Gründe für den Einsatz von DB-Systemen 2 2.2 Definition: Datenbank
Fachbericht zum Thema: Anforderungen an ein Datenbanksystem von André Franken 1 Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis 1 2 Einführung 2 2.1 Gründe für den Einsatz von DB-Systemen 2 2.2 Definition: Datenbank
Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche?
 6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
2. Psychologische Fragen. Nicht genannt.
 Checkliste für die Beurteilung psychologischer Gutachten durch Fachfremde Gliederung eines Gutachtens 1. Nennung des Auftraggebers und Fragestellung des Auftraggebers. 2. Psychologische Fragen. Nicht genannt.
Checkliste für die Beurteilung psychologischer Gutachten durch Fachfremde Gliederung eines Gutachtens 1. Nennung des Auftraggebers und Fragestellung des Auftraggebers. 2. Psychologische Fragen. Nicht genannt.
Bedienungsanleitung. Matthias Haasler. Version 0.4. für die Arbeit mit der Gemeinde-Homepage der Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof
 Bedienungsanleitung für die Arbeit mit der Gemeinde-Homepage der Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof Matthias Haasler Version 0.4 Webadministrator, email: webadmin@rundkirche.de Inhaltsverzeichnis 1 Einführung
Bedienungsanleitung für die Arbeit mit der Gemeinde-Homepage der Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof Matthias Haasler Version 0.4 Webadministrator, email: webadmin@rundkirche.de Inhaltsverzeichnis 1 Einführung
Behörde für Bildung und Sport Abitur 2008 Lehrermaterialien zum Leistungskurs Mathematik
 Abitur 8 II. Insektenpopulation LA/AG In den Tropen legen die Weibchen einer in Deutschland unbekannten Insektenpopulation jedes Jahr kurz vor Beginn der Regenzeit jeweils 9 Eier und sterben bald darauf.
Abitur 8 II. Insektenpopulation LA/AG In den Tropen legen die Weibchen einer in Deutschland unbekannten Insektenpopulation jedes Jahr kurz vor Beginn der Regenzeit jeweils 9 Eier und sterben bald darauf.
Messung der Astronomischen Einheit nach Aristarch
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Aristarch 1 Einleitung Bis ins 17. Jahrhundert war die
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Aristarch 1 Einleitung Bis ins 17. Jahrhundert war die
«Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen
 18 «Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.» 3Das Konzept der Funktionalen
18 «Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.» 3Das Konzept der Funktionalen
II. Zum Jugendbegleiter-Programm
 II. Zum Jugendbegleiter-Programm A. Zu den Jugendbegleiter/inne/n 1. Einsatz von Jugendbegleiter/inne/n Seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 setzen die 501 Modellschulen 7.068 Jugendbegleiter/innen ein.
II. Zum Jugendbegleiter-Programm A. Zu den Jugendbegleiter/inne/n 1. Einsatz von Jugendbegleiter/inne/n Seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 setzen die 501 Modellschulen 7.068 Jugendbegleiter/innen ein.
Gutes Leben was ist das?
 Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Was ist Sozial-Raum-Orientierung?
 Was ist Sozial-Raum-Orientierung? Dr. Wolfgang Hinte Universität Duisburg-Essen Institut für Stadt-Entwicklung und Sozial-Raum-Orientierte Arbeit Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Sozialräume
Was ist Sozial-Raum-Orientierung? Dr. Wolfgang Hinte Universität Duisburg-Essen Institut für Stadt-Entwicklung und Sozial-Raum-Orientierte Arbeit Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Sozialräume
Abiturprüfung ab dem Jahr 2014
 STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG MÜNCHEN Abteilung Gymnasium Referat Mathematik Mathematik am Gymnasium Abiturprüfung ab dem Jahr 2014 Wesentliche Rahmenbedingungen Die Länder Bayern,
STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG MÜNCHEN Abteilung Gymnasium Referat Mathematik Mathematik am Gymnasium Abiturprüfung ab dem Jahr 2014 Wesentliche Rahmenbedingungen Die Länder Bayern,
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung
 Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Die Online-Meetings bei den Anonymen Alkoholikern. zum Thema. Online - Meetings. Eine neue Form der Selbsthilfe?
 Die Online-Meetings bei den Anonymen Alkoholikern zum Thema Online - Meetings Eine neue Form der Selbsthilfe? Informationsverhalten von jungen Menschen (Quelle: FAZ.NET vom 2.7.2010). Erfahrungen können
Die Online-Meetings bei den Anonymen Alkoholikern zum Thema Online - Meetings Eine neue Form der Selbsthilfe? Informationsverhalten von jungen Menschen (Quelle: FAZ.NET vom 2.7.2010). Erfahrungen können
Unsere Ideen für Bremen!
 Wahlprogramm Ganz klar Grün Unsere Ideen für Bremen! In leichter Sprache. Die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat diesen Text geschrieben. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Adresse: Schlachte 19/20 28195 Bremen Telefon:
Wahlprogramm Ganz klar Grün Unsere Ideen für Bremen! In leichter Sprache. Die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat diesen Text geschrieben. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Adresse: Schlachte 19/20 28195 Bremen Telefon:
Lineare Gleichungssysteme
 Lineare Gleichungssysteme 1 Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten Es kommt häufig vor, dass man nicht mit einer Variablen alleine auskommt, um ein Problem zu lösen. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen
Lineare Gleichungssysteme 1 Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten Es kommt häufig vor, dass man nicht mit einer Variablen alleine auskommt, um ein Problem zu lösen. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen
7 Rechnen mit Polynomen
 7 Rechnen mit Polynomen Zu Polynomfunktionen Satz. Zwei Polynomfunktionen und f : R R, x a n x n + a n 1 x n 1 + a 1 x + a 0 g : R R, x b n x n + b n 1 x n 1 + b 1 x + b 0 sind genau dann gleich, wenn
7 Rechnen mit Polynomen Zu Polynomfunktionen Satz. Zwei Polynomfunktionen und f : R R, x a n x n + a n 1 x n 1 + a 1 x + a 0 g : R R, x b n x n + b n 1 x n 1 + b 1 x + b 0 sind genau dann gleich, wenn
Die Lernumgebung des Projekts Informationskompetenz
 Beitrag für Bibliothek aktuell Die Lernumgebung des Projekts Informationskompetenz Von Sandra Merten Im Rahmen des Projekts Informationskompetenz wurde ein Musterkurs entwickelt, der den Lehrenden als
Beitrag für Bibliothek aktuell Die Lernumgebung des Projekts Informationskompetenz Von Sandra Merten Im Rahmen des Projekts Informationskompetenz wurde ein Musterkurs entwickelt, der den Lehrenden als
Was ist clevere Altersvorsorge?
 Was ist clevere Altersvorsorge? Um eine gute Altersvorsorge zu erreichen, ist es clever einen unabhängigen Berater auszuwählen Angestellte bzw. Berater von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften und
Was ist clevere Altersvorsorge? Um eine gute Altersvorsorge zu erreichen, ist es clever einen unabhängigen Berater auszuwählen Angestellte bzw. Berater von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften und
Binärdarstellung von Fliesskommazahlen
 Binärdarstellung von Fliesskommazahlen 1. IEEE 754 Gleitkommazahl im Single-Format So sind in Gleitkommazahlen im IEEE 754-Standard aufgebaut: 31 30 24 23 0 S E E E E E E E E M M M M M M M M M M M M M
Binärdarstellung von Fliesskommazahlen 1. IEEE 754 Gleitkommazahl im Single-Format So sind in Gleitkommazahlen im IEEE 754-Standard aufgebaut: 31 30 24 23 0 S E E E E E E E E M M M M M M M M M M M M M
Ishikawa-Diagramm. 1 Fallbeispiel 2. 2 Was ist ein Ishikawa-Diagramm 2. 3 Vorgehen bei der Erstellung eines Ishikawa-Diagramms 2.
 Ishikawa-Diagramm 1 Fallbeispiel 2 2 Was ist ein Ishikawa-Diagramm 2 3 Vorgehen bei der Erstellung eines Ishikawa-Diagramms 2 4 Vorteile 5 5 Nachteile 5 6 Fazit 5 7 Literaturverzeichnis 6 1 Fallbeispiel
Ishikawa-Diagramm 1 Fallbeispiel 2 2 Was ist ein Ishikawa-Diagramm 2 3 Vorgehen bei der Erstellung eines Ishikawa-Diagramms 2 4 Vorteile 5 5 Nachteile 5 6 Fazit 5 7 Literaturverzeichnis 6 1 Fallbeispiel
OECD Programme for International Student Assessment PISA 2000. Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest. Deutschland
 OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
ORIENTIERUNGSARBEIT (OA 11) Geographie. Fachgruppe der Gymnasien des Kantons Baselland. Taschenrechner (alle eigenen Programme und Daten gelöscht)
 Gymnasium 2. Klassen MAR Code-Nr. (5-stellig):............... Schuljahr 2007 /2008 Datum der Durchführung: Dienstag, 11.03.08 ORIENTIERUNGSARBEIT (OA 11) Gymnasium Geographie Verfasser: Zeit: Fachgruppe
Gymnasium 2. Klassen MAR Code-Nr. (5-stellig):............... Schuljahr 2007 /2008 Datum der Durchführung: Dienstag, 11.03.08 ORIENTIERUNGSARBEIT (OA 11) Gymnasium Geographie Verfasser: Zeit: Fachgruppe
Es gilt das gesprochene Wort. Anrede
 Sperrfrist: 28. November 2007, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Statement des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Karl Freller, anlässlich des Pressegesprächs
Sperrfrist: 28. November 2007, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Statement des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Karl Freller, anlässlich des Pressegesprächs
Lichtbrechung an Linsen
 Sammellinsen Lichtbrechung an Linsen Fällt ein paralleles Lichtbündel auf eine Sammellinse, so werden die Lichtstrahlen so gebrochen, dass sie durch einen Brennpunkt der Linse verlaufen. Der Abstand zwischen
Sammellinsen Lichtbrechung an Linsen Fällt ein paralleles Lichtbündel auf eine Sammellinse, so werden die Lichtstrahlen so gebrochen, dass sie durch einen Brennpunkt der Linse verlaufen. Der Abstand zwischen
Letzte Krankenkassen streichen Zusatzbeiträge
 Zusatzbeiträge - Gesundheitsfonds Foto: D. Claus Einige n verlangten 2010 Zusatzbeiträge von ihren Versicherten. Die positive wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2011 ermöglichte den n die Rücknahme der
Zusatzbeiträge - Gesundheitsfonds Foto: D. Claus Einige n verlangten 2010 Zusatzbeiträge von ihren Versicherten. Die positive wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2011 ermöglichte den n die Rücknahme der
Auszug aus der Auswertung der Befragung zur Ermittlung der IT-Basiskompetenz
 Auszug aus der Auswertung der Befragung zur Ermittlung der IT-Basiskompetenz Wir arbeiten in Strukturen von gestern mit Methoden von heute an Problemen von morgen, vorwiegend mit Menschen, die die Strukturen
Auszug aus der Auswertung der Befragung zur Ermittlung der IT-Basiskompetenz Wir arbeiten in Strukturen von gestern mit Methoden von heute an Problemen von morgen, vorwiegend mit Menschen, die die Strukturen
Physik & Musik. Stimmgabeln. 1 Auftrag
 Physik & Musik 5 Stimmgabeln 1 Auftrag Physik & Musik Stimmgabeln Seite 1 Stimmgabeln Bearbeitungszeit: 30 Minuten Sozialform: Einzel- oder Partnerarbeit Voraussetzung: Posten 1: "Wie funktioniert ein
Physik & Musik 5 Stimmgabeln 1 Auftrag Physik & Musik Stimmgabeln Seite 1 Stimmgabeln Bearbeitungszeit: 30 Minuten Sozialform: Einzel- oder Partnerarbeit Voraussetzung: Posten 1: "Wie funktioniert ein
Fragebogen zur Qualität unserer Teamarbeit
 Fragebogen r Qualität unserer Teamarbeit Die folgenden Aussagen beschreiben wesentliche Aspekte der Teamarbeit wie Kommunikation, Informationsaustausch, Zielfindung, Umgang miteinander etc. Bitte kreuzen
Fragebogen r Qualität unserer Teamarbeit Die folgenden Aussagen beschreiben wesentliche Aspekte der Teamarbeit wie Kommunikation, Informationsaustausch, Zielfindung, Umgang miteinander etc. Bitte kreuzen
Zeit lässt sich nicht wie Geld für schlechte Zeiten zur Seite legen. Die Zeit vergeht egal, ob genutzt oder ungenutzt.
 Zeitmanagement Allgemeine Einleitung Wie oft haben Sie schon gehört Ich habe leider keine Zeit? Und wie oft haben Sie diesen Satz schon selbst gesagt? Wahrscheinlich nahezu jeden Tag. Dabei stimmt der
Zeitmanagement Allgemeine Einleitung Wie oft haben Sie schon gehört Ich habe leider keine Zeit? Und wie oft haben Sie diesen Satz schon selbst gesagt? Wahrscheinlich nahezu jeden Tag. Dabei stimmt der
Auswertung des Fragebogens zum CO2-Fußabdruck
 Auswertung des Fragebogens zum CO2-Fußabdruck Um Ähnlichkeiten und Unterschiede im CO2-Verbrauch zwischen unseren Ländern zu untersuchen, haben wir eine Online-Umfrage zum CO2- Fußabdruck durchgeführt.
Auswertung des Fragebogens zum CO2-Fußabdruck Um Ähnlichkeiten und Unterschiede im CO2-Verbrauch zwischen unseren Ländern zu untersuchen, haben wir eine Online-Umfrage zum CO2- Fußabdruck durchgeführt.
Newsletter Immobilienrecht Nr. 10 September 2012
 Newsletter Immobilienrecht Nr. 10 September 2012 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Kenntnis des Käufers von einem Mangel der Kaufsache bei getrennt beurkundetem Grundstückskaufvertrag Einführung Grundstückskaufverträge
Newsletter Immobilienrecht Nr. 10 September 2012 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Kenntnis des Käufers von einem Mangel der Kaufsache bei getrennt beurkundetem Grundstückskaufvertrag Einführung Grundstückskaufverträge
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016
 L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
Wachstum 2. Michael Dröttboom 1 LernWerkstatt-Selm.de
 1. Herr Meier bekommt nach 3 Jahren Geldanlage 25.000. Er hatte 22.500 angelegt. Wie hoch war der Zinssatz? 2. Herr Meiers Vorfahren haben bei der Gründung Roms (753. V. Chr.) 1 Sesterze auf die Bank gebracht
1. Herr Meier bekommt nach 3 Jahren Geldanlage 25.000. Er hatte 22.500 angelegt. Wie hoch war der Zinssatz? 2. Herr Meiers Vorfahren haben bei der Gründung Roms (753. V. Chr.) 1 Sesterze auf die Bank gebracht
Projektive Verfahren in der. Bewertung aus Sicht der Befragten
 Projektive Verfahren in der Online-Marktforschung Bewertung aus Sicht der Befragten Oktober 2012 Problemhintergrund Die Online-Marktforschung ist für ihre schnelle und kostengünstige Abwicklung bekannt
Projektive Verfahren in der Online-Marktforschung Bewertung aus Sicht der Befragten Oktober 2012 Problemhintergrund Die Online-Marktforschung ist für ihre schnelle und kostengünstige Abwicklung bekannt
England vor 3000 Jahren aus: Abenteuer Zeitreise Geschichte einer Stadt. Meyers Lexikonverlag.
 An den Ufern eines Flusses haben sich Bauern angesiedelt. Die Stelle eignet sich gut dafür, denn der Boden ist fest und trocken und liegt etwas höher als das sumpfige Land weiter flussaufwärts. In der
An den Ufern eines Flusses haben sich Bauern angesiedelt. Die Stelle eignet sich gut dafür, denn der Boden ist fest und trocken und liegt etwas höher als das sumpfige Land weiter flussaufwärts. In der
Studie Windkraft und Tourismus 2003 bis 2009
 Studie Windkraft und Tourismus 2003 bis 2009 Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragungen entwickelt und durchgeführt vom: SOKO Institut Ritterstraße 19 33602 Bielefeld Dr. Henry Puhe 0521 /
Studie Windkraft und Tourismus 2003 bis 2009 Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragungen entwickelt und durchgeführt vom: SOKO Institut Ritterstraße 19 33602 Bielefeld Dr. Henry Puhe 0521 /
Bundesverband Flachglas Großhandel Isolierglasherstellung Veredlung e.v. U g -Werte-Tabellen nach DIN EN 673. Flachglasbranche.
 Bundesverband Flachglas Großhandel Isolierglasherstellung Veredlung e.v. U g -Werte-Tabellen nach DIN EN 673 Ug-Werte für die Flachglasbranche Einleitung Die vorliegende Broschüre enthält die Werte für
Bundesverband Flachglas Großhandel Isolierglasherstellung Veredlung e.v. U g -Werte-Tabellen nach DIN EN 673 Ug-Werte für die Flachglasbranche Einleitung Die vorliegende Broschüre enthält die Werte für
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen!
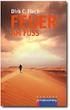 Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Umsatz-Kosten-Treiber-Matrix. 2015 Woodmark Consulting AG
 Umsatz-Kosten-Treiber-Matrix Die Alpha GmbH ist ein Beratungsunternehmen mit 43 Mitarbeitern. Der Umsatz wird zu 75% aus IT-Beratung bei Kunden vor Ort und vom Betrieb von IT-Applikationen erwirtschaftet.
Umsatz-Kosten-Treiber-Matrix Die Alpha GmbH ist ein Beratungsunternehmen mit 43 Mitarbeitern. Der Umsatz wird zu 75% aus IT-Beratung bei Kunden vor Ort und vom Betrieb von IT-Applikationen erwirtschaftet.
Anleitung über den Umgang mit Schildern
 Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Gutachten. Anton Spiegel. Dornbirn, xxx. Bodenlegermeister
 xxx xxx xx Dornbirn, xxx Gutachten Auftraggeber: Firma xxx GesmbH, xx Projekt: Wohnanlage xxx xxx Bauträger GmbH, xxx Auftrag: Besichtigung und Beurteilung der Laminatböden Besichtigung und Begutachtung:
xxx xxx xx Dornbirn, xxx Gutachten Auftraggeber: Firma xxx GesmbH, xx Projekt: Wohnanlage xxx xxx Bauträger GmbH, xxx Auftrag: Besichtigung und Beurteilung der Laminatböden Besichtigung und Begutachtung:
Eigenen Farbverlauf erstellen
 Diese Serie ist an totale Neulinge gerichtet. Neu bei PhotoLine, evtl. sogar komplett neu, was Bildbearbeitung betrifft. So versuche ich, hier alles einfach zu halten. Ich habe sogar PhotoLine ein zweites
Diese Serie ist an totale Neulinge gerichtet. Neu bei PhotoLine, evtl. sogar komplett neu, was Bildbearbeitung betrifft. So versuche ich, hier alles einfach zu halten. Ich habe sogar PhotoLine ein zweites
Schülervorstellungen und Konsequenzen für den Unterricht. V.-Prof. Dr. Martin Hopf Österr. Kompetenzzentrum für Didaktik der Physik
 Schülervorstellungen und Konsequenzen für den Unterricht V.-Prof. Dr. Martin Hopf Österr. Kompetenzzentrum für Didaktik der Physik Ablauf Konstruktivismus Schülervorstellungen in der Physik Konsequenzen
Schülervorstellungen und Konsequenzen für den Unterricht V.-Prof. Dr. Martin Hopf Österr. Kompetenzzentrum für Didaktik der Physik Ablauf Konstruktivismus Schülervorstellungen in der Physik Konsequenzen
SICHERN DER FAVORITEN
 Seite 1 von 7 SICHERN DER FAVORITEN Eine Anleitung zum Sichern der eigenen Favoriten zur Verfügung gestellt durch: ZID Dezentrale Systeme März 2010 Seite 2 von 7 Für die Datensicherheit ist bekanntlich
Seite 1 von 7 SICHERN DER FAVORITEN Eine Anleitung zum Sichern der eigenen Favoriten zur Verfügung gestellt durch: ZID Dezentrale Systeme März 2010 Seite 2 von 7 Für die Datensicherheit ist bekanntlich
Was meinen die Leute eigentlich mit: Grexit?
 Was meinen die Leute eigentlich mit: Grexit? Grexit sind eigentlich 2 Wörter. 1. Griechenland 2. Exit Exit ist ein englisches Wort. Es bedeutet: Ausgang. Aber was haben diese 2 Sachen mit-einander zu tun?
Was meinen die Leute eigentlich mit: Grexit? Grexit sind eigentlich 2 Wörter. 1. Griechenland 2. Exit Exit ist ein englisches Wort. Es bedeutet: Ausgang. Aber was haben diese 2 Sachen mit-einander zu tun?
