Weidemanagement 2006
|
|
|
- Jan Knopp
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Weidemanagement 2006 Dr. Clara Berendonk, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau - Elsenpass 5, Kleve Tel.: , Fax: clara.berendonk@lwk.nrw.de, Internet:
2 Futterqualität auf der Weide optimieren Dr. Clara Berendonk, Landwirtschaftszentrum Haus Riswick Die Vorzüge der Weidewirtschaft sind unbestritten. Das Wohlbefinden der Kühe, die arbeitswirtschaftlichen Vorteile, der geringere Gülleanfall und die geringeren Futterkosten sind wichtige Gründe, die für die Weidenutzung des Grünlandes sprechen. Dennoch sind den Möglichkeiten zur Weidenutzung Grenzen gesetzt: Beweidung ist nur bei ausreichender Flächenarrondierung und gleichmäßigem Futterzuwachs möglich. Leichte Standorte mit anhaltender Sommertrockenheit bieten weniger günstige Bedingungen. Die Hauptursache, weshalb die Weidehaltung heute jedoch nur noch eine nachrangige Rolle spielt, liegt in den gestiegenen Anforderungen der Hochleistungskuh an die Futterration begründet. Der hohe Nährstoffbedarf, die notwendige Beifütterung zum Ausgleich von Proteinüberschuss und Strukturmangel auf der Weide erfordern höhere Zufuttermengen und bewirken automatisch längere Stallhaltungsperioden und damit kürzere tägliche Beweidungszeiten. Mit zunehmender Milchleistung sinkt somit die mögliche tägliche Beweidungszeit bis hin zur stundenweisen Siesta-Beweidung. Die Dauer der täglichen Weidezeit hängt daher wesentlich von der Höhe der Milchleistung ab (Übersicht 1). In der Praxis wird allerdings das Leistungspotential der Weide oft nicht ausgeschöpft. Zahlreiche Untersuchungen intensiv genutzter Weideflächen der vergangenen Jahre belegen, dass unter Weidenutzung während der gesamten Vegetationsperiode Energiekonzentrationen von mindestens 6,4 MJ NEL/kg Trockenmasse realisiert werden können, ein wesentlicher Vorteil der Weide, denn unter Schnittnutzung sind in der zweiten Vegetationshälfte bei ungünstiger Witterungskonstellation manchmal 6 MJ NEL/kg TM nur schwer zu erreichen. Dieser Aspekt gewinnt besonders bei steigender Milchleistung wegen einer begrenzten Futteraufnahmekapazität der Tiere an Bedeutung. Am konstantesten ist die Futterqualität bei Standweidenutzung, vorausgesetzt die Beweidung erfolgt mit einer dem Zuwachs angepassten Intensität. Milchleistung Übersicht 1: Tägliche Weidezeiten und Weidefutterbedarf in Abhängigkeit von der Milchleistung Weidezeit kg/kuh/jahr kg TM/Kuh/Tag Stunden/Tag kg TM/Kuh/Tag Täglicher Futterbedarf bzw. erforderliche Futterproduktion im Sommer (bei 25 % Beweidungsverlusten) dt TM/Kuh/ Weideperiode (180 Tage) Ganztags Halbtags bis zu 2 Kurztags (stundenweise) Grünlandfutteraufnahme Weidenutzungssystem Sommerstallfütterung (mit Auslauf) bis zu Standweide oder Umtriebsweide? Grundsätzlich ist die Weidenutzung des Grünlandes unter den Standortbedingungen von NRW als Umtriebsweide oder Standweide möglich. In der Ertragsleistung und damit im
3 Flächenbedarf besteht kein Unterschied zwischen beiden Weidenutzungsformen. In den meisten Betrieben hat sich aber aus arbeitswirtschaftlichen Gründen die Standweidehaltung durchgesetzt. Lediglich auf Standorten mit unzureichender Arrondierung wird der Umtriebsweide der Vorzug gegeben. Je nach angestrebter Weidezeit, Ganztags-, Halbtagsoder Stundenbeweidung, muss die Flächenzuteilung aber entsprechend geplant werden. Sowohl bei Ganztagsbeweidung als auch bei stundenweisem Weidegang ist eine hohe Energiekonzentration des Weideaufwuchses unumgänglich, um eine hohe Grundfutterleistung zu erzielen und entsprechend Kraftfutter einsparen zu können. Bei der Umtriebsweide gilt auch heute noch die alte Regel kurze Fresszeiten, lange Ruhezeiten. Optimal ist, wenn die zugeteilten Flächen innerhalb von 3 Tagen abgeweidet werden können und anschließend eine Ruhezeiten von ca. 4 Wochen folgt, was mit einer Unterteilung der Grünlandfläche in 9-10 Koppeln sicher zu gewährleisten ist. Diese Unterteilung erübrigt sich bei der Standweidenutzung. Die Flächenanpassung bei Standweidenutzung ist daher wesentlich kostengünstiger über einen mobilen E-Zaun möglich. Beweidung mit angepasster Besatzdichte Erfolgreiches Standweidemanagement setzt allerdings voraus, dass bereits vor dem Auftrieb ein Plan für die Flächenzuteilung während der Vegetationsperiode erstellt wird, der den standortspezifischen witterungsabhängigen Zuwachsverlauf auf dem Grünland berücksichtigt. Die Besatzdichte muss während der gesamten Vegetationsperiode konsequent an das Futterangebot der Weide angepasst wird. Dadurch lässt sich sicherstellen, dass die Tiere stets Futter in gleichbleibend hoher Qualität angeboten bekommen. In Übersicht 2 sind diese Zusammenhänge zwischen dem täglichen Futterzuwachs als Futterangebot und dem täglichen Futterbedarf und der Besatzdichte andererseits verdeutlicht. Übersicht 2: Besatzdichte auf Weideflächen in Abhängigkeit vom Futterbedarf und Futterangebot bei mittleren Tageszuwachsraten kg Futterbedarf/Kuh/Tag 12 kg Futterbedarf/Kuh/Tag 6 kg Futterbedarf/Kuh/Tag 3 kg Futterbedarf/Kuh/Tag Besatzdichte: Kühe/ha (April-Mitte Mai) Futterzuwachs: kg TM/Tag/ha 75 (Mitte Mai-Ende Juni 55 (Juli - August) 30 (September - Oktober) Als grobe Faustzahl kann man mit einem Bruttobedarf auf der Weide von 1 kg TM/Kuh/Stunde Weidezeit kalkulieren. Auf Flächen mit mittleren Zuwachsraten von 75 kg Trockenmasse/Tag von Mitte Mai bis Ende Juni ergibt sich für die Ganztagsweide bei einem Bruttobedarf von 20 kg TM/Kuh/Tag eine Besatzdichte von 3,75 Kühen, für die
4 Halbtagsweide bei einem Bedarf von 12 kg TM/Kuh/Tag eine Besatzdichte von 6,25 Kühe und für die Kurztagsweide bei einem Bedarf von 6 kg TM/Kuh/Tag eine Besatzdichte von 12,5 Kühe. Bei überwiegender Stallfütterung mit nur stundenweiser Beweidung als Auslauf und etwa 3 kg Futteraufnahme können 25 Kühe je ha aufgetrieben werden. Bei nachlassendem Futterzuwachs in den späteren Abschnitten der Vegetationsperiode muss die Besatzdichte sukzessive reduziert werden, d. h. bei gleichbleibender Tierzahl muss zum Herbst hin mehr Fläche zugeteilt werden oder muss die tägliche Weidezeit weiter reduziert werden, damit die Tiere mehr Futter im Stall aufnehmen können. Aufwuchskontrolle der Standweide durch Wuchshöhenmessung Bei optimaler Weideführung soll die Weide konstant eine durchschnittliche Aufwuchshöhe von 7 cm nicht überschreiten, d. h. die Weidefläche muss sehr scharf beweidet werden. Die Flächengröße ist vor allem im Frühjahr knapp zu bemessen, weil die Bestände sonst aufgrund des sehr starken Futterzuwachses bei großzügiger Flächenzuteilung unweigerlich überständig werden und die Geilstellen dann zunehmend von den Tieren gemieden werden. Abgesehen davon, dass an solchen Stellen die Ausdauer und Regeneration der wertvollen Gräser, insbesondere des Deutschen Weidelgrases beeinträchtigt wird, kann das hohe Energiepotential der Weide während der folgenden Vegetationsperiode nicht mehr realisiert werden. Messung der Aufwuchshöhe mit dem Zollstock Messung der Aufwuchshöhe mit Messscheibe Um den Blick für die optimale Beweidungsintensität zu schulen, hat sich die regelmäßige Wuchshöhenmessung mit Zollstock oder Spezialmessgerät bewährt (siehe Photos). Die Messung ist quer verteilt über die Fläche an ca. 40 Stellen zu wiederholen. Dr. Peter Thomet von der Schweizer Hochschule in Zollikofen empfiehlt es, die Ergebnisse in einem Raster wie in Übersicht 3 dargestellt einzutragen. Für jede Messung ist in dem Raster zu der gemessenen Wuchshöhe ein Kreuz einzuzeichnen und die mittlere Aufwuchhöhe zu berechnen. Optimal ist der Aufwuchs, wenn sich alle Messwerte eng um den Mittelwert scharen. Bei regelmäßiger Aufzeichnung ist diese Maßnahme ein sehr wirkungsvolles Steuerungsinstrument für die Flächenzuteilung, mit der über die gesamte Vegetationsperiode ein leistungsfähiger Weideaufwuchs mit maximaler Futterqualität sichergestellt werden kann.
5
6 Reine Weidenutzung oder Mähweidenutzung? Ausschließliche Weidenutzung der Grünlandflächen wird höchstens auf den stallnahen Flächen oder Flächen, die keine Mahd zulassen, praktiziert. Mähweidenutzung ist meist unumgänglich, um Futterüberschüsse abzuschöpfen bzw. um Winterfutter zu gewinnen. Ein optimaler Pflanzenbestand für die Weidenutzung besteht zum überwiegenden Teil aus Deutschem Weidelgras, Wiesenrispe und auch etwas Weißklee. Diese Arten sind in der Lage, sich bei häufigem Verbiss intensiv zu bestocken und liefern dadurch eine besonders dichte und leistungsfähige Weidenarbe. Bei Schnittnutzung werden diese Untergräser aber von hochwachsenden Grünlandarten stärker überschattet und bestocken sich kaum. Die Obergräser bilden von Natur aus eine lockerere Narbe. Dieser Effekt der Narbenauflockerung ist bereits gegeben, wenn der erste Aufwuchs regelmäßig gemäht wird. Selbst frühe Mahd kann den Effekt einer frühzeitigen Beweidung im 1. Aufwuchs nicht ersetzen. Daher ist es zweckmäßig, dass die Flächen, die im 1. Aufwuchs gemäht werden stets mit den Flächen, die geweidet werden wechseln. In Betrieben mit nur stundenweiser Beweidung ist der Flächenbedarf für die Beweidung erheblich geringer als beispielsweise bei Ganztags- oder auch Halbtagsweide. Häufig werden die Tiere erst nach dem 1. Schnitt aufgetrieben, weil das Futter im Mai zu rasch altert. Die Tiere sind dann nur noch 3-4 Monate stundenweise auf Weide und nehmen oft nur noch 10 bis 20 % des Grünlandaufwuchses durch Weidenutzung auf. Der Rest wird als Silage gewonnen. Solche Pflanzenbestände sind nur schwer zu steuern. Die Narbenauflockerung führt dazu, dass rasch auch unerwünschte Pflanzenarten einwandern. Der Erhalt des Weidelgrases ist bei dieser Nutzung in der Mähweide nur durch permanente Nachsaat (Qualitätsstandardmischung GV) zu gewährleisten. Diese ist jedoch erforderlich, weil das Weidelgras von den ansaatwürdigen Arten auch für die Silagegewinnung die beste Futterqualität aufweist. Pflege der Weidenarbe Beweidung mit angepasster Besatzdichte ist die wichtigste Maßnahme der Weidepflege, um die Grünlandnarbe permanent in der Bestockung zu fördern und dicht zu halten. Sowohl Beweidung mit zu hoher Besatzdichte als auch Unterbeweidung und überständige Geilstellen führen zu lückiger Narbe. Beides schafft Eintrittspforten für wertlose Grünlandpflanzen und senkt dadurch die Futterqualität. Sowohl bei etwas lückigen Beständen, aber auch zur vorbeugenden Qualitätssicherung der Grünlandnarbe bietet es sich nach dem 1. Schnitt an, mit ca. 5 kg Qualitätsstandardmischung GV leistungsfähige Sorten als Übersaat in die Fläche zu bringen. Auch bei sorgfältiger Weideführung sind kleinere Narbenschäden nie auszuschließen, umso wichtiger ist es, dass stets keimfähige Samen leistungsfähiger Gräser in der Narbe verfügbar sind, um entstehende Lücken rasch zu schließen und das Einwandern unerwünschter Pflanzenarten zu verhindern. Regelmäßige Übersaat ist daher als Ergänzung zu guter Weideführung ein voraus schauende Maßnahme, die Leistungsfähigkeit der Grünlandnarbe nachhaltig zu sichern. Als Standardmaßnahme guter Weideführung muss aber auch die frühzeitige Nachmahd von Geilstellen verstanden werden. Das überalterte Futter in den Geilstellen führt nicht nur im aktuellen Aufwuchs zu minderwertiger Futterqualität, sondern es verhindert zusätzlich die Bestockung der wertvollen Untergräser, insbesondere des Deutschen Weidelgrases sowie die Ausbreitung von Weißklee und verursacht auf diese Weise langfristig eine Veränderung der Pflanzenbestandszusammensetzung hin zu leistungsschwächeren Pflanzengesellschaften.
Effiziente Weideführung anstreben
 Effiziente Weideführung anstreben Bearbeitung: Anne Verhoeven und Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau
Effiziente Weideführung anstreben Bearbeitung: Anne Verhoeven und Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau
Narbenpflege und Grünlandverbesserung bei Weide- und Schnittnutzung 2006
 Narbenpflege und Grünlandverbesserung bei Weide- und Schnittnutzung 2006 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland
Narbenpflege und Grünlandverbesserung bei Weide- und Schnittnutzung 2006 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland
Kurzrasenweide braucht System
 Kurzrasenweide braucht System (Anne Verhoeven und Dr. Clara Berendonk, Versuchs- und Bildungszentrum Haus Riswick) Für eine optimale, verlustarme und effiziente Futterproduktion müssen Weiden während der
Kurzrasenweide braucht System (Anne Verhoeven und Dr. Clara Berendonk, Versuchs- und Bildungszentrum Haus Riswick) Für eine optimale, verlustarme und effiziente Futterproduktion müssen Weiden während der
Weidemanagement mit Schafen 2006
 Weidemanagement mit Schafen 2006 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau - Elsenpaß 5, 47533
Weidemanagement mit Schafen 2006 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau - Elsenpaß 5, 47533
Berechnung der Weideleistung
 Berechnung der Weideleistung Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk und Anne Verhoeven Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick Elsenpaß 5, 47533 Kleve
Berechnung der Weideleistung Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk und Anne Verhoeven Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick Elsenpaß 5, 47533 Kleve
Hinweise zur Ermittlung der Schnittreife im 1. Aufwuchs 2011 von Dauergrünland und Ackergras
 Hinweise zur Ermittlung der Schnittreife im. Aufwuchs 20 von Dauergrünland und Ackergras Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick -
Hinweise zur Ermittlung der Schnittreife im. Aufwuchs 20 von Dauergrünland und Ackergras Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick -
- 15 Jahre Reifeprüfung in NRW - Hinweise zur Ermittlung der Schnittreife im 1. Aufwuchs 2010 von Dauergrünland und Ackergras
 - 15 Jahre Reifeprüfung in NRW - Hinweise zur Ermittlung der Schnittreife im 1. Aufwuchs 21 von Dauergrünland und Ackergras Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum
- 15 Jahre Reifeprüfung in NRW - Hinweise zur Ermittlung der Schnittreife im 1. Aufwuchs 21 von Dauergrünland und Ackergras Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum
Weidehaltung Mehr als eine Alternative!!!
 Weidehaltung Mehr als eine Alternative!!! Johann Häusler Warum Weidehaltung? Weidehaltung entspricht dem natürlichen Verhalten der Wiederkäuer (Rinder sind Steppentiere) die Tiere haben automatisch genügend
Weidehaltung Mehr als eine Alternative!!! Johann Häusler Warum Weidehaltung? Weidehaltung entspricht dem natürlichen Verhalten der Wiederkäuer (Rinder sind Steppentiere) die Tiere haben automatisch genügend
Spitzenqualität nur bei frühem Schnitt Hinweise zur Ermittlung der Schnittreife im 1. Aufwuchs von Dauergrünland und Feldfutter 2006
 Spitzenqualität nur bei frühem Schnitt Hinweise zur Ermittlung der Schnittreife im. Aufwuchs von Dauergrünland und Feldfutter 2006 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Spitzenqualität nur bei frühem Schnitt Hinweise zur Ermittlung der Schnittreife im. Aufwuchs von Dauergrünland und Feldfutter 2006 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Material und Methoden. Ergebnisse
 Optimierung der Weide- und Tierleistung bei begrenzter Weidefläche im System Kurzrasenweide Anne Verhoeven, Dr. Sebastian Hoppe und Dr. Martin Pries, LK NRW, VBZL Haus Riswick In den meisten Praxisbetrieben
Optimierung der Weide- und Tierleistung bei begrenzter Weidefläche im System Kurzrasenweide Anne Verhoeven, Dr. Sebastian Hoppe und Dr. Martin Pries, LK NRW, VBZL Haus Riswick In den meisten Praxisbetrieben
Stickstoffdüngungsempfehlung für das Dauergrünland 2008
 Stickstoffdüngungsempfehlung für das Dauergrünland 2008 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau
Stickstoffdüngungsempfehlung für das Dauergrünland 2008 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau
Kurzrasenweide für Jungrinder?
 Kurzrasenweide für Jungrinder? 2-jährige Ergebnisse und Erfahrungen im Ökobetrieb Haus Riswick Anne Verhoeven, Dr. Clara Berendonk und Dr. Martin Pries, Landwirtschaftskammer NRW, Versuchs- und Bildungszentrum
Kurzrasenweide für Jungrinder? 2-jährige Ergebnisse und Erfahrungen im Ökobetrieb Haus Riswick Anne Verhoeven, Dr. Clara Berendonk und Dr. Martin Pries, Landwirtschaftskammer NRW, Versuchs- und Bildungszentrum
Kurzrasenweide - der Weideprofi misst seinen Grasaufwuchs
 1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Prof.-Dürrwaechter-Platz 3, 85586 Poing Grub Siegfried Steinberger 089 / 99 141 416 Petra Rauch 089 / 99 141-419
1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Prof.-Dürrwaechter-Platz 3, 85586 Poing Grub Siegfried Steinberger 089 / 99 141 416 Petra Rauch 089 / 99 141-419
COUNTRY Horse Pferdegreen
 COUNTRY Horse 2117 - Pferdegreen Mischung für stark beanspruchte n und Ausläufe. Pferdegreen ist die Grundlage für saftig grüne Weiden mit gesundem Futter. Das ist auch dort möglich, wo die Grasnarbe durch
COUNTRY Horse 2117 - Pferdegreen Mischung für stark beanspruchte n und Ausläufe. Pferdegreen ist die Grundlage für saftig grüne Weiden mit gesundem Futter. Das ist auch dort möglich, wo die Grasnarbe durch
Grundlagen der Weidehaltung
 Grundlagen der Weidehaltung Workshop Weidenutzung ÖKL, St. Urban DI Lehr- und Forschungszentrum (LFZ) für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein Abteilung für Biologische Grünland- und Viehwirtschaft Raumberg
Grundlagen der Weidehaltung Workshop Weidenutzung ÖKL, St. Urban DI Lehr- und Forschungszentrum (LFZ) für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein Abteilung für Biologische Grünland- und Viehwirtschaft Raumberg
Grünlandwirtschaft mit Schafen 2008
 Grünlandwirtschaft mit Schafen 2008 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau - Elsenpaß 5, 47533
Grünlandwirtschaft mit Schafen 2008 Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau - Elsenpaß 5, 47533
Herzlich Willkommen zur Internationalen Schaf- und Ziegentagung in Österreich!
 Herzlich Willkommen zur Internationalen Schaf- und Ziegentagung in Österreich! www.bioland.de Internationale Schaf- und Ziegentagung 2013, Andreas Kern 1 Weidemanagement Worauf kommt es an? Andreas Kern,
Herzlich Willkommen zur Internationalen Schaf- und Ziegentagung in Österreich! www.bioland.de Internationale Schaf- und Ziegentagung 2013, Andreas Kern 1 Weidemanagement Worauf kommt es an? Andreas Kern,
Tipps zur Weidehaltung
 Tipps zur Weidehaltung Johann Häusler, Raumberg-Gumpenstein johann.haeusler@raumberg-gumpenstein.at www.raumberg-gumpenstein.at Lehre Forschung Zukunft - Unsere Verantwortung Richtiges Weidemanagement
Tipps zur Weidehaltung Johann Häusler, Raumberg-Gumpenstein johann.haeusler@raumberg-gumpenstein.at www.raumberg-gumpenstein.at Lehre Forschung Zukunft - Unsere Verantwortung Richtiges Weidemanagement
Thema des Vortrages: Weidenutzung und Dauergrünland
 Seminar 06. Juli 2012 in Manderfeld Thema des Vortrages: Weidenutzung und Dauergrünland Dr. E. Leisen, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 1 Falsche Themenwahl? Wirtschaftlichkeit von Weidegang Ist
Seminar 06. Juli 2012 in Manderfeld Thema des Vortrages: Weidenutzung und Dauergrünland Dr. E. Leisen, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 1 Falsche Themenwahl? Wirtschaftlichkeit von Weidegang Ist
COUNTRY Grünland 2001 Nachsaat Normallage
 COUNTRY Grünland 2001 Nachsaat Normallage Leistungsstarke Nachsaatmischung für frische bis wechselfeuchte Lagen, besonders gut geeignet für intensive Bewirtschaftung. Die schnelle Jugendentwicklung und
COUNTRY Grünland 2001 Nachsaat Normallage Leistungsstarke Nachsaatmischung für frische bis wechselfeuchte Lagen, besonders gut geeignet für intensive Bewirtschaftung. Die schnelle Jugendentwicklung und
Optimierung der Weideleistung Viel Milch aus Weidegras!
 Optimierung der Weideleistung Viel Milch aus Weidegras! Dr. Clara Berendonk, Anne Verhoeven, Ingo Dünnebacke Leistungsreserven der Weide mobilisieren! Produktionskosten spezialisierter Milchviehbetriebe
Optimierung der Weideleistung Viel Milch aus Weidegras! Dr. Clara Berendonk, Anne Verhoeven, Ingo Dünnebacke Leistungsreserven der Weide mobilisieren! Produktionskosten spezialisierter Milchviehbetriebe
Futterqualität und Ertrag von extensiv bewirtschaftetem Grünland
 Futterqualität und Ertrag von extensiv bewirtschaftetem Grünland Dr. Frank Hertwig und Dr. Reinhard Priebe Brandenburg Referat 43, Ackerbau und Grünland 14641 Paulinenaue 3.11.29 Anwendungsumfang der Maßnahmen
Futterqualität und Ertrag von extensiv bewirtschaftetem Grünland Dr. Frank Hertwig und Dr. Reinhard Priebe Brandenburg Referat 43, Ackerbau und Grünland 14641 Paulinenaue 3.11.29 Anwendungsumfang der Maßnahmen
Kurzrasenweide. Futtermenge und -qualität durch konstante Aufwuchshöhe sichern. LfL-Information
 Kurzrasenweide Futtermenge und -qualität durch konstante Aufwuchshöhe sichern LfL-Information 2 Was ist eine Kurzrasenweide? Eine Kurzrasenweide wird als Standweide betrieben. Sind mehrere getrennte Weiden
Kurzrasenweide Futtermenge und -qualität durch konstante Aufwuchshöhe sichern LfL-Information 2 Was ist eine Kurzrasenweide? Eine Kurzrasenweide wird als Standweide betrieben. Sind mehrere getrennte Weiden
Hohe Tageszunahmen bei Kälbern und Jungrindern auf der Kurzrasenweide S. Eisenhardt 1, M. Pries 2, C. Berendonk 3, A. Verhoeven 3, S.
 Hohe Tageszunahmen bei Kälbern und Jungrindern auf der Kurzrasenweide S. Eisenhardt 1, M. Pries 2, C. Berendonk 3, A. Verhoeven 3, S. Hoppe 3 1 Fachhochschule Eberswalde 2 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,
Hohe Tageszunahmen bei Kälbern und Jungrindern auf der Kurzrasenweide S. Eisenhardt 1, M. Pries 2, C. Berendonk 3, A. Verhoeven 3, S. Hoppe 3 1 Fachhochschule Eberswalde 2 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,
Graswachstum und Weide. Grundlagen der optimalen Weidenutzung und Weidepflege. Blattlebensdauer und Nutzung. Wuchsform Weide
 C-Nettoproduktion (kumulativ) 20.05.2015 Graswachstum und Weide Grundlagen der optimalen Weidenutzung und Weidepflege Lehrgang Weidemanagement 15.05.2015, Toblach, Südtirol Schnitt- und Weidenutzung haben
C-Nettoproduktion (kumulativ) 20.05.2015 Graswachstum und Weide Grundlagen der optimalen Weidenutzung und Weidepflege Lehrgang Weidemanagement 15.05.2015, Toblach, Südtirol Schnitt- und Weidenutzung haben
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft. Fachbereich 6 Tierische Erzeugung Referat 62 Tierhaltung, Fütterung Köllitsch, Am Park 3
 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich 6 Tierische Erzeugung Referat 62 Tierhaltung, Fütterung 04886 Köllitsch, Am Park 3 Internet: http://www.smul.sachsen.de/lfl Weidefütterung Der Futterwert
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich 6 Tierische Erzeugung Referat 62 Tierhaltung, Fütterung 04886 Köllitsch, Am Park 3 Internet: http://www.smul.sachsen.de/lfl Weidefütterung Der Futterwert
Mit optimaler Weideführung den Ampfer in Schach halten
 1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Prof.-Dürrwaechter-Platz 3, 85586 Poing-Grub Siegfried Steinberger 089/ 99 141 416 November 2010 Mit optimaler
1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Prof.-Dürrwaechter-Platz 3, 85586 Poing-Grub Siegfried Steinberger 089/ 99 141 416 November 2010 Mit optimaler
Weide- und Schnittnutzung im Vergleich
 14.03.2016 Weide- und Schnittnutzung im Vergleich Ergebnisse aus dem FP Einfluss unterschiedlicher Beweidungsformen auf Boden und Pflanzenbestand in der Biologischen Landwirtschaft Laufzeit 2007-2015 Walter
14.03.2016 Weide- und Schnittnutzung im Vergleich Ergebnisse aus dem FP Einfluss unterschiedlicher Beweidungsformen auf Boden und Pflanzenbestand in der Biologischen Landwirtschaft Laufzeit 2007-2015 Walter
Einfluss von tiefem Verbiss bei Kurzrasenweide auf die Flächenproduktivität und Einzelkuhleistung
 Einfluss von tiefem Verbiss bei Kurzrasenweide auf die Flächenproduktivität und Einzelkuhleistung Einleitung Auf Kurzrasenweiden wird die höchste Flächenproduktivität bei einer Wuchshöhe im Fressbereich
Einfluss von tiefem Verbiss bei Kurzrasenweide auf die Flächenproduktivität und Einzelkuhleistung Einleitung Auf Kurzrasenweiden wird die höchste Flächenproduktivität bei einer Wuchshöhe im Fressbereich
Weideleistung durch Kurzrasenweide steigern Weideverluste minimieren Weide effizient nutzen
 Weideleistung durch Kurzrasenweide steigern Weideverluste minimieren Weide effizient nutzen Dr. Martin Pries Dr. Clara Berendonk, Anne Verhoeven Versuch im Ökobetrieb 2009: Einfluss der Zufütterung von
Weideleistung durch Kurzrasenweide steigern Weideverluste minimieren Weide effizient nutzen Dr. Martin Pries Dr. Clara Berendonk, Anne Verhoeven Versuch im Ökobetrieb 2009: Einfluss der Zufütterung von
Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras Aussaat 2006
 Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen Versuchsbericht 2007 Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras Aussaat 2006 Bearbeitung:
Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen Versuchsbericht 2007 Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras Aussaat 2006 Bearbeitung:
LfL Jahrestagung 2016 Anpassung der Beweidung auf Almen/Alpen an den Klimawandel Steinberger Siegfried, LfL Grub
 LfL Jahrestagung 2016 Anpassung der Beweidung auf Almen/Alpen an den Klimawandel Steinberger Siegfried, LfL Grub LfL-Jahrestagung 2016: Chancen und Grenzen der Weide, Siegfried Steinberger, ITE-1 Gliederung
LfL Jahrestagung 2016 Anpassung der Beweidung auf Almen/Alpen an den Klimawandel Steinberger Siegfried, LfL Grub LfL-Jahrestagung 2016: Chancen und Grenzen der Weide, Siegfried Steinberger, ITE-1 Gliederung
LfL Jahrestagung 2016
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft LfL Jahrestagung 2016 Chancen und Grenzen der Weidehaltung in Bayern Prof. Dr. Hubert Spiekers Siegfried Steinberger Peter Weindl, Grub 07/2016 Chancen und Grenzen
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft LfL Jahrestagung 2016 Chancen und Grenzen der Weidehaltung in Bayern Prof. Dr. Hubert Spiekers Siegfried Steinberger Peter Weindl, Grub 07/2016 Chancen und Grenzen
VDLUFA-Schriftenreihe
 VDLUFA-Schriftenreihe 2015 1 Optimierung der Weide- und Tierleistung von Jungrindern im System Kurzrasenweide 2012-2014 S. Eisenhardt 1, M. Pries 2, C. Berendonk 3, A. Verhoeven 3, S. Hoppe 3 1 Fachhochschule
VDLUFA-Schriftenreihe 2015 1 Optimierung der Weide- und Tierleistung von Jungrindern im System Kurzrasenweide 2012-2014 S. Eisenhardt 1, M. Pries 2, C. Berendonk 3, A. Verhoeven 3, S. Hoppe 3 1 Fachhochschule
Saisonales Futterangebot und angepasster Besatz
 Rindviehweide. Saisonales Futterangebot und angepasster Besatz Eric Mosimann, Changins Also, ist die Koppel weidebereit? Vorteile Weiden bietet Vorteile in folgender Hinsicht: Futterrationskosten, Umweltschutz,
Rindviehweide. Saisonales Futterangebot und angepasster Besatz Eric Mosimann, Changins Also, ist die Koppel weidebereit? Vorteile Weiden bietet Vorteile in folgender Hinsicht: Futterrationskosten, Umweltschutz,
Weidesysteme und Weidemanagement. Johann Häusler Institut für Nutztierforschung LFZ Raumberg-Gumpenstein
 Weidesysteme und Weidemanagement Johann Häusler Institut für Nutztierforschung LFZ Raumberg-Gumpenstein Weidesysteme Voraussetzungen für optimale Weidehaltung Weidefähige Flächen und Pflanzenbestand (ev.
Weidesysteme und Weidemanagement Johann Häusler Institut für Nutztierforschung LFZ Raumberg-Gumpenstein Weidesysteme Voraussetzungen für optimale Weidehaltung Weidefähige Flächen und Pflanzenbestand (ev.
Weidehaltung und Weidemanagement bei Kälbern, Rindern und Milchvieh Bioland-Wintertagung 2018
 Weidehaltung und Weidemanagement bei Kälbern, Rindern und Milchvieh Bioland-Wintertagung 2018 Dr. E. Leisen, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 1 Schwerpunkte des Vortrages 1. Wirtschaftlichkeit
Weidehaltung und Weidemanagement bei Kälbern, Rindern und Milchvieh Bioland-Wintertagung 2018 Dr. E. Leisen, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 1 Schwerpunkte des Vortrages 1. Wirtschaftlichkeit
Vollweidesysteme in der Milchviehhaltung
 ALB Winterprogramm 2009/2010 Eichhof 18. November 2009 Vollweidesysteme in der Milchviehhaltung Ökonomische Eigenschaften des Grünlandes Flächenmäßig bedeutsamste Kulturart mit ca. 33 % der LF in i.d.r.
ALB Winterprogramm 2009/2010 Eichhof 18. November 2009 Vollweidesysteme in der Milchviehhaltung Ökonomische Eigenschaften des Grünlandes Flächenmäßig bedeutsamste Kulturart mit ca. 33 % der LF in i.d.r.
BIOGAS DÜNGER BLATTDÜNGER SAATGUT FARMHYGIENE PFLANZENSCHUTZ AGRARKUNSTSTOFFE PROFI GRÄSERMISCHUNGEN
 BIOGAS DÜNGER BLATTDÜNGER SAATGUT FARMHYGIENE PFLANZENSCHUTZ AGRARKUNSTSTOFFE PROFI GRÄSERMISCHUNGEN Empfehlungen für Grünland und Ackerfutter 2017 PROFI Weide mit Klee Kleehaltige Mähweidemischung für
BIOGAS DÜNGER BLATTDÜNGER SAATGUT FARMHYGIENE PFLANZENSCHUTZ AGRARKUNSTSTOFFE PROFI GRÄSERMISCHUNGEN Empfehlungen für Grünland und Ackerfutter 2017 PROFI Weide mit Klee Kleehaltige Mähweidemischung für
Fütterung und Leistung Vorstellung der Weideversuchsergebnisse 2009 und 2010
 Fütterung und Leistung Vorstellung der Weideversuchsergebnisse 2009 und 2010 Dr. Martin Pries, Anne Verhoeven, Dr. Clara Berendonk, LK NRW In den Weideperioden 2009 und 2010 wurden auf den hofnahen Grünlandflächen
Fütterung und Leistung Vorstellung der Weideversuchsergebnisse 2009 und 2010 Dr. Martin Pries, Anne Verhoeven, Dr. Clara Berendonk, LK NRW In den Weideperioden 2009 und 2010 wurden auf den hofnahen Grünlandflächen
Saatstärke in kg/ha 40
 Gräsermischungen Öko 2016 Dauerwiesen: Die Auswahl der richtigen Mischung ist bei einer Neuansaat das Wichtigste. Jedoch ist Dauerwiese nicht gleich Dauerwiese, denn: - die Arten- und Sortenzusammensetzung
Gräsermischungen Öko 2016 Dauerwiesen: Die Auswahl der richtigen Mischung ist bei einer Neuansaat das Wichtigste. Jedoch ist Dauerwiese nicht gleich Dauerwiese, denn: - die Arten- und Sortenzusammensetzung
Veränderungen von Wasseraufnahme in der Weide- und Stallperiode bei Milchkühen, abgeleitet aus Pansentemperatur
 Veränderungen von Wasseraufnahme in der Weide- und Stallperiode bei Milchkühen, abgeleitet aus Pansentemperatur Fragestellung Welchen Einfluss haben Milchleistung, Fütterung und Witterung auf die Wasseraufnahme?
Veränderungen von Wasseraufnahme in der Weide- und Stallperiode bei Milchkühen, abgeleitet aus Pansentemperatur Fragestellung Welchen Einfluss haben Milchleistung, Fütterung und Witterung auf die Wasseraufnahme?
O. Huguenin-Elie, S. Husse, I. Morel und A. Lüscher
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Agroscope N-Effizienz der Futterproduktion auf der Weide O. Huguenin-Elie, S. Husse, I. Morel und A. Lüscher 1. Oktober 2014 www.agroscope.ch
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Agroscope N-Effizienz der Futterproduktion auf der Weide O. Huguenin-Elie, S. Husse, I. Morel und A. Lüscher 1. Oktober 2014 www.agroscope.ch
Wie und woran erkennen wir Futterqualitäten beim Heu
 6. Österreichische Pferdefachtagung Wie und woran erkennen wir Futterqualitäten beim Heu von HBLFA Raumberg-Gumpenstein Aigen/Ennstal, 04. März 2017 raumberg-gumpenstein.at Grünlandflächen in Österreich
6. Österreichische Pferdefachtagung Wie und woran erkennen wir Futterqualitäten beim Heu von HBLFA Raumberg-Gumpenstein Aigen/Ennstal, 04. März 2017 raumberg-gumpenstein.at Grünlandflächen in Österreich
Futterqualität und Management von Pferdeweiden
 Futterqualität und Management von Pferdeweiden Priv.doz. LD Dr. Martin Elsäßer LVVG Aulendorf Weiden in der Praxis? Warum sind Pferdeweiden oft ein Bild des Jammers? Ansprüche des Pferdes Rohfaserreiches
Futterqualität und Management von Pferdeweiden Priv.doz. LD Dr. Martin Elsäßer LVVG Aulendorf Weiden in der Praxis? Warum sind Pferdeweiden oft ein Bild des Jammers? Ansprüche des Pferdes Rohfaserreiches
Optimale Nutzung von Gras? Warum Weide? Gesetzliche Vorgaben? (CH, Bio) Tiergesundheit. Imagepflege Verbraucherakzeptanz
 Warum Weide? Gesetzliche Vorgaben? (CH, Bio) Tiergesundheit Imagepflege Verbraucherakzeptanz Wie mehr Weidemilch erzeugen? Siegfried Steinberger, LFL, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft; Grub
Warum Weide? Gesetzliche Vorgaben? (CH, Bio) Tiergesundheit Imagepflege Verbraucherakzeptanz Wie mehr Weidemilch erzeugen? Siegfried Steinberger, LFL, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft; Grub
Weidehaltung mehr als eine Alternative!
 Weidehaltung mehr als eine Alternative! Weidehaltung entspricht dem natürlichen Verhalten des Wiederkäuers Die Tiere haben automatisch genügend Auslauf! Junges Weidefutter ist nährstoffreich hohe Energie-
Weidehaltung mehr als eine Alternative! Weidehaltung entspricht dem natürlichen Verhalten des Wiederkäuers Die Tiere haben automatisch genügend Auslauf! Junges Weidefutter ist nährstoffreich hohe Energie-
Ansprüche der Milchviehhaltung an das Grundfutter vom Grünland
 22. Allgäuer Grünlandtag, 11.07.2008 Ansprüche der Milchviehhaltung an das Grundfutter vom Grünland Dr. Hubert Spiekers LfL, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft, Grub Grünland für Milchkühe
22. Allgäuer Grünlandtag, 11.07.2008 Ansprüche der Milchviehhaltung an das Grundfutter vom Grünland Dr. Hubert Spiekers LfL, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft, Grub Grünland für Milchkühe
Weidehaltung von Milchkühen um jeden Preis?
 Weidehaltung von Milchkühen um jeden Preis? Jürgen Müller Harsefeld, 08.02.2018 UNIVERSITÄT ROSTOCK FAKULTÄT AGRAR- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Lehrstuhl f. Grünland- & Futterbauwissenschaften 1 Gliederung
Weidehaltung von Milchkühen um jeden Preis? Jürgen Müller Harsefeld, 08.02.2018 UNIVERSITÄT ROSTOCK FAKULTÄT AGRAR- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Lehrstuhl f. Grünland- & Futterbauwissenschaften 1 Gliederung
Klimawandel auf den Almen
 1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Prof.-Dürrwaechter-Platz 3, 85586 Poing-Grub Siegfried Steinberger 089 99 141 416 Klimawandel auf den Almen
1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Prof.-Dürrwaechter-Platz 3, 85586 Poing-Grub Siegfried Steinberger 089 99 141 416 Klimawandel auf den Almen
Gras- und Kleegrasanbau 2007 zur Futtergewinnung und Biogaserzeugung
 Gras- und Kleegrasanbau 2007 zur Futtergewinnung und Biogaserzeugung Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland
Gras- und Kleegrasanbau 2007 zur Futtergewinnung und Biogaserzeugung Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland
Vergleich von zwei Weidesystemen mit Ziegen Dauerweide (Kurzrasenweide) Koppelweide
 Vergleich von zwei Weidesystemen mit Ziegen Dauerweide (Kurzrasenweide) Koppelweide Dieser Versuch wurde durchgeführt, um die Vorteile, die Zwänge, und die begrenzenden Faktoren zweier Weidesysteme mit
Vergleich von zwei Weidesystemen mit Ziegen Dauerweide (Kurzrasenweide) Koppelweide Dieser Versuch wurde durchgeführt, um die Vorteile, die Zwänge, und die begrenzenden Faktoren zweier Weidesysteme mit
DAS GELD LIEGT AUF DER WIESE
 DAS GELD LIEGT AUF DER WIESE Mehr Milch aus dem Grünland von Dipl.-HLFL-Ing. Josef Galler Das Dauergrünland verfügt über ein enormes Eiweißpotenzial. Auf heimischen Wiesen können 1.000 2.500 kg Rohprotein
DAS GELD LIEGT AUF DER WIESE Mehr Milch aus dem Grünland von Dipl.-HLFL-Ing. Josef Galler Das Dauergrünland verfügt über ein enormes Eiweißpotenzial. Auf heimischen Wiesen können 1.000 2.500 kg Rohprotein
Weidehaltung von Milchkühen um jeden Preis?
 Weidehaltung von Milchkühen um jeden Preis? Jürgen Müller Wittmund, 07.02.2018 UNIVERSITÄT ROSTOCK FAKULTÄT AGRAR- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Lehrstuhl f. Grünland- & Futterbauwissenschaften 1 Gliederung
Weidehaltung von Milchkühen um jeden Preis? Jürgen Müller Wittmund, 07.02.2018 UNIVERSITÄT ROSTOCK FAKULTÄT AGRAR- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Lehrstuhl f. Grünland- & Futterbauwissenschaften 1 Gliederung
BSV. Saaten. Land Green. Dauergrünland. Wiesen & Weiden. Heimische Herkunft! Zweifach ampferfrei getestet! Beratung Service Vertrauen
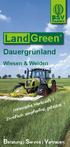 BSV Saaten Land Green Dauergrünland Wiesen & Weiden Heimische Herkunft! Zweifach ampferfrei getestet! Beratung Service Vertrauen Land Green Die kürzeste Verbindung zwischen den neuesten Fortschritten der
BSV Saaten Land Green Dauergrünland Wiesen & Weiden Heimische Herkunft! Zweifach ampferfrei getestet! Beratung Service Vertrauen Land Green Die kürzeste Verbindung zwischen den neuesten Fortschritten der
Bekämpfungsstrategie Jakobskreuzkraut
 Bekämpfungsstrategie Jakobskreuzkraut Dr. Clara Berendonk 7. Riswicker Pferdetag, 05.11.2011 1 Jakobskreuzkraut: Botanik Gefahrenpotential Verbreitungsursachen Bekämpfungsstrategien 2 1 Sämlinge und Rosettenpflanzen
Bekämpfungsstrategie Jakobskreuzkraut Dr. Clara Berendonk 7. Riswicker Pferdetag, 05.11.2011 1 Jakobskreuzkraut: Botanik Gefahrenpotential Verbreitungsursachen Bekämpfungsstrategien 2 1 Sämlinge und Rosettenpflanzen
Mit Weidewirtschaft die Kosten senken
 top Grünland Mit Weidewirtschaft die Kosten senken % 100 Mit der Weidehaltung die Kosten der Milchproduktion senken die Luxemburger prüfen, ob es geht. Fotos: Ising, Moritz (3) Weidefutter ist unschlagbar
top Grünland Mit Weidewirtschaft die Kosten senken % 100 Mit der Weidehaltung die Kosten der Milchproduktion senken die Luxemburger prüfen, ob es geht. Fotos: Ising, Moritz (3) Weidefutter ist unschlagbar
Starkes Nord-Süd-Gefälle beim Graswachstum
 Reifeprüfung Grünland 1. Schnitt 2014 1. Mitteilung Starkes Nord-Süd-Gefälle beim Graswachstum Die Wirtschaftlichkeit der Rindviehhaltung wird ganz wesentlich von der Qualität des Grundfutters bestimmt.
Reifeprüfung Grünland 1. Schnitt 2014 1. Mitteilung Starkes Nord-Süd-Gefälle beim Graswachstum Die Wirtschaftlichkeit der Rindviehhaltung wird ganz wesentlich von der Qualität des Grundfutters bestimmt.
Jakobskreuzkraut - eine ernste Gefahr für die Landwirtschaft - Empfohlene Gegenmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung 2009
 LWZ Haus Riswick Fachbereich Grünland und Futterbau Dr. C. Berendonk Kleve, 23.05.09 Jakobskreuzkraut - eine ernste Gefahr für die Landwirtschaft - Empfohlene Gegenmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung
LWZ Haus Riswick Fachbereich Grünland und Futterbau Dr. C. Berendonk Kleve, 23.05.09 Jakobskreuzkraut - eine ernste Gefahr für die Landwirtschaft - Empfohlene Gegenmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung
Verbesserungspotential im Öko- Grünland?
 Verbesserungspotential im Öko- Grünland? Weniger Kraftfutter - mehr Erfolg? Naturland Milchviehtag Schwaben, Betzigau, 25. November 2016 Walter Starz, Bio-Institut HBLFA Raumberg-Gumpenstein Problemsituation
Verbesserungspotential im Öko- Grünland? Weniger Kraftfutter - mehr Erfolg? Naturland Milchviehtag Schwaben, Betzigau, 25. November 2016 Walter Starz, Bio-Institut HBLFA Raumberg-Gumpenstein Problemsituation
Voraussetzungen Nutzung. Schafe Weiden. Das Schaf als Weidetier Verhalten Bedürfnisse Zäune Weide Systeme geeignete Weidepflanzen
 Schafe Weiden Das Schaf als Weidetier Verhalten Bedürfnisse Zäune Weide Systeme geeignete Weidepflanzen Dieter v. Muralt BBZ Natur und Ernährung Voraussetzungen Nutzung Klima Boden Topographie Exposition
Schafe Weiden Das Schaf als Weidetier Verhalten Bedürfnisse Zäune Weide Systeme geeignete Weidepflanzen Dieter v. Muralt BBZ Natur und Ernährung Voraussetzungen Nutzung Klima Boden Topographie Exposition
Erfolgreiche Mutterkuhhaltung mit Kurzrasenweide
 1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Prof.-Dürrwaechter-Platz 3, 85586 Poing-Grub Siegfried Steinberger 089/ 99 141 416 Erfolgreiche Mutterkuhhaltung
1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Prof.-Dürrwaechter-Platz 3, 85586 Poing-Grub Siegfried Steinberger 089/ 99 141 416 Erfolgreiche Mutterkuhhaltung
Zusammensetzung einer Weidelgrasnarbe in Abhängigkeit von der Frühjahrsnutzung. Futterzuwachs 2007 auf den Projektbetrieben 1 und 4
 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Optimale Grünlandbewirtschaftung Grundlage erfolgreicher Ziegenhaltung Wirkungsgefüge Grünland Ertrag Futterwert Natürliche Faktoren Bewirtschaftung Standort Witterung
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Optimale Grünlandbewirtschaftung Grundlage erfolgreicher Ziegenhaltung Wirkungsgefüge Grünland Ertrag Futterwert Natürliche Faktoren Bewirtschaftung Standort Witterung
Weidenutzung im Berggebiet
 Weidesysteme für den Biobetrieb am Berg Bioland Südtirol Seminar 2016, Ritten am 21. Jänner 2016 Walter Starz, Bio-Institut HBLFA Raumberg-Gumpenstein Weidenutzung im Berggebiet Grundsätze der Weide gelten
Weidesysteme für den Biobetrieb am Berg Bioland Südtirol Seminar 2016, Ritten am 21. Jänner 2016 Walter Starz, Bio-Institut HBLFA Raumberg-Gumpenstein Weidenutzung im Berggebiet Grundsätze der Weide gelten
Ergebnisse zur Ergänzungsfütterung bei Ganztagsweidehaltung von Milchkühen sowie zur Weideaufzucht von Kalbinnen
 Ergebnisse zur Ergänzungsfütterung bei Ganztagsweidehaltung von Milchkühen sowie zur Weideaufzucht von Kalbinnen Johann Häusler LFZ Raumberg-Gumpenstein, Institut für Nutztierwissenschaften Fachtag Mutterkuhhaltung,
Ergebnisse zur Ergänzungsfütterung bei Ganztagsweidehaltung von Milchkühen sowie zur Weideaufzucht von Kalbinnen Johann Häusler LFZ Raumberg-Gumpenstein, Institut für Nutztierwissenschaften Fachtag Mutterkuhhaltung,
Grünland in der Biologischen Landwirtschaft und Biodiversität
 Grünland in der Biologischen Landwirtschaft und Biodiversität Innovations- und Vernetzungsforum Biolandbau HBLA Ursprung, 25. Oktober 2016 Walter Starz, Bio-Institut HBLFA Raumberg-Gumpenstein Besonderheiten
Grünland in der Biologischen Landwirtschaft und Biodiversität Innovations- und Vernetzungsforum Biolandbau HBLA Ursprung, 25. Oktober 2016 Walter Starz, Bio-Institut HBLFA Raumberg-Gumpenstein Besonderheiten
Nutztiersystemmanagement Rind SS 2009. Grünland. Ulrich Thumm, Institut für Pflanzenbau und Grünland (340)
 Nutztiersystemmanagement Rind SS 2009 Grünland Ulrich Thumm, Institut für Pflanzenbau und Grünland (340) Gliederung: 1. Einleitung 2. Probleme in der Bestandesführung am Beispiel Ampfer und Gemeine Rispe
Nutztiersystemmanagement Rind SS 2009 Grünland Ulrich Thumm, Institut für Pflanzenbau und Grünland (340) Gliederung: 1. Einleitung 2. Probleme in der Bestandesführung am Beispiel Ampfer und Gemeine Rispe
Pferde und artenreiche Wiesen. Nachhaltige Wiesenwirtschaft = gesunde Pferde + Artenvielfalt
 Pferde und artenreiche Wiesen Nachhaltige Wiesenwirtschaft = gesunde Pferde + Artenvielfalt Inhalt Einführung Weide Heu Fazit Quellen 25.01.2017 2 ZUR PERSON Sonja Schütz aus dem hohen Westerwald Pferdewirtschaftsmeisterin
Pferde und artenreiche Wiesen Nachhaltige Wiesenwirtschaft = gesunde Pferde + Artenvielfalt Inhalt Einführung Weide Heu Fazit Quellen 25.01.2017 2 ZUR PERSON Sonja Schütz aus dem hohen Westerwald Pferdewirtschaftsmeisterin
Grünland für die Milchproduktion effektiver nutzen?
 17. Raminer Futterbautag Grünland für die Milchproduktion effektiver nutzen? Dr. Heidi Jänicke Institut für Tierproduktion Dummerstorf 12. Oktober 2016 Grünland für die Milchproduktion Mit verschiedenen
17. Raminer Futterbautag Grünland für die Milchproduktion effektiver nutzen? Dr. Heidi Jänicke Institut für Tierproduktion Dummerstorf 12. Oktober 2016 Grünland für die Milchproduktion Mit verschiedenen
COUNTRY Grünland Futterqualität und Ausdauer
 Grünland Grünland Futterqualität und Ausdauer Grünlandmischungen bieten eine hohe Sicherheit bei den Futtererträgen und -qualitäten. Die szusammensetzungen sind den Bedürfnissen der verschiedenen Grünlandstandorte
Grünland Grünland Futterqualität und Ausdauer Grünlandmischungen bieten eine hohe Sicherheit bei den Futtererträgen und -qualitäten. Die szusammensetzungen sind den Bedürfnissen der verschiedenen Grünlandstandorte
Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras Aussaat 2003
 Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern Schleswig-Holstein, Hannover, Weser-Ems, Nordrhein-Westfalen Versuchsbericht 2004 Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras Aussaat 2003
Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern Schleswig-Holstein, Hannover, Weser-Ems, Nordrhein-Westfalen Versuchsbericht 2004 Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras Aussaat 2003
Milchproduktion auf der Weide Ein Produktionssystem mit Zukunft
 Milchproduktion auf der Weide Ein Produktionssystem mit Zukunft Jeff Boonen Warburg, 10. März 2014 Übersicht Entwicklung Milchproduktion und Weidehaltung Erfolgreiche Weidesysteme Erfolgsfaktoren Weidehaltung
Milchproduktion auf der Weide Ein Produktionssystem mit Zukunft Jeff Boonen Warburg, 10. März 2014 Übersicht Entwicklung Milchproduktion und Weidehaltung Erfolgreiche Weidesysteme Erfolgsfaktoren Weidehaltung
Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras Aussaat 2004
 Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen Versuchsbericht 2005 Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras Aussaat 2004 Bearbeitung:
Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen Versuchsbericht 2005 Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras Aussaat 2004 Bearbeitung:
Fütterungspraxis und Futterautonomie von Milchviehbetrieben in der Schweiz
 Fütterungspraxis und Futterautonomie von Milchviehbetrieben in der Schweiz AGFF Frühlingstagung, 31. März 2015, Witzwil Beat Reidy & Simon Ineichen, HAFL Zollikofen Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften
Fütterungspraxis und Futterautonomie von Milchviehbetrieben in der Schweiz AGFF Frühlingstagung, 31. März 2015, Witzwil Beat Reidy & Simon Ineichen, HAFL Zollikofen Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften
Effiziente Weidesysteme für Mutterkühe (Kurzrasenweide, Mähstandweide oder Umtriebsweide) Dr. Gerhard Riehl Tag des Fleischrindhalters 2010 am 03.
 Effiziente Weidesysteme für Mutterkühe (Kurzrasenweide, Mähstandweide oder Umtriebsweide) Dr. Gerhard Riehl Tag des Fleischrindhalters 2010 am 03. November 2010 in Groß Kreutz / OT Götz Was ist Weide?
Effiziente Weidesysteme für Mutterkühe (Kurzrasenweide, Mähstandweide oder Umtriebsweide) Dr. Gerhard Riehl Tag des Fleischrindhalters 2010 am 03. November 2010 in Groß Kreutz / OT Götz Was ist Weide?
Mehr Milch aus Weidegras Milchleistung und Herdenmanagement
 Mehr Milch aus Weidegras Milchleistung und Herdenmanagement Dr. Thomas Jilg Bildungs- und Wissenszentrum Aulendorf - Viehhaltung, Grünlandwirtschaft, Wild, Fischerei - Tel. 07525/942-302, E-Mail: thomas.jilg@lvvg.bwl.de
Mehr Milch aus Weidegras Milchleistung und Herdenmanagement Dr. Thomas Jilg Bildungs- und Wissenszentrum Aulendorf - Viehhaltung, Grünlandwirtschaft, Wild, Fischerei - Tel. 07525/942-302, E-Mail: thomas.jilg@lvvg.bwl.de
Kraftfuttergaben bei HF-Kühen und Doppelnutzungskühen im Vergleich zu Jahresmilchleistung und Gesundheitsdaten
 Kraftfuttergaben bei HF-Kühen und Doppelnutzungskühen im Vergleich zu Jahresmilchleistung und Gesundheitsdaten Zielsetzungen Erstellung und Überprüfung von Beratungsempfehlungen Hypothesen Auch mit wenig
Kraftfuttergaben bei HF-Kühen und Doppelnutzungskühen im Vergleich zu Jahresmilchleistung und Gesundheitsdaten Zielsetzungen Erstellung und Überprüfung von Beratungsempfehlungen Hypothesen Auch mit wenig
Gräsersortiment konventionell 2017
 Gräsersortiment konventionell 2017 Dauerwiesen: Die Auswahl der richtigen Mischung ist bei einer Neuansaat das Wichtigste. Jedoch ist Dauerwiese nicht gleich Dauerwiese, denn: - die Arten- und Sortenzusammensetzung
Gräsersortiment konventionell 2017 Dauerwiesen: Die Auswahl der richtigen Mischung ist bei einer Neuansaat das Wichtigste. Jedoch ist Dauerwiese nicht gleich Dauerwiese, denn: - die Arten- und Sortenzusammensetzung
Pferdeweiden müssen kein Bild des Jammers sein
 Pferdeweiden müssen kein Bild des Jammers sein Pferde auf Weiden gelten meist als Inbegriff artgerechter Haltung. Gleichzeitig stellen viele Pferdeweiden eher reine Ausläufe dar und dienen nicht unbedingt
Pferdeweiden müssen kein Bild des Jammers sein Pferde auf Weiden gelten meist als Inbegriff artgerechter Haltung. Gleichzeitig stellen viele Pferdeweiden eher reine Ausläufe dar und dienen nicht unbedingt
Gesamtbetriebliche Analyse von Weidebetrieben und Weidesystemen in der Milchviehhaltung
 Gesamtbetriebliche Analyse von Weidebetrieben und Weidesystemen in der Milchviehhaltung Dr. Lukas Kiefer Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre (410b) Dankmarshausen, 16.06.2016 Gliederung 1. Vergleich
Gesamtbetriebliche Analyse von Weidebetrieben und Weidesystemen in der Milchviehhaltung Dr. Lukas Kiefer Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre (410b) Dankmarshausen, 16.06.2016 Gliederung 1. Vergleich
Tab. 2: Mittlere Tageszunahmen während der Weideperioden , g/tier/tag
 Kälberaufzucht auf der Kurzrasenweide Anne Verhoeven und Dr. Sebastian Hoppe, LK NRW, Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick, Kleve Dr. Martin Pries, LK NRW, Fachbereich 71, Münster
Kälberaufzucht auf der Kurzrasenweide Anne Verhoeven und Dr. Sebastian Hoppe, LK NRW, Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick, Kleve Dr. Martin Pries, LK NRW, Fachbereich 71, Münster
Milchviehfütterung im Organischen Landbau - Erfahrungen aus Haus Riswick
 Milchviehfütterung im Organischen Landbau - Erfahrungen aus Haus Riswick Einführung: Schwerpunkt der Versuchsaktivitäten im Landwirtschaftszentrum Haus Riswick, Kleve, ist die Milchviehfütterung einschließlich
Milchviehfütterung im Organischen Landbau - Erfahrungen aus Haus Riswick Einführung: Schwerpunkt der Versuchsaktivitäten im Landwirtschaftszentrum Haus Riswick, Kleve, ist die Milchviehfütterung einschließlich
Futterbau und Pferdehaltung, eine nicht immer einfache Partnerschaft!
 Futterbau und Pferdehaltung, eine nicht immer einfache Partnerschaft! Fragen an den Pferdehalter Was erwarten sie von der Wiese? Wie werden die Wiesen genutzt? Wie hoch ist der Tierbesatz pro Fläche Wie
Futterbau und Pferdehaltung, eine nicht immer einfache Partnerschaft! Fragen an den Pferdehalter Was erwarten sie von der Wiese? Wie werden die Wiesen genutzt? Wie hoch ist der Tierbesatz pro Fläche Wie
Biologische Wiesenbewirtschaftung
 Übersicht Biologische Wiesenbewirtschaftung Einführungskurs Biologische Landwirtschaft, 18.11.2009 Gröbming Ampfer in der Wiese Boden und Düngung Pflanzenbestände DI Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt
Übersicht Biologische Wiesenbewirtschaftung Einführungskurs Biologische Landwirtschaft, 18.11.2009 Gröbming Ampfer in der Wiese Boden und Düngung Pflanzenbestände DI Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt
Weidesysteme im Vergleich
 Weidesysteme im Vergleich Geschichtliche Entwicklung 10 000 v. Chr. begann mit der Seßhaftwerdung auch die Domestikation des Rindes 4 000 v. Chr. begann mit der Besiedlung des Alpenraums auch die Weide-
Weidesysteme im Vergleich Geschichtliche Entwicklung 10 000 v. Chr. begann mit der Seßhaftwerdung auch die Domestikation des Rindes 4 000 v. Chr. begann mit der Besiedlung des Alpenraums auch die Weide-
Einführung in die Weidesysteme
 Einführung in die Weidesysteme Inhalt: Weidesysteme und Rahmenbedingungen, Aufwuchshöhenmessung, Weidefressverhalten PD Dr. Andreas Steinwidder, Institut für Biologische Landwirtschaft und Biodiversität
Einführung in die Weidesysteme Inhalt: Weidesysteme und Rahmenbedingungen, Aufwuchshöhenmessung, Weidefressverhalten PD Dr. Andreas Steinwidder, Institut für Biologische Landwirtschaft und Biodiversität
Setzen Sie auf s richtige P mit Pferdeweiden von Planterra.
 Setzen Sie auf s richtige P mit Pferdeweiden von Planterra. Im Gegensatz zu herkömmlichen Weiden für Nutztiere muss die Pferdeweide mehreren Anforderungen gleichzeitig gerecht werden. Sie dient neben der
Setzen Sie auf s richtige P mit Pferdeweiden von Planterra. Im Gegensatz zu herkömmlichen Weiden für Nutztiere muss die Pferdeweide mehreren Anforderungen gleichzeitig gerecht werden. Sie dient neben der
Weidehaltung von Milchkühen um jeden Preis?
 Weidehaltung von Milchkühen um jeden Preis? Jürgen Müller Woldegk, 08.03.2017 UNIVERSITÄT ROSTOCK FAKULTÄT AGRAR- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Lehrstuhl f. Grünland- & Futterbauwissenschaften 1 Gliederung
Weidehaltung von Milchkühen um jeden Preis? Jürgen Müller Woldegk, 08.03.2017 UNIVERSITÄT ROSTOCK FAKULTÄT AGRAR- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Lehrstuhl f. Grünland- & Futterbauwissenschaften 1 Gliederung
Weideplanung und Weidekonzepte notwendige Werkzeuge zur Umsetzung? Dr. Gerhard Riehl zum 24. Sächsischen Grünlandtag am 18. Juni 2016 in Malschwitz
 Weideplanung und Weidekonzepte notwendige Werkzeuge zur Umsetzung? Dr. Gerhard Riehl zum 24. Sächsischen Grünlandtag am 18. Juni 2016 in Malschwitz Foto: Riehl Foto: Riehl Weide Weideleistung Weideintensitäten
Weideplanung und Weidekonzepte notwendige Werkzeuge zur Umsetzung? Dr. Gerhard Riehl zum 24. Sächsischen Grünlandtag am 18. Juni 2016 in Malschwitz Foto: Riehl Foto: Riehl Weide Weideleistung Weideintensitäten
Bedarfsgerechte Fütterung von Mutterkühen
 Bedarfsgerechte Fütterung von Mutterkühen Ziele Warum bedarfsgerecht? Bedarfsnormen Umsetzung Die Futterkosten gehören zu den wesentlichen Kostenfaktoren Kostenstruktur des Verfahrens in Iden bei der Produktion
Bedarfsgerechte Fütterung von Mutterkühen Ziele Warum bedarfsgerecht? Bedarfsnormen Umsetzung Die Futterkosten gehören zu den wesentlichen Kostenfaktoren Kostenstruktur des Verfahrens in Iden bei der Produktion
Grasfütterungssysteme Stall oder Weide?
 Grasfütterungssysteme Stall oder Weide? Meyerode, 22.Februar 2012 Jeff Boonen Henri Kohnen Plan Einleitung Versuche Systemvergleich CRAW-Liroux Hohenrain (CH) Erfolgskriterien Stall Weide Weide- oder Stallhaltung?
Grasfütterungssysteme Stall oder Weide? Meyerode, 22.Februar 2012 Jeff Boonen Henri Kohnen Plan Einleitung Versuche Systemvergleich CRAW-Liroux Hohenrain (CH) Erfolgskriterien Stall Weide Weide- oder Stallhaltung?
Energiegehalt und Einflussgrößen der Energieschätzgleichung für Grassilagen
 Energiegehalt und Einflussgrößen der Energieschätzgleichung für Grassilagen Neuerung: Ab 2008 wurde bei der LUFA NRW eine neue Energieschätzgleichung für Grassilagen eingesetzt. Neben Rohasche und Rohprotein
Energiegehalt und Einflussgrößen der Energieschätzgleichung für Grassilagen Neuerung: Ab 2008 wurde bei der LUFA NRW eine neue Energieschätzgleichung für Grassilagen eingesetzt. Neben Rohasche und Rohprotein
MUTTERKUH und KALB. Fütterung. Beratungsstelle für Rinderproduktion OÖ
 MUTTERKUH und KALB Fütterung Beratungsstelle für Rinderproduktion OÖ Fütterung der Mutterkuh In der Mutterkuhhaltung ist es wichtig, dass die Kuh jedes Jahr ein Kalb bekommt. Im Rahmen einer entsprechenden
MUTTERKUH und KALB Fütterung Beratungsstelle für Rinderproduktion OÖ Fütterung der Mutterkuh In der Mutterkuhhaltung ist es wichtig, dass die Kuh jedes Jahr ein Kalb bekommt. Im Rahmen einer entsprechenden
Effiziente Grünlandnutzung durch Weide Optimaler Nutzungszeitpunkt von Gras Weidesysteme Jungviehaufzucht Fazit
 Effiziente Grünlandnutzung durch Weide Siegfried Steinberger, LFL, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft; Grub Gliederung Optimaler Nutzungszeitpunkt von Gras Weidesysteme Jungviehaufzucht Fazit
Effiziente Grünlandnutzung durch Weide Siegfried Steinberger, LFL, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft; Grub Gliederung Optimaler Nutzungszeitpunkt von Gras Weidesysteme Jungviehaufzucht Fazit
Empfehlungen zur Grünlandbewirtschaftung und verbesserung im Ökologischen Landbau
 Empfehlungen zur Grünlandbewirtschaftung und verbesserung im Ökologischen Landbau Zielsetzung Zusammenstellung von Empfehlungen zur Bewirtschaftung von Grünland unter Bedingungen des ökologischen Landbaus.
Empfehlungen zur Grünlandbewirtschaftung und verbesserung im Ökologischen Landbau Zielsetzung Zusammenstellung von Empfehlungen zur Bewirtschaftung von Grünland unter Bedingungen des ökologischen Landbaus.
Grünland. Planterra Dauerwiesen und Nachsaatmischungen 50 Advanta Revital 56 Amtlich empfohlene Mischungen 58
 Planterra Dauerwiesen und Nachsaatmischungen 50 Advanta Revital 56 Amtlich empfohlene Mischungen 58 49 Planterra Dauerwiesen Die Dauerwiese besteht aus hochwertigen Futtergräsern und Kleearten, die für
Planterra Dauerwiesen und Nachsaatmischungen 50 Advanta Revital 56 Amtlich empfohlene Mischungen 58 49 Planterra Dauerwiesen Die Dauerwiese besteht aus hochwertigen Futtergräsern und Kleearten, die für
Einfluss von Vorfrucht, Zwischenfruchtanbau, organischer Düngung und Bodenbearbeitung in einer intensiven Hackfruchtfruchtfolge mit Kartoffeln
 Einfluss von Vorfrucht, Zwischenfruchtanbau, organischer Düngung und Bodenbearbeitung in einer intensiven Hackfruchtfruchtfolge mit Kartoffeln Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Einfluss von Vorfrucht, Zwischenfruchtanbau, organischer Düngung und Bodenbearbeitung in einer intensiven Hackfruchtfruchtfolge mit Kartoffeln Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
