Graphische Datenverarbeitung Visualisierungstechniken. Prof. Dr. Elke Hergenröther
|
|
|
- Ruth Vogt
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Graphische Datenverarbeitung Visualisierungstechniken Prof. Dr. Elke Hergenröther
2 Visualisierungstechniken Visualisierung: Visualisierung bedeutet sichtbar machen, darstellen. Die CG beschränkt sich dabei jedoch nicht auf die Abbildung real existierender Objekte sondern beschäftigt sich auch mit der Darstellung von Information und wissenschaftlich-technischen Daten. Prof. Dr. Elke Hergenröther 2
3 Strömungsvisualisierung Beispiele für Strömungsvisualisierungs-Resultate. Der verwendete Datensatz ist eine Simulation des Hurrikan Isabel. (Bilder von: Technische Universität Wien, Institut für Computergraphik und Algorithmen) Prof. Dr. Elke Hergenröther 3
4 Visualisierungstechniken Visualisierung: Visualisierung bedeutet sichtbar machen, darstellen. Die CG beschränkt sich dabei jedoch nicht auf die Abbildung real existierender Objekte sondern beschäftigt sich auch mit der Darstellung von Information und wissenschaftlich-technischen Daten. Visualisierung geometrischer Modelle Visualisierung ohne Berücksichtigung von Licht Visualisierung mit Berücksichtigung von Licht lokale Verfahren globale Verfahren Prof. Dr. Elke Hergenröther 4
5 Visualisierung ohne Berücksichtigung von Licht Wie berechnet man den Farbverlauf innerhalb einer Linie oder eines Dreiecks, wenn jedem Punkt eine andere Farbe zugeordnet wurde? Lineare Interpolation: Interpolationsverfahren für Linien Bilineare Interpolation: Interpolationsverfahren für Flächen Prof. Dr. Elke Hergenröther 5
6 Lineare Farbinterpolation Verhältnis der Farbanteile von F(0) und F(1) F(0) F(1) Prof. Dr. Elke Hergenröther 6
7 Lineare Farbinterpolation F(1) F(0) 1/4 Prof. Dr. Elke Hergenröther 7
8 Bilineare Farbinterpolation für Dreiecke 1. Schritt: Rasterisierung des Dreiecks V1 V3 V2 Prof. Dr. Elke Hergenröther 8
9 Bilineare Farbinterpolation für Dreiecke 2. Schritt: Farbwerte der Pixel zwischen den Vertices interpolieren Interpolation zwischen V1 V1 und V2: t1 V3 V2 Zunächst muss die Strecke zwischen den beiden Vertices normiert werden. Der Parameter t1 steht für die normierte Strecke und geht von 0 bis 1. Danach erfolgt eine lineare Farbinterpolation abhängig von t1. Prof. Dr. Elke Hergenröther 9
10 Bilineare Farbinterpolation für Dreiecke Farbwerte der Pixel zwischen den Vertices wurden linear interpoliert V1 3. Schritt: V3 Lineare Interpolation der Pixelwerte entlang der einzelnen Rasterzeilen V2 Prof. Dr. Elke Hergenröther 10
11 Ergebnis einer bilinearen Farbinterpolation Prof. Dr. Elke Hergenröther 11
12 Rendering Rendern: Rendern bedeutet: Visualisieren einer beleuchteten Szene. Dabei spielen die Beleuchtungsverhältnisse und die Materialien, die auf die Beleuchtung reagieren eine wichtige Rolle. Renderer: Hard- oder Software, die die Visualisierung der Szene übernimmt. Prof. Dr. Elke Hergenröther 12
13 Faktoren, die das Aussehen eines Objektes bestimmen: Position und Orientierung des Betrachters relativ zum beleuchteten Objekt Position, Orientierung und Typ der Lichtquelle Oberflächenmaterial des Objektes Abbildung entnommen von: owthread.php?t= Zuletzt besucht: Prof. Dr. Elke Hergenröther 13
14 Faktoren, die das Aussehen eines Objektes bestimmen: Beschaffenheit der Objektoberfläche & Verfahren zum Rendern des Objektes Simulation von Samt Simulation von Satin Prof. Dr. Elke Hergenröther C. Weber & R. Giera: Vertiefung aktueller Themen in der Computer Graphik 14
15 Gerichtete Lichtquelle Entsprechen einer unendlich weit entfernten Lichtquelle parallel einfallende Strahlen. Prof. Dr. Elke Hergenröther 15
16 Punktlichtquelle Ein lokalisierter Punkt strahlt das Licht aus. unterschiedliche Winkel auf eine ebene Fläche Prof. Dr. Elke Hergenröther 16
17 Spotlichtquelle Nur um einen bestimmten Winkel um eine angegebene Richtung wird Licht ausgestrahlt. je weiter von der Richtung weg desto schwächer wird das Licht Prof. Dr. Elke Hergenröther 17
18 Phong sches Reflexionsmodell Nach: Bui-Tuong Phong, Illumination for Computer Generated Pictures, in Communications of the ACM, 1975 Lichtquelle wird als Punktlichtquelle angenommen Die in Richtung des Betrachters abgegebene Lichtintensität ergibt sich aus der Summe der drei Komponenten: Diffuse Reflexion Ambiente Beleuchtung Spiegelnde Reflexion Prof. Dr. Elke Hergenröther Prof. Dr. Elke Hergenröther 18
19 Phong sches Reflexionsmodell: Ambiente Beleuchtung Ideal diffuse Reflexion Ideal spiegelnde Reflexion Prof. Dr. Elke Hergenröther Prof. Dr. Elke Hergenröther 19
20 Diffuse Reflexion Sehr matte Oberflächen sind perfekt diffus reflektierend. Diese Oberflächen haben unabhängig von der Position des Betrachters die gleiche Farbe und Helligkeit. Farbe der diffusen Reflexion ist Materialabhängig. Prof. Dr. Elke Hergenröther 20
21 Spiegelnde Reflexion Im Gegensatz zum diffus reflektierenden Licht hat spiegelnd reflektierendes Licht nicht die Farbe der Oberfläche sondern die des Lichtes. Beispiel: Ein grünes Objekt wird mit weißen Licht bestrahlt. Das diffus reflektierte Licht ist grün. Das spiegelnd reflektierte Licht ist weiß. Prof. Dr. Elke Hergenröther 21
22 Ambiente Materialbeleuchtung Die Ambiente Beleuchtung soll das Umgebungslicht simulieren. Sie ist nur von der Materialfarbe und der eingestellten Lichtintensität abhängig. Prof. Dr. Elke Hergenröther 22
23 Licht aus der Umgebung Oberflächen, die parallel zum einfallenden Licht liegen, haben keine diffuse Reflexion und erst recht keine spiegelnde Reflexion. D.h. sie müssten schwarz dargestellt werden. Realistisch ist aber, dass diese Flächen vom abgestrahlten Licht der Umgebung beleuchtet werden also auch sichtbar sind. Simulation dieses Effektes durch Anwendung eines Umgebungslichts: Der Ambienten Materialbeleuchtung Prof. Dr. Elke Hergenröther 23
24 Quelle:
25 Ohne Normalen keine Beleuchtungsberechnung! 1. Variante: Flächennormalen Flächennormale steht senkrecht auf der Fläche. Berechnung mittels Kreuzprodukt (rechte-hand-regel) Ikosaeder Auf welcher Stelle der Fläche sitzt diese Flächennormale im Dreieck? Prof. Dr. Elke Hergenröther 25
26 Flat Shading Verfahren: Für jede Fläche gibt es nur eine Normale. Dadurch erhält jede Fläche (Facette) eine einheitliche Beleuchtung*). D.h. jede Fläche besitzt nur eine Farbe. Nachteil: Da die meisten Objektoberflächen gekrümmt sind, ist die Qualität der Ergebnisse meist schlecht. Vorteil: sehr einfache und sehr schnelle Beleuchtungsberechnung! *) Beleuchtung wird meist mit dem Phong schen Beleuchtungsmodell berechnet. Prof. Dr. Elke Hergenröther 26
27 Verbesserung der Beleuchtungssimulation beginnt bei den Normalen! 2. Variante: Eckennormalen Eckennormalen stehen senkrecht auf der Tangentialebene... Ikosaeder... und NICHT wie die Flächennormale senkrecht auf der Fläche! Eckennormalen berechnet man durch die Interpolation der Flächennormalen der benachbarten Flächen. Prof. Dr. Elke Hergenröther 27
28 Gouraud Shading Beleuchtungsberechnung *) wird für jeden Eckpunkt durchgeführt. D.h. pro Dreieck werden drei unterschiedliche Farben (Helligkeiten) berechnet. Die Farben der Pixel innerhalb des Dreiecks werden durch bilineare Interpolation berechnet. Dadurch entsteht eine optische Glättung ohne Änderungen an der Geometrie vornehmen zu müssen. Optische Glättung bewirkt ein kaschieren der Kanten, die nicht zur Kontur gehören! *) Beleuchtung wird meist mit dem Phong schen Beleuchtungsmodell berechnet. Prof. Dr. Elke Hergenröther 28
29 Flat Shading versus Gouraud Shading Ergebnis ist abhängig von den berechneten Normalen: Links: Flächennormalen Rechts: Eckpunktnormalen Prof. Dr. Elke Hergenröther 29
30 Grenzen des Gouraud Shading Verfahrens Lichtquelle bestrahlt nur die Mitte eines Dreiecks: Lichtberechnung wird nur an den Eckpunkten berechnet. Dadurch kann für das Dreieck kein Glanzlicht berechnet werden. Außer man macht folgendes... Prof. Dr. Elke Hergenröther 30
31 Glanzlichter mit Gouraud Shading berechnen: 2 Dreiecke 8 Dreiecke 18 Dreiecke 50 Dreiecke 200 Dreiecke 3200 Dreiecke Prof. Dr. Elke Hergenröther 31
32 Phong Shading Beleuchtungsberechnung wird für jeden einzelnen Pixel durchgeführt. Das bedeutet: Für jeden darzustellenden Pixel muss eine Normale berechnet werden! Die Normalen der Pixel werden auf Basis der Ecknormalen ermittelt oder durch eine Art Textur (Normal Map). Dadurch können Glanzlichter ohne zusätzliche Unterteilung (Tessilierung) des Gitters berechnet werden. Vorteil: Glanzlichter & gutes visuelles Ergebnis Nachteil: Normale für jeden Pixel interpolieren kostet viel Rechenzeit Prof. Dr. Elke Hergenröther 32
33 Vergleich der Verfahren Flat Shading Gouraud Shading Phong Shading Prof. Dr. Elke Hergenröther 33
34 Flat-, Gouraund- und Phong-Shading Prof. Dr. Elke Hergenröther Von: www-2.cs.cmu.edu/~ph/nyit/ 34
35 Vergleich der Verfahren Gouraud Shading Aus: Watt A., Policarpo F.: The Computer Image, Addison-Wesley 1998 Flat Shading Phong Shading Nicht berechnet werden kann mit den hier vorgestellten Shading Verfahren: Schattenwurf, transparente Oberflächen, sowie spiegelnde Oberflächen...das können nur globale Verfahren Prof. Dr. Elke Hergenröther 35
36 Verfahren zum Rendering Lokale Verfahren: Berücksichtigt bei der Berechnung des von der Objektoberfläche reflektierten Lichts nur das von der definierten Lichtquelle einfallende Licht (primäre Lichtquellen). Die Beleuchtung der Objekte wird nicht beeinflusst durch: Spiegelung, Lichtreflexionen von andern Objekten, und Schattenwurf sekundäre Lichtquellen Prof. Dr. Elke Hergenröther 36
37 Verfahren zum Rendering Globale Verfahren: Objekte der Szene beeinflussen sich gegenseitig. In die Beleuchtungsberechnung gehen neben den primären Lichtquellen auch die sekundären mit ein. D.h. in der Beleuchtungsberechnung werden berücksichtigt: Spiegelung, Schattenwurf und Lichtreflexion anderer Objekte. Prof. Dr. Elke Hergenröther 37
38 Was sind primäre und was sind sekundäre Lichtquellen? Prof. Dr. Elke Hergenröther 38
39 Verfahren zum Rendering Lokale Verfahren Wenig rechenaufwendig - schnelle Berechnung Beispiele: Flat Shading Gouraud Shading Phong Shading Globale Verfahren Sehr rechenaufwendig Beispiele: Rekursives Ray Tracing Radiosity Prof. Dr. Elke Hergenröther 39
40 Diffuse Ray Tracing Radiosity
41 Globales Verfahren: Ray Tracing Idee beim Ray Tracing: Um die Beleuchtung eines Objekts zu ermitteln, verfolgt man den Weg aller Lichtstrahlen innerhalb der Szene Watt A., Policarpo F. The Computer Image Addison-Wesley 1998 Prof. Dr. Elke Hergenröther 41
42 Verfolgung der Lichtstrahlen: Forward Ray Tracing: Von der Lichtquelle ausgehend werden die Lichtstrahlen bis ins Auge des Betrachters (COP = Center of Projection) verfolgt. Zu aufwändig: da die meisten Strahlen das COP nicht erreichen. Also: Erstmal gucken, was beim Betrachter überhaupt ankommt ;-) Prof. Dr. Elke Hergenröther 42
43 Statt der Lichtstrahlen werden die Sehstrahlen verfolgt: Prof. Dr. Elke Hergenröther 43
44 Backward Ray Tracing Backward Ray Tracing wird allgemein als Ray Tracing bezeichnet! Nur für die Stellen, die der Betrachter tatsächlich sieht wird eine Beleuchtungsberechnung durchgeführt: Statt Lichtstrahlen verfolgt man Sehstrahlen ; im Prinzip eine Rückwärtsverfolgung der Lichtstrahlen Also vom Auge des Betrachters (COP) werden durch die Projektionsebene hin zum Objekt Sehstrahlen verschickt. Prof. Dr. Elke Hergenröther 44
45 Prinzip: Backward Ray Tracing Schattenfühler Normale COP Material ist diffus reflektierend und der Schattenfühler erreicht eine Lichtquelle : Beleuchtungsberechnung anhand der Pixelnormalen Berechnete Farbe färbt den Pixel Schattenfühler erreicht die Lichtquelle nicht : Pixel wird auf schwarz gesetzt Kugel versperrt dem Schattenfühler den Weg zur Lichtquelle Prof. Dr. Elke Hergenröther 45
46 Prinzip: Backward Ray Tracing Die Verdeckungsberechnung erfolgt also nebenbei, ganz automatisch COP 1. Schnittpunkt 2. Schnittpunkt Bisher beeinflussen sich die Objekte noch nicht gegenseitig. Prof. Dr. Elke Hergenröther 46
47 Ray Tracing Prinzip Wenn der getroffene Schnittpunkt nur diffus reflektierend ist, wird die Sehstrahlverfolgung (nach dem Schattentest & der Beleuchtungsberechnung) abgebrochen. Was passiert aber wenn der getroffener Punkt auf einer spiegelnd reflektierenden Oberfläche liegt oder die Oberfläche transparent ist? Prof. Dr. Elke Hergenröther 47
48 Ray Tracing Prinzip Spiegelnde Reflexion Normale Transmission = Brechungswinkel Prof. Dr. Elke Hergenröther 48
49 Backward Ray Tracing Normale COP Normale Welche Reflexionseigenschaften haben die Materialien der verschiedenen Objekte? Prof. Dr. Elke Hergenröther 49
50 Prof. Dr. Elke Hergenröther 50
51 Beleuchtungsberechung beim Ray Tracing Farbe des Pixels setzt sich zusammen aus: ambienten Umgebungslicht (globaler Wert) diffuser Reflektion (Primärstrahl) spiegelnder Reflektionen Sekundärstrahlen Transmissionen Anmerkung: Material ist meist nicht nur spiegelnd oder nur diffus reflektierend! Nicht berücksichtigt werden: Diffuse indirekte Beleuchtung die von benachbarten Objekten ausgeht! Prof. Dr. Elke Hergenröther 51
52 Einschränkungen des Ray Tracing Verfahrens Keine weichen Schatten Keine indirekte diffuse Beleuchtung der Objekte durch andere Objekte der Szene Keine Caustics Caustics Prof. Dr. Elke Hergenröther 52
53 Erweiterung des Ray-Tracing Verfahrens zur Berechnung von Caustics und diffuser Reflexion: Photon Mapping (H. W. Jensen) Ergebnisse der Masterarbeit von Tobias Geis (an der FHD) Prof. Dr. Elke Hergenröther 53
54 Diffuse Beleuchtung und Caustic-Berechnung werden durch die Verwendung von Photonen ins Ray-Tracing integriert Photon Map Prof. Dr. Elke Hergenröther 54
55 Ergebnisse der Masterarbeit von Tobias Geis (an der FHD) Zur Integration wurden Photonen verwendet Prof. Dr. Elke Hergenröther 55
56 Ergebnisse der Masterarbeit von Tobias Geis (an der FHD) Nach der Optimierung der Photonmap ( Photonen): Prof. Dr. Elke Hergenröther 56
57 Ergebnisse der Masterarbeit von Tobias Geis (an der FHD)... einer von zwei Preisträgern des Fachbereichspreis im WS 04/05 Prof. Dr. Elke Hergenröther 57
58 Raytracing + Photon Mapping (Caustics) Caustic Map
59
60
61 Welche Methoden nutzte man bisher zur Echtzeitberechnung von Spiegelungen?
62 Cubic Environment Map Umgebung wird auf einen Würfel abgebildet (Environment Map). Spiegelnde Reflexion wird anhand des Texel (=Texturpixel) ermittelt auf den der Reflexionsvektor zeigt. Was ist der Reflexionsvektor? Alle Bilder aus [2] Prof. Dr. Elke Hergenröther 62
63 Cubic Environment Map Cubic Environment Map um verschiedene Objekte Alle Bilder aus [2] Prof. Dr. Elke Hergenröther 63
64 Cubic Environment Map Alle Bilder aus [2] Prof. Dr. Elke Hergenröther 64
65 Sphere Mapping Environment Map ist im Regelfall eine Photographie aufgenommen mit extrem niedriger Brennweite. Man nennt sie auch Light Probe (siehe Abbildung) Prof. Dr. Elke Hergenröther 65
66 Sphere Mapping Verschiedene Sphere Maps (Light Probes): Beachte: Sphere Maps sind Blickpunkt abhängig! Prof. Dr. Elke Hergenröther 66
67 Cubic und Sphere Mapping im Vergleich 67 aus [1] Alle Bilder
Lokale Beleuchtungsmodelle
 Lokale Beleuchtungsmodelle Oliver Deussen Lokale Modelle 1 Farbschattierung der Oberflächen abhängig von: Position, Orientierung und Charakteristik der Oberfläche Lichtquelle Vorgehensweise: 1. Modell
Lokale Beleuchtungsmodelle Oliver Deussen Lokale Modelle 1 Farbschattierung der Oberflächen abhängig von: Position, Orientierung und Charakteristik der Oberfläche Lichtquelle Vorgehensweise: 1. Modell
Wima-Praktikum 2: Bildsynthese-Phong
 Wima-Praktikum 2: Bildsynthese-Phong Wima-Praktikum 2: Prof. Dr. Lebiedz, M. Sc. Radic 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Kurze Beschreibung der Aufgabenstellung und dem Phong- Modell 3 3 Modellierung
Wima-Praktikum 2: Bildsynthese-Phong Wima-Praktikum 2: Prof. Dr. Lebiedz, M. Sc. Radic 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Kurze Beschreibung der Aufgabenstellung und dem Phong- Modell 3 3 Modellierung
Rendering: Lighting & Shading
 Hauptseminar How to make a Pixar Movie WS 2010 / 2011 Rendering: Lighting & Shading von Manuel Schmidt Gliederung: 1 Einführung 1.1 Rendering 1.2 Reflektionsmodelle 1.2.1. Diffuse Reflektion 1.2.2. Spieglende
Hauptseminar How to make a Pixar Movie WS 2010 / 2011 Rendering: Lighting & Shading von Manuel Schmidt Gliederung: 1 Einführung 1.1 Rendering 1.2 Reflektionsmodelle 1.2.1. Diffuse Reflektion 1.2.2. Spieglende
4.3 Beleuchtung und Schattierung
 4.3 Beleuchtung und Schattierung Die Grundbestandteile des Renderprozesses Atmosphärische Streuung Emission Reflexion/ Transmission/ Emission Oberfläche 4-38 4.3 Beleuchtung und Schattierung Beleuchtung
4.3 Beleuchtung und Schattierung Die Grundbestandteile des Renderprozesses Atmosphärische Streuung Emission Reflexion/ Transmission/ Emission Oberfläche 4-38 4.3 Beleuchtung und Schattierung Beleuchtung
Computergrafik 2010 Oliver Vornberger. Kapitel 18: Beleuchtung
 Computergrafik 2010 Oliver Vornberger Kapitel 18: Beleuchtung 1 Ausgangslage am Ende der Viewing Pipeline liegt vor: P A Materialeigenschaften P B P C 2 Beleuchtungmodelle lokal: Objekt, Lichtquellen,
Computergrafik 2010 Oliver Vornberger Kapitel 18: Beleuchtung 1 Ausgangslage am Ende der Viewing Pipeline liegt vor: P A Materialeigenschaften P B P C 2 Beleuchtungmodelle lokal: Objekt, Lichtquellen,
3.3 Beleuchtung und Schattierung
 3.3 Beleuchtung und Schattierung Die Beleuchtung einer Szenerie kann lokal oder global modelliert werden Ein lokales Beleuchtungsmodell berechnet die Intensität bzw. Farbe eines Objektpunkts abhängig vom
3.3 Beleuchtung und Schattierung Die Beleuchtung einer Szenerie kann lokal oder global modelliert werden Ein lokales Beleuchtungsmodell berechnet die Intensität bzw. Farbe eines Objektpunkts abhängig vom
Licht und Schatten Visualieren mit dem PC. Andreas Asperl
 Licht und Schatten Visualieren mit dem PC Andreas Asperl Visualisieren Grundlagen der Visualisierung Lichteinflüsse Materialien Anwendungen Tipps und Tricks Grundlagen der Visualisierung In der Computergraphik
Licht und Schatten Visualieren mit dem PC Andreas Asperl Visualisieren Grundlagen der Visualisierung Lichteinflüsse Materialien Anwendungen Tipps und Tricks Grundlagen der Visualisierung In der Computergraphik
"rendern" = ein abstraktes geometrisches Modell sichtbar machen
 3. Grundlagen des Rendering "rendern" = ein abstraktes geometrisches Modell sichtbar machen Mehrere Schritte: Sichtbarkeitsberechnung Beleuchtungsrechnung Projektion Clipping (Abschneiden am Bildrand)
3. Grundlagen des Rendering "rendern" = ein abstraktes geometrisches Modell sichtbar machen Mehrere Schritte: Sichtbarkeitsberechnung Beleuchtungsrechnung Projektion Clipping (Abschneiden am Bildrand)
(7) Normal Mapping. Vorlesung Computergraphik II S. Müller. Dank an Stefan Rilling U N I V E R S I T Ä T KOBLENZ LANDAU
 (7) Normal Mapping Vorlesung Computergraphik II S. Müller Dank an Stefan Rilling Einleitung Die Welt ist voller Details Viele Details treten in Form von Oberflächendetails auf S. Müller - 3 - Darstellung
(7) Normal Mapping Vorlesung Computergraphik II S. Müller Dank an Stefan Rilling Einleitung Die Welt ist voller Details Viele Details treten in Form von Oberflächendetails auf S. Müller - 3 - Darstellung
Graphische Datenverarbeitung und Bildverarbeitung
 Graphische Datenverarbeitung und Bildverarbeitung Hochschule Niederrhein Beleuchtungsberechnung Graphische DV und BV, Regina Pohle, 21. Beleuchtungsberechnung 1 Einordnung in die Inhalte der Vorlesung
Graphische Datenverarbeitung und Bildverarbeitung Hochschule Niederrhein Beleuchtungsberechnung Graphische DV und BV, Regina Pohle, 21. Beleuchtungsberechnung 1 Einordnung in die Inhalte der Vorlesung
Photon Mapping. Proseminar How to make a P I X A R movie. Inhaltsverzeichnis. Andreas Schmidt 2011
 Photon Mapping Proseminar How to make a P I X A R movie Andreas Schmidt 2011 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung...2 Motivation...2 Photon Tracing Pass...3 Aussenden der Photonen...3 Russisches Roulette...3
Photon Mapping Proseminar How to make a P I X A R movie Andreas Schmidt 2011 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung...2 Motivation...2 Photon Tracing Pass...3 Aussenden der Photonen...3 Russisches Roulette...3
Rendering. Rendern (Umsetzung oder Übertragung) Ursprüngliche Rendergleichung
 DIE RENDERGLEICHUNG Die Rendergleichung, wird in der 3D-Computergrafik verwendet. Es handelt sich um eine Integralgleichung, welche die Energieerhaltung bei der Ausbreitung von Lichtstrahlen beschreibt
DIE RENDERGLEICHUNG Die Rendergleichung, wird in der 3D-Computergrafik verwendet. Es handelt sich um eine Integralgleichung, welche die Energieerhaltung bei der Ausbreitung von Lichtstrahlen beschreibt
Probelektion zum Thema. Shadow Rendering. Shadow Maps Shadow Filtering
 Probelektion zum Thema Shadow Rendering Shadow Maps Shadow Filtering Renderman, 2006 CityEngine 2011 Viewport Real reconstruction in Windisch, 2013 Schatten bringen viel Realismus in eine Szene Schatten
Probelektion zum Thema Shadow Rendering Shadow Maps Shadow Filtering Renderman, 2006 CityEngine 2011 Viewport Real reconstruction in Windisch, 2013 Schatten bringen viel Realismus in eine Szene Schatten
Computergraphik Grundlagen
 Computergraphik Grundlagen VIII. Beleuchtung und Shading Prof. Stefan Schlechtweg Hochschule Anhalt Fachbereich Informatik Inhalt Lernziele 1. Beleuchtungsmodelle 2. Lichtquellen Punktförmige und flächenhafte
Computergraphik Grundlagen VIII. Beleuchtung und Shading Prof. Stefan Schlechtweg Hochschule Anhalt Fachbereich Informatik Inhalt Lernziele 1. Beleuchtungsmodelle 2. Lichtquellen Punktförmige und flächenhafte
RENDERING. Cobalt Xenon Argon. mit Ashlar-Vellum. www.arnold-cad.com
 RENDERING mit Ashlar-Vellum Cobalt Xenon Argon www.arnold-cad.com Erstellen photorealistischer Darstellungen Erstellen Sie Ihre Welt! Modellier Tips für mehr Realität Hintergrund und Szene Betrachtung
RENDERING mit Ashlar-Vellum Cobalt Xenon Argon www.arnold-cad.com Erstellen photorealistischer Darstellungen Erstellen Sie Ihre Welt! Modellier Tips für mehr Realität Hintergrund und Szene Betrachtung
Simulation multipler Streuung an Haaren mit Hilfe eines Photon-Mapping-Ansatzes
 Fakultät Informatik Institut für Software- und Multimediatechnik, Professur für Computergraphik und Visualisierung Simulation multipler Streuung an Haaren mit Hilfe eines Photon-Mapping-Ansatzes Hauptseminar
Fakultät Informatik Institut für Software- und Multimediatechnik, Professur für Computergraphik und Visualisierung Simulation multipler Streuung an Haaren mit Hilfe eines Photon-Mapping-Ansatzes Hauptseminar
Photonik Technische Nutzung von Licht
 Photonik Technische Nutzung von Licht Raytracing und Computergraphik Überblick Raytracing Typen von Raytracern z-buffer Raytracing Lichtstrahlen-Verfolgung (engl. ray tracing): Berechnung von Lichtstrahlen
Photonik Technische Nutzung von Licht Raytracing und Computergraphik Überblick Raytracing Typen von Raytracern z-buffer Raytracing Lichtstrahlen-Verfolgung (engl. ray tracing): Berechnung von Lichtstrahlen
Shadingalgorithmen zur Visualisierung nanostrukturierter Oberflächen
 Universität Hamburg Fachbereich Informatik Arbeitsbereich Technische Aspekte Multimodaler Systeme Seminar Informatikanwendungen in Nanotechnologien Betreuer: Bernd Schütz Sommersemester 2014 Shadingalgorithmen
Universität Hamburg Fachbereich Informatik Arbeitsbereich Technische Aspekte Multimodaler Systeme Seminar Informatikanwendungen in Nanotechnologien Betreuer: Bernd Schütz Sommersemester 2014 Shadingalgorithmen
die Planung eindrucksvoll präsentieren
 Ambientes Licht die Planung eindrucksvoll präsentieren Fotorealismus Linsensystem, Blende, Schärfentiefe/Tiefenschärfe Fotorealismus Materialeigenschaften, Oberflächenstruktur, Reflektion, Absorption Fotorealismus
Ambientes Licht die Planung eindrucksvoll präsentieren Fotorealismus Linsensystem, Blende, Schärfentiefe/Tiefenschärfe Fotorealismus Materialeigenschaften, Oberflächenstruktur, Reflektion, Absorption Fotorealismus
Parallele und funktionale Programmierung Wintersemester 2013/14. 8. Übung Abgabe bis 20.12.2013, 16:00 Uhr
 8. Übung Abgabe bis 20.12.2013, 16:00 Uhr Aufgabe 8.1: Zeigerverdopplung Ermitteln Sie an folgendem Beispiel den Rang für jedes Listenelement sequentiell und mit dem in der Vorlesung vorgestellten parallelen
8. Übung Abgabe bis 20.12.2013, 16:00 Uhr Aufgabe 8.1: Zeigerverdopplung Ermitteln Sie an folgendem Beispiel den Rang für jedes Listenelement sequentiell und mit dem in der Vorlesung vorgestellten parallelen
Komplexpraktikum Graphische Datenverarbeitung im WS 04/05
 Komplexpraktikum Graphische Datenverarbeitung im WS 04/05 von Enrico Leonhardt 28 45 669 TU Dresden Medieninformatik 29. März 2005 Graphische Datenverarbeitung WS 04/05 Einführung Dieser Raytracer entstand
Komplexpraktikum Graphische Datenverarbeitung im WS 04/05 von Enrico Leonhardt 28 45 669 TU Dresden Medieninformatik 29. März 2005 Graphische Datenverarbeitung WS 04/05 Einführung Dieser Raytracer entstand
Computer-Graphik 1 Lighting & Shading
 lausthal omputer-raphik 1. Zachmann lausthal University, ermany cg.in.tu-clausthal.de Beleuchtungsmodelle (lighting models) Definition "Beleuchtungsmodell": Vorschrift zur Berechnung der Farb- und Helligkeitswerte
lausthal omputer-raphik 1. Zachmann lausthal University, ermany cg.in.tu-clausthal.de Beleuchtungsmodelle (lighting models) Definition "Beleuchtungsmodell": Vorschrift zur Berechnung der Farb- und Helligkeitswerte
C A R L V O N O S S I E T Z K Y. Licht & Material. Johannes Diemke. Übung im Modul OpenGL mit Java Wintersemester 2010/2011
 C A R L V O N O S S I E T Z K Y Licht & Material Johannes Diemke Übung im Modul OpenGL mit Java Wintersemester 2010/2011 Motivation Licht & Material Geometrisch gut aussehende Modelle allein sind nicht
C A R L V O N O S S I E T Z K Y Licht & Material Johannes Diemke Übung im Modul OpenGL mit Java Wintersemester 2010/2011 Motivation Licht & Material Geometrisch gut aussehende Modelle allein sind nicht
1 Transformationen. 1.1 Transformationsmatrizen. Seite 1
 Seite 1 1 Transformationen 1.1 Transformationsmatrizen In den folgenden Teilaufgaben sind die Koeffizienten von 4 4 Transformationsmatrizen zur Repräsentation von affinen Abbildungen im R 3 zu bestimmen.
Seite 1 1 Transformationen 1.1 Transformationsmatrizen In den folgenden Teilaufgaben sind die Koeffizienten von 4 4 Transformationsmatrizen zur Repräsentation von affinen Abbildungen im R 3 zu bestimmen.
Raytracing. Schlussbericht. Jonas Lauener 1995, Áedán Christie 1997 Melvin Ott 1997, Timon Stampfli 1997
 Raytracing Schlussbericht Jonas Lauener 1995, Áedán Christie 1997 Melvin Ott 1997, Timon Stampfli 1997 bei Betreuer Marco Manzi, Institut für Informatik und angewandte Mathematik Inhalt Fragestellung...
Raytracing Schlussbericht Jonas Lauener 1995, Áedán Christie 1997 Melvin Ott 1997, Timon Stampfli 1997 bei Betreuer Marco Manzi, Institut für Informatik und angewandte Mathematik Inhalt Fragestellung...
:= Modellabbildung. Bildsynthese (Rendering) Bildsynthese
 Geometrisches Modell bestehend aus Datenstrukturen zur Verknüpfung geometrischer Primitive, welche eine Gesamtszene beschreiben Bildsynthese := Modellabbildung Pixelbasiertes Modell zur Darstellung eines
Geometrisches Modell bestehend aus Datenstrukturen zur Verknüpfung geometrischer Primitive, welche eine Gesamtszene beschreiben Bildsynthese := Modellabbildung Pixelbasiertes Modell zur Darstellung eines
Lights & Cameras Grundlagen Autodesk Maya. Grundlagen. Version Ingo Clemens brave rabbit
 Lights & Cameras Grundlagen Version 1.0-2009-06-15 Grundlagen 3D Beleuchtung Reguläre Lichter in 3D sind in erster Linie direkt beleuchtende Lichtquellen es gibt keine diffuse Beleuchtung durch die Reflexion
Lights & Cameras Grundlagen Version 1.0-2009-06-15 Grundlagen 3D Beleuchtung Reguläre Lichter in 3D sind in erster Linie direkt beleuchtende Lichtquellen es gibt keine diffuse Beleuchtung durch die Reflexion
3D-Computergrafik und animation. Shading und globale Beleuchtungsverfahren, Animationstechniken
 3D-Computergrafik und animation Shading und globale Beleuchtungsverfahren, Animationstechniken 1 Von 2D nach 3D Weiter: Modell für eine Sichtbeschreibung 2 Kameramodell Reale Kamera als Orientierung und
3D-Computergrafik und animation Shading und globale Beleuchtungsverfahren, Animationstechniken 1 Von 2D nach 3D Weiter: Modell für eine Sichtbeschreibung 2 Kameramodell Reale Kamera als Orientierung und
Computer Graphik I Beleuchtung
 Computer Graphik I Beleuchtung 1 3D Graphik- Pipeline Anwendung Geometrieverarbeitung Perspek>vische Transforma>on, kanonisches Sichtvolumen Clipping Culling (Verdeckungsrechnung im Objektraum) Simula>on
Computer Graphik I Beleuchtung 1 3D Graphik- Pipeline Anwendung Geometrieverarbeitung Perspek>vische Transforma>on, kanonisches Sichtvolumen Clipping Culling (Verdeckungsrechnung im Objektraum) Simula>on
Rendering Grundlagen Autodesk Maya. Grundlagen. Version 1.0-2009-04-08. 2009 Ingo Clemens brave rabbit www.braverabbit.de
 Rendering Grundlagen Version 1.0-2009-04-08 Allgemeine Unterschiede bei Renderern Scanline Rendering Raytrace Rendering Renderlayer Einsatz von Renderlayern Overrides Material Overrides Layer Presets Batch
Rendering Grundlagen Version 1.0-2009-04-08 Allgemeine Unterschiede bei Renderern Scanline Rendering Raytrace Rendering Renderlayer Einsatz von Renderlayern Overrides Material Overrides Layer Presets Batch
Programmierpraktikum 3D Computer Grafik
 Dipl.Inf. Otmar Hilliges Programmierpraktikum 3D Computer Grafik Szenegraphen, Texturen und Displaylisten. Agenda Beleuchtungsmodelle in OpenGL Bump-Maps zur Erzeugung von Reliefartigen Oberflächen Height-Maps
Dipl.Inf. Otmar Hilliges Programmierpraktikum 3D Computer Grafik Szenegraphen, Texturen und Displaylisten. Agenda Beleuchtungsmodelle in OpenGL Bump-Maps zur Erzeugung von Reliefartigen Oberflächen Height-Maps
Aus Zahlen werden Bilder. Jan Tobias Mühlberg <muehlber@fh-brandenburg.de>
 Aus Zahlen werden Bilder 1 Aus Zahlen werden Bilder Jan Tobias Mu hlberg Quelle: http://www.emperor-penguin.com 2 3 Modellierung einer Realität Ein endlich genaues Modell der
Aus Zahlen werden Bilder 1 Aus Zahlen werden Bilder Jan Tobias Mu hlberg Quelle: http://www.emperor-penguin.com 2 3 Modellierung einer Realität Ein endlich genaues Modell der
1. Sichtbarkeitsproblem beim Rendern einer dreidimensionalen Szene auf einer zweidimensionalen
 3D-Rendering Ulf Döring, Markus Färber 07.03.2011 1. Sichtbarkeitsproblem beim Rendern einer dreidimensionalen Szene auf einer zweidimensionalen Anzeigefläche (a) Worin besteht das Sichtbarkeitsproblem?
3D-Rendering Ulf Döring, Markus Färber 07.03.2011 1. Sichtbarkeitsproblem beim Rendern einer dreidimensionalen Szene auf einer zweidimensionalen Anzeigefläche (a) Worin besteht das Sichtbarkeitsproblem?
Workshop: Einführung in die 3D-Computergrafik. Julia Tolksdorf Thies Pfeiffer Christian Fröhlich Nikita Mattar
 Workshop: Einführung in die 3D-Computergrafik Julia Tolksdorf Thies Pfeiffer Christian Fröhlich Nikita Mattar 1 Organisatorisches Tagesablauf: Vormittags: Theoretische Grundlagen Nachmittags: Bearbeitung
Workshop: Einführung in die 3D-Computergrafik Julia Tolksdorf Thies Pfeiffer Christian Fröhlich Nikita Mattar 1 Organisatorisches Tagesablauf: Vormittags: Theoretische Grundlagen Nachmittags: Bearbeitung
Graphische Datenverarbeitung und Bildverarbeitung
 Graphische Datenverarbeitung und Bildverarbeitung Hochschule Niederrhein Shading-Verfahren Graphische DV und BV, Regina Pohle, 22. Shading-Verfahren Einordnung in die Inhalte der Vorlesung Einführung mathematische
Graphische Datenverarbeitung und Bildverarbeitung Hochschule Niederrhein Shading-Verfahren Graphische DV und BV, Regina Pohle, 22. Shading-Verfahren Einordnung in die Inhalte der Vorlesung Einführung mathematische
Globale Beleuchtung. Thorsten Grosch. Thorsten Grosch Seit September 2009 Juniorprofessor für CV in Magdeburg
 Praktikum Globale Beleuchtung Thorsten Grosch Wer bin ich Thorsten Grosch Seit September 2009 Juniorprofessor für CV in Magdeburg g Davor Studium Informatik TU Darmstadt Fraunhofer IGD Lichtsimulation
Praktikum Globale Beleuchtung Thorsten Grosch Wer bin ich Thorsten Grosch Seit September 2009 Juniorprofessor für CV in Magdeburg g Davor Studium Informatik TU Darmstadt Fraunhofer IGD Lichtsimulation
6 Licht, Schatten und die Welt
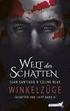 151 6 Licht, Schatten und die Welt Ein nicht zu unterschätzender Teil einer guten Animation oder statischen 3D-Szene wird durch die Beleuchtung vorgegeben. Hierbei ist ähnlich wie bei Film und Fernsehen
151 6 Licht, Schatten und die Welt Ein nicht zu unterschätzender Teil einer guten Animation oder statischen 3D-Szene wird durch die Beleuchtung vorgegeben. Hierbei ist ähnlich wie bei Film und Fernsehen
C# Programm: Raytracer (3D Renderer)
 C# Programm: Raytracer (3D Renderer) Hiermit verbrachten wir die letzte Einheit in C# des Informatikunterrichtes. Dieser Raytracer ist ein Programm, das nur mit wenigen Informationen über einen Raum, der
C# Programm: Raytracer (3D Renderer) Hiermit verbrachten wir die letzte Einheit in C# des Informatikunterrichtes. Dieser Raytracer ist ein Programm, das nur mit wenigen Informationen über einen Raum, der
12. Globale Beleuchtungsmodelle (Raytracing, Radiosity)
 12. Globale Beleuchtungsmodelle (Raytracing, Radiosity) "globale" Verfahren: bei Beleuchtungsrechnung für einen Punkt wird (potenziell) die gesamte Szene mit einbezogen Einsatz bei angestrebtem hohen Grad
12. Globale Beleuchtungsmodelle (Raytracing, Radiosity) "globale" Verfahren: bei Beleuchtungsrechnung für einen Punkt wird (potenziell) die gesamte Szene mit einbezogen Einsatz bei angestrebtem hohen Grad
19.09.2014. 2D-Texturen. Reflectance Mapping 3D-Texturen. Farbtexturen
 2D-Texturen Texturarten Transformationen Generierung Thomas Jung Reflectance Mapping 3D-Texturen Modellierung von Details erfordert Zeit Darstellung ist aufwendig (langsam) Details belegen Speicherplatz
2D-Texturen Texturarten Transformationen Generierung Thomas Jung Reflectance Mapping 3D-Texturen Modellierung von Details erfordert Zeit Darstellung ist aufwendig (langsam) Details belegen Speicherplatz
Kapitel 0. Einführung. 0.1 Was ist Computergrafik? 0.2 Anwendungsgebiete
 Kapitel 0 Einführung 0.1 Was ist Computergrafik? Software, die einen Computer dazu bringt, eine grafische Ausgabe (oder kurz gesagt: Bilder) zu produzieren. Bilder können sein: Fotos, Schaltpläne, Veranschaulichung
Kapitel 0 Einführung 0.1 Was ist Computergrafik? Software, die einen Computer dazu bringt, eine grafische Ausgabe (oder kurz gesagt: Bilder) zu produzieren. Bilder können sein: Fotos, Schaltpläne, Veranschaulichung
Global Illumination Globale Beleuchtung
 Global Illumination Globale Beleuchtung 1 Reale Szenen = komplexe Lichtsituation Licht & Schatten Reflexionen Colorbleeding Kaustiken, Nebel, http://gurneyjourney.blogspot.com/ 2 Walter Zatta 3 SATtva
Global Illumination Globale Beleuchtung 1 Reale Szenen = komplexe Lichtsituation Licht & Schatten Reflexionen Colorbleeding Kaustiken, Nebel, http://gurneyjourney.blogspot.com/ 2 Walter Zatta 3 SATtva
Texture Based Direct Volume Rendering
 Texture Based Direct Volume Rendering Vorlesung: "Advanced Topics in Computer Graphics" cbrak@upb.de 1 Agenda 1. Einleitung Volume Rendering 1.1. Volumendatensatz 1.2. Volumenintegral 1.3. Image order
Texture Based Direct Volume Rendering Vorlesung: "Advanced Topics in Computer Graphics" cbrak@upb.de 1 Agenda 1. Einleitung Volume Rendering 1.1. Volumendatensatz 1.2. Volumenintegral 1.3. Image order
3D rendering. Introduction and interesting algorithms. PHP Usergroup Dortmund, Dortmund, 2006-12-14. Kore Nordmann <kore@php.net>
 3D rendering Introduction and interesting algorithms PHP Usergroup Dortmund, Dortmund, 2006-12-14 Kore Nordmann Speaker Kore Nordmann Studies computer science at the University Dortmund
3D rendering Introduction and interesting algorithms PHP Usergroup Dortmund, Dortmund, 2006-12-14 Kore Nordmann Speaker Kore Nordmann Studies computer science at the University Dortmund
(1) Einführung. Vorlesung CV-Integration S. Müller/D. Paulus U N I V E R S I T Ä T KOBLENZ LANDAU
 (1) Einführung Vorlesung CV-Integration S. Müller/D. Paulus KOBLENZ LANDAU Ziel In vielen Bereichen der Forschung und auch der täglichen Anwendungen wächst das Fachgebiet der Bildverarbeitung und der Computergraphik
(1) Einführung Vorlesung CV-Integration S. Müller/D. Paulus KOBLENZ LANDAU Ziel In vielen Bereichen der Forschung und auch der täglichen Anwendungen wächst das Fachgebiet der Bildverarbeitung und der Computergraphik
Real-Time High-Dynamic Range Texture Mapping
 Real-Time High-Dynamic Range Texture Mapping Jonathen Cohen, Chris Tchou, Tim Hawkins and Paul Debevec Präsentiert von Daniel Wickeroth Einführung Worum geht s? Darstellung realistischer Szenen Innen -
Real-Time High-Dynamic Range Texture Mapping Jonathen Cohen, Chris Tchou, Tim Hawkins and Paul Debevec Präsentiert von Daniel Wickeroth Einführung Worum geht s? Darstellung realistischer Szenen Innen -
Qualitäts- und Prozesskontrolle gedruckter Interferenzeffektfarben erster Generation
 Qualitäts- und Prozesskontrolle gedruckter Interferenzeffektfarben erster Generation Dr.-Ing. Heike Hupp VDD-Seminarvortrag 1 Interferenzeffektpigmente der ersten Generation Effekte natürlicher Perlen
Qualitäts- und Prozesskontrolle gedruckter Interferenzeffektfarben erster Generation Dr.-Ing. Heike Hupp VDD-Seminarvortrag 1 Interferenzeffektpigmente der ersten Generation Effekte natürlicher Perlen
Shader für Geometrische Grundprimitive. Beispielszene mit vielen Kegeln unterschiedlicher Größe und Farbe
 Shader für Geometrische Grundprimitive Beispielszene mit vielen Kegeln unterschiedlicher Größe und Farbe 0. Gliederung Gliederung: 1. Motivation 2. Verwandte Arbeiten 3. Überblick über das Vorgehen 3.1
Shader für Geometrische Grundprimitive Beispielszene mit vielen Kegeln unterschiedlicher Größe und Farbe 0. Gliederung Gliederung: 1. Motivation 2. Verwandte Arbeiten 3. Überblick über das Vorgehen 3.1
Non-Photorealistic Rendering
 Übersicht 1. Motivation und Anwendungen 2. Techniken - Cel Shading - Konturlinien - Hatching Einführung Traditionelle Computergraphik Ziel: Fotorealismus Einführung Motivation Bewusste Vermeidung von
Übersicht 1. Motivation und Anwendungen 2. Techniken - Cel Shading - Konturlinien - Hatching Einführung Traditionelle Computergraphik Ziel: Fotorealismus Einführung Motivation Bewusste Vermeidung von
Übung Elementarmathematik im WS 2012/13. Lösung zum Klausurvorbereitung IV
 Technische Universität Chemnitz Fakultät für Mathematik Dr. Uwe Streit Jan Blechschmidt Aufgabenkomplex 7 - Vektoren Übung Elementarmathematik im WS 202/3 Lösung zum Klausurvorbereitung IV. (5 Punkte -
Technische Universität Chemnitz Fakultät für Mathematik Dr. Uwe Streit Jan Blechschmidt Aufgabenkomplex 7 - Vektoren Übung Elementarmathematik im WS 202/3 Lösung zum Klausurvorbereitung IV. (5 Punkte -
Der Einsatz von HDRIs in LightWave 7
 Seite 1 DOSCH DESIGN TUTORIAL Der Einsatz von HDRIs in LightWave 7 Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung LightWave kann ab der Version 6.5 HDRIs (High Dynamic Range Images) als Beleuchtung und Hintergrund
Seite 1 DOSCH DESIGN TUTORIAL Der Einsatz von HDRIs in LightWave 7 Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung LightWave kann ab der Version 6.5 HDRIs (High Dynamic Range Images) als Beleuchtung und Hintergrund
computer graphics & visualization
 Entwicklung und Implementierung echtzeitfähiger Verfahren zur Darstellung von reflektierenden Objekten auf GPUs echtzeitfähiger Verfahren zur Darstellung von reflektierenden Objekten auf GPUs Motivation
Entwicklung und Implementierung echtzeitfähiger Verfahren zur Darstellung von reflektierenden Objekten auf GPUs echtzeitfähiger Verfahren zur Darstellung von reflektierenden Objekten auf GPUs Motivation
Visualisierung mit TurboCAD
 Frank Sattler Visualisierung mit TurboCAD ab Version 10 Professional Erste Schritte / Überblick Inhalt Kriterien für Visualisierung Anforderungen an die 3D-Modellierung Eigenschaften der 3D-Objekte Gegenüberstellung
Frank Sattler Visualisierung mit TurboCAD ab Version 10 Professional Erste Schritte / Überblick Inhalt Kriterien für Visualisierung Anforderungen an die 3D-Modellierung Eigenschaften der 3D-Objekte Gegenüberstellung
FARBE 1 6. InDesign cs6. Additive und subtraktive Farbmischung Additive Farbmischung = Das Mischen von farbigem Licht.
 1 6 Additive und subtraktive Farbmischung Additive Farbmischung = Das Mischen von farbigem Licht. Wenn zwei Taschenlampen auf ein und dieselbe Fläche gehalten werden, so wird diese Fläche heller beleuchtet,
1 6 Additive und subtraktive Farbmischung Additive Farbmischung = Das Mischen von farbigem Licht. Wenn zwei Taschenlampen auf ein und dieselbe Fläche gehalten werden, so wird diese Fläche heller beleuchtet,
Lichttechnische Simulation von LED-Leuchten
 Lichttechnische Simulation von LED-Leuchten Licht@hslu Wirkung Energie - Funktion Erny Niederberger Technik & Architektur, CC IIEE Zürich, 18. Sept. 2012 Licht@hslu CC IIEE Niederberger I 1 Optische Simulation
Lichttechnische Simulation von LED-Leuchten Licht@hslu Wirkung Energie - Funktion Erny Niederberger Technik & Architektur, CC IIEE Zürich, 18. Sept. 2012 Licht@hslu CC IIEE Niederberger I 1 Optische Simulation
Proseminar Computergraphik. Raytracing
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN FAKULTÄT INFORMATIK INSTITUT FÜR SOFTWARE- UND MULTIMEDIATECHNIK PROFESSUR FÜR COMPUTERGRAPHIK UND VISUALISIERUNG PROF. DR. STEFAN GUMHOLD Proseminar Computergraphik Raytracing
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN FAKULTÄT INFORMATIK INSTITUT FÜR SOFTWARE- UND MULTIMEDIATECHNIK PROFESSUR FÜR COMPUTERGRAPHIK UND VISUALISIERUNG PROF. DR. STEFAN GUMHOLD Proseminar Computergraphik Raytracing
18.Elektromagnetische Wellen 19.Geometrische Optik. Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht. EPI WS 2006/7 Dünnweber/Faessler
 Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht Ausbreitung von Licht Verschiedene Beschreibungen je nach Größe des leuchtenden (oder beleuchteten) Objekts relativ zur Wellenlänge a) Geometrische Optik: Querdimension
Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht Ausbreitung von Licht Verschiedene Beschreibungen je nach Größe des leuchtenden (oder beleuchteten) Objekts relativ zur Wellenlänge a) Geometrische Optik: Querdimension
Advanced Rendering Interior Szene
 Advanced Rendering Interior Szene in Cinema 4D 11-11.5 Als erstes, sollten Sie ihre Szene in Cinema 4D öffnen. vergewissern sie sich, ob alle Licht quellen die evtl. mit importiert wurden, aus der Szene
Advanced Rendering Interior Szene in Cinema 4D 11-11.5 Als erstes, sollten Sie ihre Szene in Cinema 4D öffnen. vergewissern sie sich, ob alle Licht quellen die evtl. mit importiert wurden, aus der Szene
Seminar Game Development Game Computer Graphics. Einleitung
 Einleitung Gliederung OpenGL Realismus Material Beleuchtung Schatten Echtzeit Daten verringern Grafik Hardware Beispiel CryEngine 2 Kristian Keßler OpenGL Was ist OpenGL? Grafik API plattform- und programmiersprachenunabhängig
Einleitung Gliederung OpenGL Realismus Material Beleuchtung Schatten Echtzeit Daten verringern Grafik Hardware Beispiel CryEngine 2 Kristian Keßler OpenGL Was ist OpenGL? Grafik API plattform- und programmiersprachenunabhängig
Inhaltsverzeichnis - Themen
 Inhaltsverzeichnis - Themen 1 Hardwaregrundlagen 2 Transformationen und Projektionen 3 Repräsentation und Modellierung von Objekten 4 Visibilität und Verdeckung 5 Rasterung 6 Rendering 7 Abbildungsverfahren
Inhaltsverzeichnis - Themen 1 Hardwaregrundlagen 2 Transformationen und Projektionen 3 Repräsentation und Modellierung von Objekten 4 Visibilität und Verdeckung 5 Rasterung 6 Rendering 7 Abbildungsverfahren
Die Interpretation Optischer Leistungsdaten
 Die Interpretation Optischer Leistungsdaten Einige Fakten über die Carl Zeiss AG Seit 1896 berühmt für Kamera-Objektive Zeiss 1846 von Carl Zeiss gegründet 48 Produktionsstandorte weltweit Die ersten Kamerabilder
Die Interpretation Optischer Leistungsdaten Einige Fakten über die Carl Zeiss AG Seit 1896 berühmt für Kamera-Objektive Zeiss 1846 von Carl Zeiss gegründet 48 Produktionsstandorte weltweit Die ersten Kamerabilder
Nichtrealistische Darstellung von Gebirgen mit OpenGL
 Nichtrealistische Darstellung von Gebirgen mit OpenGL Großer Beleg Torsten Keil Betreuer: Prof. Deussen Zielstellung Entwicklung eines Algorithmus, der die 3D- Daten einer Geometrie in eine nichtrealistische
Nichtrealistische Darstellung von Gebirgen mit OpenGL Großer Beleg Torsten Keil Betreuer: Prof. Deussen Zielstellung Entwicklung eines Algorithmus, der die 3D- Daten einer Geometrie in eine nichtrealistische
Prüfungsteil 2, Aufgabe 4 Analytische Geometrie
 Abitur Mathematik: Prüfungsteil, Aufgabe 4 Analytische Geometrie Nordrhein-Westfalen 0 LK Aufgabe a (). SCHRITT: MITTELPUNKT DER GRUNDFLÄCHE BERECHNEN Die Spitze befindet sich einen Meter senkrecht über
Abitur Mathematik: Prüfungsteil, Aufgabe 4 Analytische Geometrie Nordrhein-Westfalen 0 LK Aufgabe a (). SCHRITT: MITTELPUNKT DER GRUNDFLÄCHE BERECHNEN Die Spitze befindet sich einen Meter senkrecht über
Färben, texturieren und rendern in Solid Edge
 Färben, texturieren und rendern in Solid Edge Man kann den Objekten in Solid Edge Farben geben, transparent oder opak und Texturen. Das sind Bilder die auf die Oberflächen aufgelegt werden. Dabei bekommt
Färben, texturieren und rendern in Solid Edge Man kann den Objekten in Solid Edge Farben geben, transparent oder opak und Texturen. Das sind Bilder die auf die Oberflächen aufgelegt werden. Dabei bekommt
elaspix Real-Live-Fotos mit Artificial-3D-Stills kombinieren Tobias Günther
 Real-Live-Fotos mit Artificial-3D-Stills kombinieren Tobias Günther Übersicht Flexibilität von 3D-Modellen Realismus der Realität Motivation Kombination von CGI und Fotos Was war mir wichtig Wie bin ich
Real-Live-Fotos mit Artificial-3D-Stills kombinieren Tobias Günther Übersicht Flexibilität von 3D-Modellen Realismus der Realität Motivation Kombination von CGI und Fotos Was war mir wichtig Wie bin ich
Interaktive. mit der GPU
 Interaktive Augmentierte Bildsynthese mit der GPU 17. Vorlesung Photorealistische Computergrafik Thorsten Grosch Einleitung Bisher Korrekte Erweiterung von Fotos möglich mit differentiellem Rendering Erweiterung
Interaktive Augmentierte Bildsynthese mit der GPU 17. Vorlesung Photorealistische Computergrafik Thorsten Grosch Einleitung Bisher Korrekte Erweiterung von Fotos möglich mit differentiellem Rendering Erweiterung
Volumen Visualisierung
 Volumen Visualisierung Seminar Interaktive Visualisierung (WS 06/07) Fabian Spiegel und Christian Meß Fabian Spiegel und Christian Meß 1 Übersicht Anwendungsbeispiele Volumendaten Entstehung Repräsentation
Volumen Visualisierung Seminar Interaktive Visualisierung (WS 06/07) Fabian Spiegel und Christian Meß Fabian Spiegel und Christian Meß 1 Übersicht Anwendungsbeispiele Volumendaten Entstehung Repräsentation
8 Cycles. ein GUI-basierter Ansatz wie bei den Blender-Intern-Materialien.
 301 Cycles ist die seit Blender 2.61 verfügbare physikbasierte Renderengine. Hauptentwickler ist Brecht van Lommel, der schon lange die interne Renderengine in Blender betreut. Nachdem Blender Intern mit
301 Cycles ist die seit Blender 2.61 verfügbare physikbasierte Renderengine. Hauptentwickler ist Brecht van Lommel, der schon lange die interne Renderengine in Blender betreut. Nachdem Blender Intern mit
III. Elektrizität und Magnetismus Anhang zu 21. Wechselstrom: Hochspannungsleitung 22. Elektromagnetische Wellen
 21. Vorlesung EP III. Elektrizität und Magnetismus Anhang zu 21. Wechselstrom: Hochspannungsleitung 22. Elektromagnetische Wellen IV Optik 22. Fortsetzung: Licht = sichtbare elektromagnetische Wellen 23.
21. Vorlesung EP III. Elektrizität und Magnetismus Anhang zu 21. Wechselstrom: Hochspannungsleitung 22. Elektromagnetische Wellen IV Optik 22. Fortsetzung: Licht = sichtbare elektromagnetische Wellen 23.
Zur Aufgabe 16 (Blatt 11)
 Grafische Datenverarbeitung: Grundlagen Sommersemester 2004 Frieder Nake & Andreas Genz 22.7.2005 Zur Aufgabe 16 (Blatt 11) Mit der letzten Aufgabe, Blatt 11 mit Aufgabe 16, wollten wir Euch mit einer
Grafische Datenverarbeitung: Grundlagen Sommersemester 2004 Frieder Nake & Andreas Genz 22.7.2005 Zur Aufgabe 16 (Blatt 11) Mit der letzten Aufgabe, Blatt 11 mit Aufgabe 16, wollten wir Euch mit einer
Landesabitur 2007 Beispielaufgaben 2005_M-LK_A 7. Eine quadratische Pyramide (Grundkante 4 und Höhe 6) steht neben einer Stufe. 1.
 I. Thema und Aufgabenstellung Lineare Algebra / Analytische Geometrie Aufgaben Eine quadratische Pyramide (Grundkante 4 und Höhe 6) steht neben einer Stufe. 3. Achse 2. Achse 1. Achse Die Sonne scheint
I. Thema und Aufgabenstellung Lineare Algebra / Analytische Geometrie Aufgaben Eine quadratische Pyramide (Grundkante 4 und Höhe 6) steht neben einer Stufe. 3. Achse 2. Achse 1. Achse Die Sonne scheint
RTT DeltaGen Suite. Materialeinstellungen für OpenGL, RTT RealTrace & Global illumination. Copyright 2010 by Realtime Technology AG
 RTT DeltaGen Suite Materialeinstellungen für OpenGL, RTT RealTrace & Global illumination Copyright 2010 by Realtime Technology AG Look Editor Der Look Editor zeigt die Eigenschaften des Looks des selektierten
RTT DeltaGen Suite Materialeinstellungen für OpenGL, RTT RealTrace & Global illumination Copyright 2010 by Realtime Technology AG Look Editor Der Look Editor zeigt die Eigenschaften des Looks des selektierten
Maturitätsprüfung Mathematik
 Maturitätsprüfung 007 Mathematik Klasse 4bN Kantonsschule Solothurn Mathematisch-naturwissenschaftliches Maturitätsprofil Name: Note: Hinweise zur Bearbeitung der Prüfung: Zur Lösung der Aufgaben stehen
Maturitätsprüfung 007 Mathematik Klasse 4bN Kantonsschule Solothurn Mathematisch-naturwissenschaftliches Maturitätsprofil Name: Note: Hinweise zur Bearbeitung der Prüfung: Zur Lösung der Aufgaben stehen
Überblick Echtzeit-Rendering. Uwe Domaratius dou@hrz.tu-chemnitz.de
 Überblick Echtzeit-Rendering Uwe Domaratius dou@hrz.tu-chemnitz.de Gliederung 1. Einleitung 2. geometriebasierende Verbesserungen 3. Level-of-Detail 4. Culling 5. Texturen 6. bildbasiertes Rendering Was
Überblick Echtzeit-Rendering Uwe Domaratius dou@hrz.tu-chemnitz.de Gliederung 1. Einleitung 2. geometriebasierende Verbesserungen 3. Level-of-Detail 4. Culling 5. Texturen 6. bildbasiertes Rendering Was
Prüfungsteil 2, Aufgabe 4 Analytische Geometrie
 Abitur Mathematik: Prüfungsteil, Aufgabe 4 Analytische Geometrie Nordrhein-Westfalen 0 GK Aufgabe a (). SCHRITT: MITTELPUNKT DER GRUNDFLÄCHE BERECHNEN Die Spitze befindet sich einen Meter senkrecht über
Abitur Mathematik: Prüfungsteil, Aufgabe 4 Analytische Geometrie Nordrhein-Westfalen 0 GK Aufgabe a (). SCHRITT: MITTELPUNKT DER GRUNDFLÄCHE BERECHNEN Die Spitze befindet sich einen Meter senkrecht über
LUMIMAX Beleuchtungsworkshop. iim AG 19.03.2015
 LUMIMAX Beleuchtungsworkshop iim AG 19.03.2015 Bedeutung der Beleuchtung Der Einfluss der Beleuchtung auf die Bildverarbeitungslösung wird häufig unterschätzt. Jede BV-Applikation benötigt ein optimales
LUMIMAX Beleuchtungsworkshop iim AG 19.03.2015 Bedeutung der Beleuchtung Der Einfluss der Beleuchtung auf die Bildverarbeitungslösung wird häufig unterschätzt. Jede BV-Applikation benötigt ein optimales
Welche Strahlen werden durch die Erdatmosphäre abgeschirmt? Welche Moleküle beeinflussen wesentlich die Strahlendurchlässigkeit der Atmosphäre?
 Spektren 1 Welche Strahlen werden durch die Erdatmosphäre abgeschirmt? Welche Moleküle beeinflussen wesentlich die Strahlendurchlässigkeit der Atmosphäre? Der UV- und höherenergetische Anteil wird fast
Spektren 1 Welche Strahlen werden durch die Erdatmosphäre abgeschirmt? Welche Moleküle beeinflussen wesentlich die Strahlendurchlässigkeit der Atmosphäre? Der UV- und höherenergetische Anteil wird fast
Grundlagen der Vektorrechnung
 Grundlagen der Vektorrechnung Ein Vektor a ist eine geordnete Liste von n Zahlen Die Anzahl n dieser Zahlen wird als Dimension des Vektors bezeichnet Schreibweise: a a a R n Normale Reelle Zahlen nennt
Grundlagen der Vektorrechnung Ein Vektor a ist eine geordnete Liste von n Zahlen Die Anzahl n dieser Zahlen wird als Dimension des Vektors bezeichnet Schreibweise: a a a R n Normale Reelle Zahlen nennt
Diplomarbeit. Verbesserung der Darstellungsqualität einer texturbasierten Volumenvisualisierung unter Verwendung moderner Shadertechnologie
 Diplomarbeit Verbesserung der Darstellungsqualität einer texturbasierten Volumenvisualisierung unter Verwendung moderner Shadertechnologie Oliver Nacke Mat.Nr.:4200148 Rudolf-Breitscheidt Straße 83 67655
Diplomarbeit Verbesserung der Darstellungsqualität einer texturbasierten Volumenvisualisierung unter Verwendung moderner Shadertechnologie Oliver Nacke Mat.Nr.:4200148 Rudolf-Breitscheidt Straße 83 67655
Die Konstruktion der Schnittgeraden zweier Ebenen ist auf unterschiedliche Art und Weise möglich:
 Ebene Ebene Zwei Ebenen sind entweder Elemente eines Parallelenebenenbüschels oder sie schneiden einander. Im letzteren Fall existiert eine eindeutig bestimmte eigentliche Gerade als Schnittmenge beider
Ebene Ebene Zwei Ebenen sind entweder Elemente eines Parallelenebenenbüschels oder sie schneiden einander. Im letzteren Fall existiert eine eindeutig bestimmte eigentliche Gerade als Schnittmenge beider
Graphische Datenverarbeitung. Graphische Objekte und deren Programmierung. Prof. Dr. Elke Hergenröther. h_da
 Graphische Datenverarbeitung Graphische Objekte und deren Programmierung Prof. Dr. Elke Hergenröther h_da Besuchen Sie die Vorlesung! Warum? Wichtige Hinweise: Das Skript und die Folien sind nur eine Zusammenfassung
Graphische Datenverarbeitung Graphische Objekte und deren Programmierung Prof. Dr. Elke Hergenröther h_da Besuchen Sie die Vorlesung! Warum? Wichtige Hinweise: Das Skript und die Folien sind nur eine Zusammenfassung
Christina Nell 3D-Computergrafik Seminararbeit im Hauptseminar Grafikprogrammierung. Universität Ulm Sommersemester 2008
 Christina Nell 3D-Computergrafik Seminararbeit im Hauptseminar Grafikprogrammierung Universität Ulm Sommersemester 2008 1 Inhalt 1 Einleitung 3 2 Beleuchtung 2.1 Grundlagen 2.2 Beleuchtung 2.3 Shading
Christina Nell 3D-Computergrafik Seminararbeit im Hauptseminar Grafikprogrammierung Universität Ulm Sommersemester 2008 1 Inhalt 1 Einleitung 3 2 Beleuchtung 2.1 Grundlagen 2.2 Beleuchtung 2.3 Shading
Was ist der Farbwiedergabeindex?
 Was ist der Farbwiedergabeindex? Das Licht bestimmt die Farbe Unter der Farbwiedergabe einer Lichtquelle versteht man deren Eigenschaft, welche Farberscheinung ihr Licht auf Gegenständen bewirkt. Farbwiedergabe
Was ist der Farbwiedergabeindex? Das Licht bestimmt die Farbe Unter der Farbwiedergabe einer Lichtquelle versteht man deren Eigenschaft, welche Farberscheinung ihr Licht auf Gegenständen bewirkt. Farbwiedergabe
Skalierbarkeit virtueller Welten
 $86=8*'(5 )2/,(1 9505 9RUOHVXQJ Dr. Ralf Dörner *RHWKH8QLYHUVLWlWÃ)UDQNIXUW *UDSKLVFKHÃ'DWHQYHUDUEHLWXQJ hehueolfn Der Begriff VR Perspektivisches Sehen in 3D Skalierbarkeit virtueller Welten Echtzeitanforderungen
$86=8*'(5 )2/,(1 9505 9RUOHVXQJ Dr. Ralf Dörner *RHWKH8QLYHUVLWlWÃ)UDQNIXUW *UDSKLVFKHÃ'DWHQYHUDUEHLWXQJ hehueolfn Der Begriff VR Perspektivisches Sehen in 3D Skalierbarkeit virtueller Welten Echtzeitanforderungen
Bernhard Hill Forschungsgruppe Farbwissenschaft Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik RWTH Aachen University Hill@ite.rwth-aachen.
 Bernhard Hill Forschungsgruppe Farbwissenschaft Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik RWTH Aachen University Hill@ite.rwth-aachen.de Sl jl Ziel der Studie Die Farbwahrnehmung einer Oberflächenfarbe
Bernhard Hill Forschungsgruppe Farbwissenschaft Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik RWTH Aachen University Hill@ite.rwth-aachen.de Sl jl Ziel der Studie Die Farbwahrnehmung einer Oberflächenfarbe
Fakultät für Informatik. Non-Photorealistic Rendering
 Technische Universität München Fakultät für Informatik Seminar How to make a PIXAR movie Non-Photorealistic Rendering Johannes Schamburger Abstract Non-Photorealistic Rendering (NPR) ist ein Teilbereich
Technische Universität München Fakultät für Informatik Seminar How to make a PIXAR movie Non-Photorealistic Rendering Johannes Schamburger Abstract Non-Photorealistic Rendering (NPR) ist ein Teilbereich
Photon Mapping. 9. Vorlesung
 Photon Mapping 9. Vorlesung Photorealistische Computergrafik Thorsten Grosch Einleitung Bisher Lösung der Rendering Equation durch Path Tracing Heute Alle Lichteffekte sind möglich Aber: Sehr langsam und
Photon Mapping 9. Vorlesung Photorealistische Computergrafik Thorsten Grosch Einleitung Bisher Lösung der Rendering Equation durch Path Tracing Heute Alle Lichteffekte sind möglich Aber: Sehr langsam und
NÜTZLICHE TIPPS FÜR OPTIMALE SCANS
 Bedingungen, um gute Scans zu erhalten Die Faktoren, von denen das Ergebnis eines Scans abhängt, sind einerseits die Umgebung sowie die Konfiguration und Kalibrierung des Scanners, aber auch das zu scannende
Bedingungen, um gute Scans zu erhalten Die Faktoren, von denen das Ergebnis eines Scans abhängt, sind einerseits die Umgebung sowie die Konfiguration und Kalibrierung des Scanners, aber auch das zu scannende
Automatisch-generierte Texturen aus Laserpunktwolken
 Automatisch-generierte Texturen aus Laserpunktwolken Sharon Friedrich, Maik Häsner Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Interdisziplinäres Zentrum für wissenschaftliches Rechnen (IWR) Softwarepraktikum
Automatisch-generierte Texturen aus Laserpunktwolken Sharon Friedrich, Maik Häsner Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Interdisziplinäres Zentrum für wissenschaftliches Rechnen (IWR) Softwarepraktikum
Rendering. Ein kurzer Überblick. Hochschule Rhein-Main Fachseminar WS 09/10 Betreuender Dozent: Prof. Dr. Karl-Otto Linn.
 Hochschule Rhein-Main Fachseminar WS 09/10 Betreuender Dozent: Prof. Dr. Karl-Otto Linn Rendering Ein kurzer Überblick von Manuel Päßler Matrikelnr.: 355927 Inhaltsverzeichnis I. Definition des Begriffs
Hochschule Rhein-Main Fachseminar WS 09/10 Betreuender Dozent: Prof. Dr. Karl-Otto Linn Rendering Ein kurzer Überblick von Manuel Päßler Matrikelnr.: 355927 Inhaltsverzeichnis I. Definition des Begriffs
Photometrie. EPD.06 Photometrie.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit
 1 EPD.06.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit H. Krueger 6. 6.1 Umrechnung physikalischer in photometrische Grössen Physikalische Grössen werden mittels der spektralen Empfindlichkeitskurve des menschlichen
1 EPD.06.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit H. Krueger 6. 6.1 Umrechnung physikalischer in photometrische Grössen Physikalische Grössen werden mittels der spektralen Empfindlichkeitskurve des menschlichen
Softwareprojekt Spieleentwicklung
 Softwareprojekt Spieleentwicklung Prototyp I (2D) Prototyp II (3D) Softwareprojekt 12.04. 19.04. 26.04. 03.05. 31.05. Meilenstein I 28.06. Meilenstein II Prof. Holger Theisel, Tobias Günther, OvGU Magdeburg
Softwareprojekt Spieleentwicklung Prototyp I (2D) Prototyp II (3D) Softwareprojekt 12.04. 19.04. 26.04. 03.05. 31.05. Meilenstein I 28.06. Meilenstein II Prof. Holger Theisel, Tobias Günther, OvGU Magdeburg
Physik Übungen - Stundenthema Licht und Reflexion - A.M. - E.C.
 Physik Übungen - Stundenthema Licht und Reflexion - A.M. - E.C. 1. Übersicht - Stundenthema Unterrichts- Versuchsablauf wurde anhand der hochgeladenen Prezi Datei vorgestellt. Erfahrungen bezugnehmend
Physik Übungen - Stundenthema Licht und Reflexion - A.M. - E.C. 1. Übersicht - Stundenthema Unterrichts- Versuchsablauf wurde anhand der hochgeladenen Prezi Datei vorgestellt. Erfahrungen bezugnehmend
Raytracing. Ausarbeitung zum Seminarvortrag Raytracing am 01.07.2011. Proseminar How to make a Pixar Movie. Technische Universität München
 Raytracing Ausarbeitung zum Seminarvortrag Raytracing am 01.07.2011 Proseminar How to make a Pixar Movie Technische Universität München Sebastian Wiendl Betreuer: Dipl.-Inf. Matthäus G. Chajdas Inhaltsverzeichnis
Raytracing Ausarbeitung zum Seminarvortrag Raytracing am 01.07.2011 Proseminar How to make a Pixar Movie Technische Universität München Sebastian Wiendl Betreuer: Dipl.-Inf. Matthäus G. Chajdas Inhaltsverzeichnis
Konzepte für 3D Produktionen
 Konzepte für 3D Produktionen»Luxo Jr.«(Pixar 1986)»Tin Toy«(Pixar 1988)»Geri s Game«(Pixar 1997) FHTW Berlin»Studiengang Internationale Medieninformatik«Doz. Michael Herzog/Stephan Hübener 1 Konzepte 3D
Konzepte für 3D Produktionen»Luxo Jr.«(Pixar 1986)»Tin Toy«(Pixar 1988)»Geri s Game«(Pixar 1997) FHTW Berlin»Studiengang Internationale Medieninformatik«Doz. Michael Herzog/Stephan Hübener 1 Konzepte 3D
Thema: Ein Ausblick auf die Möglichkeiten durch den Software-Einsatz im Mathematikunterricht.
 Vorlesung 2 : Do. 10.04.08 Thema: Ein Ausblick auf die Möglichkeiten durch den Software-Einsatz im Mathematikunterricht. Einführung in GeoGebra: Zunächst eine kleine Einführung in die Benutzeroberfläche
Vorlesung 2 : Do. 10.04.08 Thema: Ein Ausblick auf die Möglichkeiten durch den Software-Einsatz im Mathematikunterricht. Einführung in GeoGebra: Zunächst eine kleine Einführung in die Benutzeroberfläche
Computer Graphik I (3D) Dateneingabe
 Computer Graphik I (3D) Dateneingabe 1 3D Graphik- Pipeline Anwendung 3D Dateneingabe Repräsenta
Computer Graphik I (3D) Dateneingabe 1 3D Graphik- Pipeline Anwendung 3D Dateneingabe Repräsenta
Legt man die vom Betrachter aus gesehen vor den, wird die spätere Konstruktion kleiner als die Risse. Legt man die hinter das Objekt, wird die perspek
 Gegeben ist ein und ein. Der wird auf eine gezeichnet, der unterhalb von dieser in einiger Entfernung und mittig. Parallel zur wird der eingezeichnet. Dieser befindet sich in Augenhöhe. Üblicherweise wird
Gegeben ist ein und ein. Der wird auf eine gezeichnet, der unterhalb von dieser in einiger Entfernung und mittig. Parallel zur wird der eingezeichnet. Dieser befindet sich in Augenhöhe. Üblicherweise wird
Übungen zu Physik 1 für Maschinenwesen
 Physikdepartment E13 WS 2011/12 Übungen zu Physik 1 für Maschinenwesen Prof. Dr. Peter Müller-Buschbaum, Dr. Eva M. Herzig, Dr. Volker Körstgens, David Magerl, Markus Schindler, Moritz v. Sivers Vorlesung
Physikdepartment E13 WS 2011/12 Übungen zu Physik 1 für Maschinenwesen Prof. Dr. Peter Müller-Buschbaum, Dr. Eva M. Herzig, Dr. Volker Körstgens, David Magerl, Markus Schindler, Moritz v. Sivers Vorlesung
Polarisation durch Reflexion
 Version: 27. Juli 2004 Polarisation durch Reflexion Stichworte Erzeugung von polarisiertem Licht, linear, zirkular und elliptisch polarisiertes Licht, Polarisator, Analysator, Polarisationsebene, optische
Version: 27. Juli 2004 Polarisation durch Reflexion Stichworte Erzeugung von polarisiertem Licht, linear, zirkular und elliptisch polarisiertes Licht, Polarisator, Analysator, Polarisationsebene, optische
