Verbreitung und Bestandsdichte
|
|
|
- Simon Morgenstern
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Nutria, Sumpfbiber - Myocastor coypus (Molina, 1782) Verbreitung und Bestandsdichte < 1,0 Ind / 100 ha 1,0-3,0 Ind / 100 ha > 3,0 Ind / 100 ha Die Nutria stammt ursprünglich aus Südamerika. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelangte dieses, zur Familie der Biberratten (Capromyidae) gehörende Nagetier als Farmtier nach Europa und schließlich 1926 auch nach Deutschland. Die bestehenden Populationen sind in erster Linie auf Farmflüchtlinge zurückzuführen. In Sachsen ist die Nutria schwerpunktmäßig um sowie aufwärts der Elbe bis verbreitet. Weitere Vorkommen sind in der westlichen Lausitz sowie bei zu verzeichnen. Art festgestellt: 51 Erfassungsbögen (3,7 %) damit auf 28 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 32 Erfassungsbögen (2,3 %) 2,35 Individuen / 100 ha (Min: 0,13 / Max: 12,50 / s = 2,85)
2 Kapitel 3:Ergebnisse Europäischer Biber - Castor fiber Linnaeus, 1758 Verbreitung und Baudichte < 0,2 Baue / 100 ha 0,2-0,4 Baue / 100 ha > 0,4 Baue / 100 ha Der Biber wurde bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Europa fast vollständig ausgerottet. Reliktpopulationen konnten u.a. an der mittleren Elbe überdauern. Strenge Schutzmaßnahmen und Wiedereinbürgerungsprogramme führten dazu, daß dieses größte europäische Nagetier wieder häufiger angetroffen werden kann. In Sachsen ist der Biber vor allem im Einzugsgebiet von Mulde, Schwarzer Elster und Elbe verbreitet. Der Osten und Südwesten Sachsens konnte hingegen kaum vom Biber zurückerobert werden. Art festgestellt: 74 Erfassungsbögen (5,4 %) damit auf 25 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 47 Erfassungsbögen (3,6 %) 0,41 Baue / 100 ha (Min: 0,07 / Max: 2,40 / s = 0,37)
3 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Feldhase - Lepus europaeus (Pallas, 1758) Verbreitung und Bestandsdichte < 2,0 Ind / 100 ha 2,0-6,0 Ind / 100 ha > 6,0 Ind / 100 ha Beim Feldhasen mußte in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielerorts ein starker Bestandsrückgang festgestellt werden. Die zunehmende Ausräumung der Landschaft, die Intensivierung der Landwirtschaft sowie hoher Prädatorendruck müssen als maßgebliche Faktoren für den starken Rückgang dieser Niederwildart angeführt werden In Sachsen ist der Hase erfreulicherweise noch flächendeckend verbreitet. Dennoch sind die Bestände mit durchschnittlich 3 bis 4 Individuen (100 ha) -1 vergleichsweise gering. Höhere Bestandsdichten sind lediglich im westlichen und südwestlichen Sachsen zu verzeichnen. Art festgestellt: 1238 Erfassungsbögen (90,8 %) damit auf 99 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 433 Erfassungsbögen (31,8 %) 3,74 Individuen / 100 ha (Min: 0,20 / Max: 40,00 / s = 3,86)
4 Kapitel 3:Ergebnisse Wildkaninchen - Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Bestandsdichte < 2,0 Ind / 100 ha 2,0-6,0 Ind / 100 ha > 6,0 Ind / 100 ha Noch drastischer als beim Feldhasen haben die Bestände des Wildkaninchens in der Vergangenheit abgenommen. Als Gründe sind hier vor allem Virusinfektionen wie Myxomatose und Chinaseuche zu nennen. Die sozialen Baubewohner wurden erst ab dem 13., verstärkt aber im 19. Jahrhundert aus dem Mittelmeergebiet in Deutschland angesiedelt. In Sachsen weist die Verbreitungskarte erhebliche Lücken auf. So fehlt das Wildkaninchen im Erzgebirge, dem westlausitzer Bergland und der südlichen Oberlausitz sowie in weiten Teilen des nordsächsischen Hügellandes völlig. Hohe Individuenzahlen konnten für den gesamten Freistaat nicht festgestellt werden. Art festgestellt: 74 Erfassungsbögen (5,43 %) damit auf 39 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 48 Erfassungsbögen (3,52 %) 2,21 Individuen / 100 ha (Min: 0,17 / Max: 11,63 / s = 2,66)
5 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Rotfuchs - Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) I Verbreitung und Baudichte < 0,5 Baue / 100 ha 0,5-1,0 Baue / 100 ha > 1,0 Baue / 100 ha Der Rotfuchs hat wie kaum ein anderes Säugetier vom Menschen profitiert. Als Allesfresser und Nahrungsopportunist meidet er auch die menschliche Nähe nicht. Dieser Hundeartige ist das häufigste Raubtier in Sachsen und ein wesentlicher Prädator für bodennistende Vögel und Säuger. Das Fehlen von Feinden und die deutliche Reduktion von Tollwutübertragung durch Impfungsmaßnahmen hatten eine deutliche Veringerung der natürlichen Mortalitätsrate zur Folge. Selbst die steigende Anzahl an Füchsen, die dem Straßenverkehr zum Opfer fallen, und eine Intensivierung der Jagd (keine Schonzeit) konnten die Bestände nicht wesentlich reduzieren. In Sachsen ist der Fuchs flächendeckend verbreitet. Die mittlere Wurfbaudichte von 0,81 Bauen (100 ha) -1 dürfte eher noch unterhalb der tatsächlichen Baudichte liegen, da die Füchse auch Reisighaufen, einfache Erdspalten oder Gestrüpp zur Reproduktion nutzen, die nicht immer leicht von den Jägern ausfindig gemacht werden können. Entsprechend häufig wurden deshalb auf den Erfassungsbögen nicht die Anzahl der Baue, sondern die absoluten Individuenzahlen angegeben:
6 Kapitel 3:Ergebnisse Rotfuchs - Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) II Bestandsdichte < 2,0 Ind / 100 ha 2,0-4,0 Ind / 100 ha > 4,0 Ind / 100 ha Obwohl bei der Wildtiererfassung nicht ausdrücklich danach gefragt wurde, konnten für 93 Meßtischblätter die Bestandsdichte ermittelt werden. Überdurchschnittlich hohe Bestände zeichneten sich hierbei unter anderem in der Umgebung der größeren Städte ab. So sind um,,, und zum Teil mehr als 4 Individuen (100 ha) -1 festgestellt worden. Art festgestellt: 1336 Erfassungsbögen (98,2 %) damit auf 100 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Bau- bzw Individuendichte: 1150 Erfassungsbögen (84,4 %) a) 0,81 Baue / 100 ha (Min: 0,16 / Max: 3,62 / s = 0,38) b) 3,26 Individuen / 100 ha (Min: 0,42 / Max: 14,12 / s = 2,29)
7 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Marderhund, Enok - Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 Verbreitung und Bestandsdichte < 0,1 Ind / 100 ha 0,1-0,7 Ind / 100 ha > 0,7 / 100 ha Der Marderhund stammt ursprünglich aus Ostasien, wo er das Amur- und Ussuri-Gebiet bis nach Japan und Vietnam besiedelt. Ab 1928 erfolgten mehrere Aussetzungen auf dem europäischen Gebiet der ehemaligen UDSSR, von wo aus er sich kontinuierlich nach Westen und Süden ausbreitete. In Sachsen wurde dieser Hundeartige erstmals 1967 in der Oberlausitz nachgewiesen. Hohe Reproduktionszahlen und die große Anpassungsfähigkeit ließen diesen Neubürger bis heute zu einem festen Bestandteil der heimischen Fauna werden. In Sachsen ist der Marderhund in den östlichen und nördlichen Landesteilen fast flächendeckend vertreten. Die Bestandsdichte ist aber im Vergleich zu Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern noch deutlich niedriger. Art festgestellt: 210 Erfassungsbögen (15,4 %) damit auf 68 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 117 Erfassungsbögen (8,6 %) 0,39 Individuen / 100 ha (Min: 0,01 / Max: 2,08 / s = 0,38)
8 Kapitel 3:Ergebnisse Waschbär - Procyon lotor Linnaeus, 1758 Verbreitung und Bestandsdichte < 0,05 Ind / 100 ha 0,05-0,5 Ind / 100 ha > 0,5 Ind / 100 ha Das autochthone des Waschbären liegt in Nord- und Mittelamerika zwischen Kanada und Panama. In Europa wurde dieser Kleinbär ab den 20iger Jahren in zahlreichen Pelztierfarmen gehalten. Die deutschen Populationen begründen sich in erster Linie auf Farmflüchtlingen, die insbesondere in den Kriegs- und Nachkriegswirren in die Freiheit gelangten. Der Waschbär als Allesfresser profitiert sehr stark vom Menschen und dringt häufig bis in die Siedlungen vor. In Sachsen ist der Waschbär lückenhaft über den gesamten Freistaat verbreitet. Verbreitungsschwerpunkte zeichnen sich in Südwest-Sachsen sowie der Teichlausitz heraus. Mit einem weiteren Ansteigen der Bestände ist zu rechnen. Art festgestellt: 90 Erfassungsbögen (6,6 %) damit auf 35 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 31 Erfassungsbögen (2,3 %) 0,35 Individuen / 100 ha (Min: 0,03 / Max: 1,85 / s = 0,43)
9 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Baum-, Edelmarder - Martes martes (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Bestandsdichte < 0,5 Ind / 100 ha 0,5-1,5 Ind / 100 ha > 1,5 Ind / 100 ha Der Baummarder ist ein typischer Waldbewohner, der sich nur wenig vom Waldrand entfernt. Somit benötigt diese Art vor allem größere, zusammenhängende Waldgebiete. Das Lager des Baummarders befindet sich überwiegend auf Bäumen, so daß sich ein ausreichendes Angebot an Baumhöhlen, Krähennestern und Eichhörnchenkobeln günstig auf die Bestände auswirken kann. In Sachsen ist der Baummarder flächendeckend verbreitet. Mit durchschnittlich weniger als einem Individuum (100 ha) -1 ist die Bestandsdichte innerhalb seines es jedoch überall vergleichsweise niedrig. Art festgestellt: 582 Erfassungsbögen (42,7 %) damit auf 94 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 283 Erfassungsbögen (20,8 %) 0,93 Individuen / 100 ha (Min: 0,03 / Max: 5,71 / s = 0,90)
10 Kapitel 3:Ergebnisse Steinmarder - Martes foina (Erxleben, 1777) Verbreitung und Bestandsdichte < 1,0 Ind / 100 ha 1,0-4,0 Ind / 100 ha > 4,0 Ind / 100 ha Als Kulturfolger profitiert der Steinmarder sehr stark vom Menschen. Im Gegensatz zum Baummarder meidet er Siedlungsgebiete nicht und kann dort hohe Bestandsdichten erreichen. Ausgedehnte Wälder werden hingegen eher gemieden. Auch ist der Steinmarder eher als ein Bodenbewohner zu bezeichnen. Ein breites Nahrungsspektrum und eine ausgeprägte Anpassungsfähigkeit machen dieses mittelgroße Raubtier zur häufigsten Marderart in Sachsen. In Sachsen ist der Steinmarder flächendeckend verbreitet. Die durchschnittliche Individuenzahl übertrifft die des Baummarders fast um das Dreifache. Art festgestellt: 1197 Erfassungsbögen (87,8 %) damit auf 99 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 626 Erfassungsbögen (45,9 %) 2,75 Individuen / 100 ha (Min: 0,18 / Max: 10,48 / s = 1,82)
11 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Großwiesel, Hermelin - Mustela erminea Linnaeus, 1758 Verbreitung und Bestandsdichte < 0,25 Ind / 100 ha 0,25-1,25 Ind / 100 ha > 1,25 Ind / 100 ha Das Hermelin, welches holarktisch verbreitet ist, stellt keine besonderen Ansprüche an seinen Lebensraum. Allerdings werden ausgedehnte Waldbestände in der Regel gemieden. Als Nahrung werden hauptsächlich Wühlmäuse erbeutet. Fehlen diese, können auch andere Kleinsäuger, Vögel oder Amphibien bis zur Größe eines Kaninchens überwältigt werden. Charakteristisch ist der deutlich längere Schwanz als beim Mauswiesel mit einer schwarzen Schwanzspitze, die selbst im weißen Winterfell erhalten bleibt. In Sachsen ist das Hermelin flächendeckend verbreitet. Art festgestellt: 806 Erfassungsbögen (59,1 %) damit auf 97 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 358 Erfassungsbögen (26,3 %) 0,84 Individuen / 100 ha (Min: 0,02 / Max: 3,16 / s = 0,57)
12 Kapitel 3:Ergebnisse Mauswiesel - Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Verbreitung und Bestandsdichte < 0,5 Ind / 100 ha 0,5-1,5 Ind / 100 ha > 1,5 Ind / 100 ha Das Mauswiesel ist das kleinste Raubtier weltweit. Es ist in Eurasien, Nordamerika und Afrika verbreitet. Im Unterschied zum Hermelin weist diese Marderart einen kurzen Schwanz ohne schwarzer Schwanzspitze auf. Die Nahrung besteht ebenfalls überwiegend aus Kleinsäugern bis Kaninchengröße, insbesondere aber Wühl- und Echtmäusen. Daneben werden aber auch Vögel, Würmer und Insekten erbeutet. Zum Teil können auch menschliche Ansiedlungen und selbst Gebäude von diesem Kleinmarder besiedelt werden. In Sachsen ist das Mauswiesel flächendeckend verbreitet, die durchschnittliche Individuendichte liegt kaum über der des Hermelins. Art festgestellt: 802 Erfassungsbögen (58,8 %) damit auf 97 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 326 Erfassungsbögen (23,9 %) 0,88 Individuen / 100 ha (Min: 0,03 / Max: 4,23 / s = 0,66)
13 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Amerikanischer Nerz, Mink - Mustela vison Schreber, 1777 Verbreitung und Bestandsdichte < 0,25 Ind / 100 ha 0,25-1,0 Ind / 100 ha > 1,0 Ind / 100 ha Der Mink wird seit den 20iger Jahren in zahlreichen Pelzfarmen in Europa gehalten. Bis heute gelangen immer wieder Tiere aus diesen Farmen in die Freiheit. So ist der Mink heute in mehreren Teilpopulationen in ganz Deutschland verbreitet, während sein ursprüngliches in Kanada und den USA liegt. Dieser konkurrenzstarke Neubürger kann durch seine Gewandtheit und opportunistische Jagdstrategie eine ernste Gefahr für die einheimische Säuger- und Vogelfauna darstellen. In Sachsen ist der Mink schwerpunktmäßig in der Teichlausitz sowie in Mittel- und Nordsachsen verbreitet. Als die durchschnittliche Bestandsdichte wurde in seinem 0,6 Individuen (100 ha) -1 festgestellt. Art festgestellt: 70 Erfassungsbögen (5,1 %) damit auf 19 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 35 Erfassungsbögen (2,6 %) 0,58 Individuen / 100 ha (Min: 0,03 / Max: 2,56 / s = 0,64)
14 Kapitel 3:Ergebnisse Iltis - Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Bestandsdichte < 0,25 Ind / 100 ha 0,25-1,0 Ind / 100 ha > 1,0 Ind / 100 ha Durch die zunehmende Zerstörung seines Lebensraumes, der reichstrukturierten und dekkungsreichen Uferzone von Gewässern und Waldränder, sind die Bestände des Iltis in den letzten Jahren stark rückläufig. Dieser mittelgroße Mader ist über die gesamte Palaearktis verbreitet. Seine Hauptnahrung stellen Kleinsäuger und Amphibien dar. Daneben werden aber auch Wirbellose, Aas und Früchte gefressen. Trotz des Bestandsrückgangs ist der Iltis in Sachsen noch flächendeckend anzutreffen. Mit durchschnittlich 0,7 Individuen (100 ha) -1 ist er jedoch nirgends häufig. Art festgestellt: 532 Erfassungsbögen (39,0 %) damit auf 92 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 246 Erfassungsbögen (18,1 %) 0,71 Individuen / 100 ha (Min: 0,03 / Max: 3,45 / s = 0,63)
15 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Dachs - Meles meles (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Wurfbaudichte < 0,2 Baue / 100 ha 0,2-0,6 Baue / 100 ha > 0,6 Baue / 100 ha Der Dachs ist der größte einheimische Vertreter der Marderartigen. Diese Art meidet offene Flächen ohne Deckung. Die unterirdischen Baue werden meist im Wald angelegt und oft über lange Zeiträume genutzt. Von allen Mardern ist er die am wenigsten carnivore Art: Regenwürmer und vegetabile Nahrung stellen den Hauptanteil. Die im Rahmen der Fuchstollwutbekämpfung durchgeführten Baubegasungen haben in den 60iger Jahren die Bestände stark dezimiert. Heute stellt der Straßentod einen wesentlichen Mortalitätsfaktor dar. In Sachsen ist der Dachs flächendeckend verbreitet. Die mittlere Baudichte von 0,44 Bauen (100 ha) -1 ist mit der anderer europäischer Regionen durchaus vergleichbar. Art festgestellt: 1180 Erfassungsbögen (85,6 %) damit auf 99 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 969 Erfassungsbögen (70,3 %) 0,44 Baue / 100 ha (Min: 0,02 / Max: 1,62 / s = 0,20)
16 Kapitel 3:Ergebnisse Fischotter - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Bestandsdichte < 0,2 Ind / 100 ha 0,2-1,0 Ind / 100 ha > 1,0 Ind / 100 ha Der Fischotter wurde gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa fast vollständig ausgerottet. Strenge Schutzmaßnahmen führten dazu, daß die Bestände in Sachsen heute wieder als gesichert anzusehen sind. Allerdings ist die Verlustrate durch den Straßenverkehr seit 1990 drastisch angestiegen, so daß die künftige Bestandsentwicklung sorgfältig beobachtet werden muß. Im östlichen Sachsen, insbesondere in der Oberlausitz, ist der Fischotter flächendeckend verbreitet. Im westlichen und südwestlichen Sachsen ist der Wassermarder hingegen nach wie vor selten bzw. fehlt völlig. Die ermittelte durchschnittliche Bestandsdichte von 0,63 Individuen (100 ha) -1 in Fischottergebieten liegt sicherlich deutlich über der tatsächlichen Populationsdichte. Art festgestellt: 198 Erfassungsbögen (14,4 %) damit auf 40 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 85 Erfassungsbögen (6,2 %) 0,63 Individuen / 100 ha (Min: 0,06 / Max: 4,42 / s = 0,81)
17 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Luchs - Lynx lynx Linnaeus, 1758 Verbreitung Der Luchs ist der größte einheimische Vertreter der katzenartigen Raubtiere. Die Beanspruchung eines sehr großen Territoriums machten ihn auch in historischer Zeit nirgends häufig. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde er in ganz Mitteleuropa ausgerottet. Neuansiedlungen und Arealerweiterungen haben bis heute wieder zu kleineren Randvorkommen in Deutschland geführt. In Sachsen wurden Luchse nur in Grenznähe zu Böhmen festgestellt (Sächsische Schweiz und westl. Erzgebirge). Es bleibt äußerst fraglich, ob es sich hierbei um eigenständige Bestände handelt. Art festgestellt: 9 Erfassungsbögen (0,7 %) damit auf 3 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Wilddichte: 3 Erfassungsbögen (0,2 %) (4 Ind. Markneukirchen, jeweils 1 Ind. in Rathmannsdorf und Taubenheim)
18 Kapitel 3:Ergebnisse Grau-, Fischreiher - Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Verbreitung und Brutpaardichte < 0,25 BP / 100 ha 0,25-1,25 BP / 100 ha > 1,25 BP / 100 ha Der Fischreiher ist weiten Teilen Eurasiens sowie zum Teil in Afrika verbreitet. In Europa ist er häufig in gewässerreichen Niederungsgebieten anzutreffen. Er brütet sowohl einzeln als auch in großen Kolonien, wobei die Brutdichte vom Nahrungsangebot abhängt. Hauptsächlich werden Fische erbeutet, daneben sind aber auch Amphibien, Reptilien und Kleinsäuger bedeutende Nahrungsbestandteile. In der Fischereiwirtschaft kann dieser Schreitvogel zum Teil erhebliche Schäden verursachen. In den letzten 20 Jahren hat sein Bestand deutlich zugenommen. In Sachsen ist der Fischreiher flächendeckend verbreitet und kann lokal hohe Dichten erreichen. Art festgestellt: 918 Erfassungsbögen (66,6 %) damit auf 97,1 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 283 Erfassungsbögen (20,5 %) 1,31 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,04 / Max: 13,87 / s = 2,29)
19 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Höckerschwan - Cygnus olor (Gmelin, 1789) Verbreitung und Brutpaardichte < 0,2 BP / 100 ha 0,2-0,8 BP / 100 ha > 0,8 BP / 100 ha Der Höckerschwan ist als Wildvogel im nördlichen Europa bis Zentralasien verbreitet. Daneben ist er vielerorts in halbdomestizierter Form anzutreffen. Bevorzugt werden eutrophe, stehende oder langsam fließende Gewässer mit vegetationsreichen Uferzonen besiedelt. Die Nahrung besteht überwiegend aus Pflanzenteilen. Als Brutvogel ist der Höckerschwan mit Ausnahme des Berglandes in ganz Sachsen verbreitet. Höhere Bestandsdichten lassen sich im gewässerreichen Tiefland erkennen. Art festgestellt: 334 Erfassungsbögen (24,2 %) damit auf 59 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 150 Erfassungsbögen (10,9 %) 0,50 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,06 / Max: 2,80 / s = 0,51)
20 Kapitel 3:Ergebnisse Graugans - Anser anser (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Brutdichte < 0,5 Bruten / 100 ha 0,5-4,0 Bruten / 100 ha > 4,0 Bruten / 100 ha Die Graugans ist in Nord- und Osteuropa sowie in weiten Teilen Asiens verbreitet. Als Habitat werden flache Gewässerufer mit Röhricht und angrenzenden Bruchwäldern sowie ausgedehnte Feuchtwiesen bevorzugt. Sie ernährt sich von Gräsern, Trieben, Sämereien und Wurzeln. Seit 1960 ist in Sachsen eine allmähliche Zunahme des Brutvorkommens festzustellen. In Sachsen kann die Graugans vielerorts beobachtet werden. Sie fehlt allerdings in Teilen des Vogtlandes, des Westerzgebirges und des Lausitzer Berglandes. Brutnachweise wurden vor allem aus der Teichlausitz und westlich bis zur Elbe gemeldet. Art festgestellt: 288 Erfassungsbögen (20,9 %) damit auf % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 35 Erfassungsbögen (2,5 %) 2,27 Bruten / 100 ha (Min: 0,12 / Max: 7,36 / s = 2,37)
21 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Kanadagans - Branta canadensis (Linnaeus, 1758) Verbreitung Die Kanadagans ist ursprünglich in Nordamerika verbreitet. Diese Art wurde in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts in mehreren europäischen Staaten eingebürgert. Seit 1945 ist sie zunehmend an Nord- und Ostsee beobachtet worden. In Sachsen können vor allem Wintergäste beobachtet werden. Sommerbeobachtungen sind meist auf entflohenen Gehegetieren begründet. In Sachsen wurde die Kanadagans vor allem in den nördlichen Landesteilen sowie im Raum festgestellt. Art festgestellt: 68 Erfassungsbögen (4,9 %) damit auf 42 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 1 Erfassungsbögen (0,1 %) (4 Individuen)
22 Kapitel 3:Ergebnisse Stockente - Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Verbreitung und Brutdichte < 1,0 Bruten / 100 ha 1,0-5,0 Bruten / 100 ha > 5,0 Bruten / 100 ha Die Stockente ist hoarktisch verbreitet. In Europa ist sie die häufigste und die am weitesten verbreitete Entenart. Als Schwimmente bevorzugt sie Gewässer mit deckungsreichen Ufern und Inseln. Die Bruthabitate befinden sich sowohl in Wald- als auch in offenen Landschaften oder Ortslagen. Ihr Nahrungsspektrum ist vielfältig und besteht aus pflanzlicher und tierischer Kost, wobei die Anteile saisonalen Schwankungen unterliegen. In den letzten Jahren gab es deutliche Hinweise auf einen landesweiten Bestandsrückgang. In Sachsen ist die Stockente flächendeckend verbreitet. In den gewässerreichen Niederungen ist sie häufiger als im Hügel- und Bergland anzutreffen. Art festgestellt: 1132 Erfassungsbögen (82,2 %) damit auf 98 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 825 Erfassungsbögen (59,9 %) 2,42 Bruten / 100 ha (Min: 0,09 / Max: 44,18 / s = 3,82)
23 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Tafelente - Aythia ferina Linnaeus, 1758 Verbreitung und Brutdichte < 0,25 Bruten / 100 ha 0,25-2,5 Bruten / 100 ha > 2,5 Bruten / 100 ha Die Tafelente ist über die südliche Westpalaearktis verbreitet. Sie bevorzugt größere Standgewässer von geringer Tiefe und einer abwechslungsreichen Uferstruktur des Flach- und Hügellandes. Nachdem sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Bestände in Sachsen erholen konnten, ist seit 1980 wieder ein allgemeiner Bestandsrückgang zu verzeichnen. Die Nahrung dieser Tauchente besteht sowohl aus pflanzlicher als auch tierischer Nahrung. In Sachsen ist die Tafelente im Tiefland weitverbreitet. Hohe Brutdichten wurden u.a. aus der Teichlausitz gemeldet. Im Bergland vom Westerzgebirge bis zum er Gebirge konnte sie hingegen vielerorts nicht nachgewiesen werden. Art festgestellt: 249 Erfassungsbögen (18,1 %) damit auf 68 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 80 Erfassungsbögen (5,8 %) 1,89 Bruten / 100 ha (Min: 0,03 / Max: 22,09 / s = 4,04)
24 Kapitel 3:Ergebnisse Reiherente - Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Brutdichte < 0,25 Bruten / 100 ha 0,25-2,5 Bruten / 100 ha > 2,5 Bruten / 100 ha Die Reiherente ist ein Bewohner der nördlichen Palaearktis. Bevorzugt werden stehende oder langsam fließende Gewässer mit flachen, möglichst offenen Ufern und einer geringen Tiefe. Als kleine Tauchente ernährt sie sich überwiegend von tierischer Nahrung, insbesondere von kleinen Mollusken. In Sachsen konnte in den letzten Jahren eine Bestandszunahme festgestellt werden. In Sachsen ist die Reiherente weit verbreitet mit Schwerpunkten in der Teichlausitz und dem südwestlichen Sachsen. Dort konnten auch die höchsten Brutdichten festgestellt werden. Im Bergland, insbesondere im Elbsandstein- und Lausitzer Gebirge, konnte diese Art hingegen nur selten beobachtet werden. Art festgestellt: 257 Erfassungsbögen (18,7 %) damit auf 72 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 90 Erfassungsbögen (6,5 %) 1,11 Bruten / 100 ha (Min: 0,03 / Max: 7,36 / s = 1,62)
25 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Seeadler - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Brutpaardichte < 0,1 BP / 100 ha 0,1-0,6 BP / 100 ha > 0,6 BP / 100 ha Der Seeadler ist der größte einheimische Greifvogel. Ursprünglich über den Großteil der nördlichen Palaearktis verbreitet, ist der Seeadler heute nur noch in wenigen europäischen Ländern heimisch. Sein Vorkommen ist an größere Gewässer oder die Meeresküste gebunden. Seine Nahrung umfaßt ein breites Spektrum an mittelgroßen bis großen Wirbeltieren (Fische, Wasservögel, Säugetiere). Auch Aas wird angenommen. Seit 1980 ist in Sachsen ein deutliches Anwachsen der Bestände zu verzeichnen. In Sachsen beschränkt sich das Brutgebiet auf die nördlichen und östlichen Landesteile. Höhere Dichten werden nur in der Teichlausitz erreicht. Art festgestellt: 163 Erfassungsbögen (11,8 %) damit auf 39,1 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 37 Erfassungsbögen (2,7 %) 0,45 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,02 / Max: 3,75 / s = 0,80)
26 Kapitel 3:Ergebnisse Mäusebussard - Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Brutpaardichte < 0,5 BP / 100 ha 0,5-1,5 BP / 100 ha > 1,5 BP / 100 ha Der Mäusebussard ist über den gesamten Wald- und Waldsteppengürtel der Palaearktis verbreitet und ist zusammen mit dem Turmfalken der häufigste Greifvogel in Deutschland. Für Mitteleuropa wird eine maximale Dichte von 0,2 bis 0,3 Brutpaaren (100 ha) -1 angenommen. Als Brutvogel ist er ein Waldbewohner, der allerdings seine Nahrung im offenen Land erbeutet. Seine Hauptnahrung sind Wühlmäuse. Es werden aber auch andere kleinere Säugetiere bis hin zu jungen Hasen, Nestlinge, Reptilien, Amphibien und Insekten erbeutet sowie Aas angenommen. Der Mäusebussard besiedelt das gesamte Sachsen von den Tiefebenen bis in die Hochlagen des Erzgebirges. Art festgestellt: 1323 Erfassungsbögen (96,0 %) damit auf 100 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 1005 Erfassungsbögen (72,9 %) 0,90 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,15 / Max: 1,80 / s = 0,35)
27 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Habicht - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Brutpaardichte < 0,2 BP / 100 ha 0,2-0,6 BP / 100 ha > 0,6 BP / 100 ha Der Habicht ist circumpolar verbreitet. Als Biotop bevorzugt diese Art strukturreiche Landschaften, in denen sich Wälder und Offenland abwechseln. Für Mitteleuropa wird eine mittlere Brutpaardichte von 0,1 bis 0,5 Brutpaaren (1.000 ha) -1! angegeben. Die Nahrung dieses Greifvogels besteht überwiegend aus Vögeln und nur zu einem geringeren Anteil aus Kleinsäugern. In Sachsen ist der Habicht flächendeckend verbreitet. Als durchschnittliche Brutpaardichte wurden 0,36 Brutpaare (100 ha) -1 ermittelt. Art festgestellt: 1070 Erfassungsbögen (77,7 %) damit auf 98,9 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 630 Erfassungsbögen (45,7 %) 0,36 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,02 / Max: 0,95 / s = 0,18)
28 Kapitel 3:Ergebnisse Rotmilan - Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Brutpaardichte < 0,1 BP / 100 ha 0,1-0,5 BP / 100 ha > 0,5 BP / 100 ha Der Rotmilan ist in der westlichen Palaearktis verbreitet, fehlt aber ein einigen Regionen Mittel- und Osteuropas (z.b. Alpen, Böhmisches Becken). Auch in Sachsen war dieser Greifvogel noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein seltener Brutvogel. In den letzten Jahrzehnten konnte eine Zunahme der Bestände registriert werden. Der Rotmilan bevorzugt ebenfalls strukturreiche Landschaften, in denen Wälder und Offenland abwechseln. Er brütet gerne in Gewässernähe. Es werden vor allem Vögel und kleinere Säugetiere, aber auch Fische erbeutet. In Sachsen ist der Rotmilan mit einer mittleren Dichte von 0,33 Brutpaaren (100 ha) -1 flächendeckend verbreitet. Art festgestellt: 845 Erfassungsbögen (61,3 %) damit auf 92,5 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 412 Erfassungsbögen (29,9 %) 0,33 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,02 / Max: 1,30 / s = 0,20)
29 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Rohrweihe - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Brutpaardichte < 0,2 BP / 100 ha 0,2-0,6 BP / 100 ha > 0,6 BP / 100 ha Die Rohrweihe ist überwiegend in der Palaearktis verbreitet. Als Brutvogel ist sie stark an das Vorhandensein von Röhricht gebunden und ist deshalb vor allem in den Tieflagen verbreitet. In den letzten Jahren konnte eine Bestandszunahme beobachtet werden. Die Rohrweihe ernährt sich überwiegend von kleineren Vögeln und Säugetieren. Kennzeichnend für alle Vertreter der Gattung Circus ist der Nestraub (Eier, Küken, Nestlinge). Im nördlichen Sachsen ist die Rohrweihe flächendeckend verbreitet. Im Hügel- und Bergland der südlichen Landesteile weist die Art hingegen deutliche Verbreitungslücken auf. Art festgestellt: 299 Erfassungsbögen (21,7 %) damit auf 78,7 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 112 Erfassungsbögen (8,1 %) 0,33 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,04 / Max: 2,77 / s = 0,36)
30 Kapitel 3:Ergebnisse Auerhuhn - Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 Verbreitung Das Auerhuhn ist als größte europäische Hühnerart palaearktisch verbreitet. Bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert lassen sich ein allgemeiner Rückgang des Auerwildbestandes in Mitteleuropa erkennen. Klimaschwankungen, Bejagung, Intensivierung der Forstwirtschaft und die zunehmende Walderschließung dürften wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Diese Art bevorzugt störungsarme, zusammenhängende Nadel- und Mischwaldgebiete. In Sachsen konnten kleinere Auerhuhnvorkommen nur noch in der südlichen Oberlausitz und im westlichen Erzgebirge nachgewiesen werden. Letztere konnten sich bereits über mehrere Jahre behaupten, während die Nachweise in der Lausitz sind sicherlich nur im Zusammenhang mit den Beständen in Südwest-Polen gesehen werden müssen. Art festgestellt: 3 Erfassungsbögen (0,2 %) damit auf 3 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 2 Erfassungsbögen (0,1 %) (jeweils 2 Individuen beobachtet)
31 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Birkhuhn - Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 Verbreitung und Bestandsdichte < 0,1 Ind / 100 ha 0,1-0,4 Ind / 100 ha > 0,4 Ind / 100 ha Das Birkhuhn, welches palaearktisch über den gesamten borealen Waldgürtel verbreitet ist, bevorzugt offenes, mit Zwergsträuchern bestandenes Gelände bzw. lichte Wälder mit verschieden alten Baumbeständen. Im Bergland ist es daher meist in den waldarmen Regionen der Hochlagen, in den Niederungen in den Moor- und Heidegebieten verbreitet. Noch im 19. Jahrhundert besiedelte das Birkhuhn nahezu ganz Sachsen. Durch die Zerstörung bzw. zunehmende Beunruhigung ihres Lebensraumes sind die Bestände des Birkwildes stark rückgängig und wurden 1996 auf lediglich 100 Individuen geschätzt. In Sachsen finden sich die letzten Birkhuhnbestände im Bereich der Bad Muskauer Heide sowie im Erzgebirges. Art festgestellt: 18 Erfassungsbögen (1,3 %) damit auf 16 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 10 Erfassungsbögen (0,7 %) 0,22 Individuen / 100 ha (Min: 0,01 / Max: 0,71 / s = 0,20)
32 Kapitel 3:Ergebnisse Haselhuhn - Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Verbreitung Das Haselhuhn ist ein ausgeprägter Waldvogel, der bevorzugt in Nadel- und strukturreichen Mischwäldern brütet. Die Art ist in der gesamten Palaearktis verbreitet. Wie Auer- und Birkhuhn leidet auch das Haselhuhn unter der Intensivierung der Forstwirtschaft und der zunehmenden Erschließung der Wälder. In Sachsen gilt die Art seit 1950 als ausgestorben. Wohl kam es zu einzelnen Beobachtungen, über erfolgte Bruten ist allerdings nichts bekannt. In Sachsen konnte das Haselhuhn nur noch im Vogtland, bei Penig sowie in der Dübener Heide nördlich von festgestellt werden. Art festgestellt: 5 Erfassungsbögen (0,4 %) damit auf 4,0 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 2 Erfassungsbögen (0,1 %) (jeweils 2 Individuen beobachtet)
33 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Rebhuhn - Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Brutpaardichte < 0,2 BP / 100 ha 0,2-0,8 BP / 100 ha > 0,8 BP / 100 ha Das Westpalaearktisch verbreitete Rebhuhn war früher als Kulturfolger ein vergleichsweise häufiger Bewohner der offenen Kulturlandschaft. Die Intensivierung der Landwirtschaft und ein hoher Prädatorendruck ließen jedoch seit über 100 Jahren vielerorts die Bestände dieser Niederwildart stark zurückgehen, so daß das Rebhuhn heute ganzjährig geschont wird. Durch habitatverbessernde Maßnahmen wird versucht, die Restbestände zu erhalten. In Sachsen weist das des Rebhuhns einige Lücken auf. So ist die Art entlang des Erzgebirges oder zwischen und eher selten anzutreffen. Mit einer durchschnittlichen Dichte von 0,5 Brutpaaren (100 ha) -1 sind die Bestände aber auch dort, wo das Rebhuhn noch vorkommt, als gering einzustufen. Art festgestellt: 351 Erfassungsbögen (25,5 %) damit auf 82,2 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 255 Erfassungsbögen (18,5 %) 0,50 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,04 / Max: 3,72 / s = 0,50)
34 Kapitel 3:Ergebnisse Fasan - Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Verbreitung und Brutdichte < 0,2 Bruten / 100 ha 0,2-1,4 Bruten / 100 ha > 1,4 Bruten / 100 ha Das autochthone des Fasans ist für Zentral- und Mittelasien gesichert. Bereits in der Antike wurde der Fasan in Süd- und Südosteuropa eingebürgert. Nach Mitteleuropa gelangte dieser Hühnervogel wohl erst im frühen Mittelalter. Als Lebensraum bevorzugt er offene aber zugleich auch deckungsreiche Landschaften. Die Ausräumung der Landschaft und hoher Prädatorendruck wirken sich negativ auf die Bestände aus. In den nordwestlichen und zentralen Landesteilen weist der Fasan eine flächendeckende Verbreitung auf. Geschlossene e finden sich darüber hinaus in der Oberlausitz (ohne Muskauer Heide) und im Vogtland. Art festgestellt: 332 Erfassungsbögen (24,1 %) damit auf 69 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 226 Erfassungsbögen (16,4 %) 0,81 Bruten / 100 ha (Min: 0,04 / Max: 6,36 / s = 1,03)
35 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Bleßralle - Fulica atra Linnaeus, 1758 Verbreitung und Bestandsdichte < 0,5 Ind / 100 ha 0,5-4,0 Ind / 100 ha > 4,0 Ind / 100 ha Die Bleßralle ist über das gesamte Eurasien an stehenden und langsam fließenden Gewässern verbreitet und kann stellenweise als ausgesprochen häufiger Brutvogel in Erscheinung treten. An Kleingewässern können Dichten von über 100 Brutpaaren (100 ha) -1 erreicht werden. Dieser Rallenvogel lebt sowohl von pflanzlicher als auch tierischer Nahrung. In Sachsen ist die Bleßralle insbesondere im Tiefland nahezu flächendeckend verbreitet. Lediglich im Westerzgebirge und Lausitzer Bergland weist die Art größere Verbreitungslücken auf. Art festgestellt: 450 Erfassungsbögen (32,7 %) damit auf 83 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 265 Erfassungsbögen (19,2 %) 4,59 Individuen / 100 ha (Min: 0,04 / Max: 220,91 / s = 22,67)
36 Kapitel 3:Ergebnisse Großtrappe - Otis tarda Linnaeus, 1758 Verbreitung Die Großtrappe war ehemals über die größeren Ebenen der südlichen Palaearktis verbreitet. Dort besiedelte sie die ausgedehnten Acker- und Grünlandflächen auf überwiegend schweren Böden. Die Intensivierung der Landwirtschaft, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und hoher Prädatorendruck ließen diesen Bodenbrüter im gesamten selten werden. Ihre Nahrung umfaßt sowohl pflanzliche als auch tierische Bestandteile. Als Brutvogel gilt die Großtrappe in Sachsen seit 1989 für ausgestorben. In Sachsen wurde die Großtrappe bei Lohsa, Erlau und Crinitzberg beobachtet werden. Art festgestellt: 4 Erfassungsbögen (0,3 %) damit auf 3 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 2 Erfassungsbögen (0,2 %) (8 bzw. 4 Individuen bei Crinitzberg)
37 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Waldschnepfe - Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Verbreitung und Bestandsdichte < 0,2 Ind / 100 ha 0,2-1,2 Ind / 100 ha > 1,2 Ind / 100 ha Die Waldschnepfe ist über das gesamte Eurasien verbreitet. Als Brutgebiet bevorzugt diese Art ausgedehnte und reich gegliederte Hochwaldgebiete. In den Niederungen ist sie vor allem in Laub- und Mischwäldern anzutreffen. Die Nahrung besteht überwiegend aus Insekten und Spinnen, aber auch Schnecken, Würmern und Sämereien. Aufgrund ihrer geringen Bestandsdichte hat die Waldschnepfe in Sachsen ganzjährig Schonzeit. In Sachsen ist weist das der Waldschnepfe nur wenige Lücken auf. Mit durchschnittlich 0,7 Individuen (100 ha) -1 ist sie allerdings nirgends häufig. Art festgestellt: 422 Erfassungsbögen (30,6 %) damit auf 87 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 191 Erfassungsbögen (13,9 %) 0,72 Individuen / 100 ha (Min: 0,07 / Max: 3,95 / s = 0,46)
38 Kapitel 3:Ergebnisse Lachmöwe - Larus ridibundus Linnaeus, 1766 Verbreitung und Bestandsdichte < 2,5 Ind / 100 ha 2,5-7,5 Ind / 100 ha > 7,5 Ind / 100 ha Die Lachmöwe ist in der gesamten Palaearktis verbreitet. Sie besiedelt Gewässer in offenen bis halboffenen Landschaften, wo diese Art vor allem auf Inseln in Kolonien brütet. Nachdem ab dem 2. Weltkrieg die Brutbestände allmählich zunahmen, ist seit einigen Jahren wieder ein Rückgang der Bestände festzustellen. In Sachsen wurde die Lachmöwe vor allem in der Teichlausitz, entlang der Elbe sowie im er-altenburger Raum nachgewiesen. Art festgestellt: 221 Erfassungsbögen ( 16,0 %) damit auf 57 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 48 Erfassungsbögen (3,5 %) 19,4 Individuen / 100 ha (Min: 0,29 / Max: 220,91 / s = 47,96)
39 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Silbermöwe - Larus agentatus Pontoppidan, 1763 Verbreitung und Bestandsdichte < 1,0 Ind / 100 ha 1,0-4,0 Ind / 100 ha > 4,0 Ind / 100 ha Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Silbermöwe im Binnenland eine recht seltene Erscheinung. Seit 1980 gibt es vereinzelte Brutversuche in Sachsen. Bei der überwiegenden Anzahl der Beobachtungen dürfte es sich somit um Durchzügler und Wintergäste handeln, die zum Teil in hohen Konzentrationen auftreten können. Die Silbermöwe ernährt sich von tierischer Nahrung jeder Art. Es werden auch Aas und Abfälle angenommen. In Sachsen konzentrieren sich die Nachweise auf die westlichen Landesteile um, Altenberg und, sowie auf das Elbtal und die Teichlausitz. Art festgestellt: 148 Erfassungsbögen (10,7 %) damit auf 44 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 28 Erfassungsbögen (2,0 %) 2,68 Individuen / 100 ha (Min: 0,32 / Max: 12,87 / s = 2,92)
40 Kapitel 3:Ergebnisse Elster - Pica pica (Linnaeus, 1758) Verbreitung und Brutpaardichte < 1,0 BP / 100 ha 1,0-3,0 BP / 100 ha > 3,0 BP / 100 ha Die Elster war ursprünglich ein Bewohner offener, mit Gehölz und Gebüsch durchsetzter Landschaften. Seit 1950 konnte eine zunehmende Bindung an menschliche Ansiedlungen festgestellt werden. Entsprechend können in Stadtgebieten zum Teil sehr hohe Dichten ermittelt werden. Als ein Vertreter der Rabenvögel hat die Elster ein sehr breites Nahrungsspektrum und tritt nicht selten als Nesträuber in Erscheinung. In Sachsen hat die Elster wieder eine Jagdzeit erhalten. In Sachsen ist die Elster flächendeckend verbreitet mit einer mittleren Dichte von rund 2 Brutpaaren (100 ha) -1. Art festgestellt: 1253 Erfassungsbögen (90,9 %) damit auf 98 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 966 Erfassungsbögen (70,1 %) 1,99 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,14 / Max: 15,63 / s = 1,52)
41 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Aaskrähe - Corvus corone Linnaeus, 1758 Verbreitung und Brutpaardichte < 1,0 BP / 100 ha 1,0-3,0 BP / 100 ha > 3,0 BP / 100 ha Die Aaskrähe ist in Sachsen in zwei Unterarten verbreitet: Rabenkrähe C. c. corone (westl. Sachsen) und C. c. cornix (östl. Sachsen). Die Grenze verläuft als eine ca. 200 km breite Mischzone etwa entlang der Elbe quer durch Sachsen. Die Art bevorzugt abwechslungsreich strukturierte Lebensräume mit Baumbeständen und Freiflächen. Oft auch unweit menschlicher Ansiedlungen. Wie die Elster ist auch die Aaskrähe ein vielseitiger Allesfresser, der nicht selten als Nesträuber in Erscheinung tritt. Auch diese Art hat 1999 wieder eine Jagdzeit erhalten In Sachsen ist die Aaskrähe flächendeckend verbreitet. Die mittlere Brutpaardichte entspricht mit 1,9 Bp. (100 ha) -1 etwa der der Elster. Art festgestellt: 1279 Erfassungsbögen (92,8 %) damit auf 100 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 921 Erfassungsbögen (66,8 %) 1,86 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,10 / Max: 20,22 / s = 1,71)
42 Kapitel 3:Ergebnisse Kolkrabe - Corvus corax Linnaeus, 1758 Verbreitung und Brutpaardichte < 0,1 BP / 100 ha 0,1-1,0 BP / 100 ha > 1,0 BP / 100 ha Nachdem der Kolkrabe bis zum Beginn der 50iger Jahre in Sachsen als ausgestorben galt, erfolgte insbesondere in den 70iger Jahren eine starke Bestandszunahme. Heute ist der Kolkrabe wieder in ganz Sachsen verbreitet. Dieser bussardgroße Rabenvogel ist ein Brutvogel der Wälder und zunehmend auch kleinerer Baumbestände. Als Allesfresser zählen auch Aas und Abfälle zu seinem Beutespektrum In Sachsen ist der Kolkrabe flächendeckend verbreitet. Art festgestellt: 1091 Erfassungsbögen (79 %) damit auf 98 % der MTB in Sachsen verbreitet Angaben zur Dichte: 676 Erfassungsbögen (49,1 %) 0,59 Brutpaare / 100 ha (Min: 0,04 / Max: 2,95 / s = 0,38)
Verbreitung. Riesa. Freiberg
 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Rothirsch - Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Verbreitung Verbreitungsgebiet auch Standwild entsprechende Der Rothirsch ist als zweitgrößte europäische
Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Rothirsch - Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Verbreitung Verbreitungsgebiet auch Standwild entsprechende Der Rothirsch ist als zweitgrößte europäische
Zu Anlage (zu 7 und 72 Absatz 1)
 - 115 - Zu Anlage (zu 7 und 72 Absatz 1) Die Anlage enthält die Aufstellung der dem Gesetz unterstellten Tierarten nach 7 Absatz 1 (Aufstellung Spalte 1). Es handelt sich um die Arten der Wildtiere im
- 115 - Zu Anlage (zu 7 und 72 Absatz 1) Die Anlage enthält die Aufstellung der dem Gesetz unterstellten Tierarten nach 7 Absatz 1 (Aufstellung Spalte 1). Es handelt sich um die Arten der Wildtiere im
Berücksichtigung streng geschützter Arten
 Verbände-Vorhaben Überwindung von Barrieren 1 (Reck, H., Stand November 2007) Berücksichtigung streng geschützter Arten Für die nach BNatSchG und ggf. weitere, nach jeweiligen Landesnaturschutzgesetzen
Verbände-Vorhaben Überwindung von Barrieren 1 (Reck, H., Stand November 2007) Berücksichtigung streng geschützter Arten Für die nach BNatSchG und ggf. weitere, nach jeweiligen Landesnaturschutzgesetzen
Die Jagdstrecke des Jagdjahres 2009/2010
 WFS-MITTEILUNGEN Nr. 4/21 LANDWIRTSCHAFTLICHES ZENTRUM FÜR RINDERHALTUNG, GRÜNLANDWIRTSCHAFT, MILCHWIRTSCHAFT, WILD UND FISCHEREI BADEN-WÜRTTEMBERG (LAZBW) - WILDFORSCHUNGSSTELLE AULENDORF - 88326 Aulendorf,
WFS-MITTEILUNGEN Nr. 4/21 LANDWIRTSCHAFTLICHES ZENTRUM FÜR RINDERHALTUNG, GRÜNLANDWIRTSCHAFT, MILCHWIRTSCHAFT, WILD UND FISCHEREI BADEN-WÜRTTEMBERG (LAZBW) - WILDFORSCHUNGSSTELLE AULENDORF - 88326 Aulendorf,
2. Methodik, Material und verwendete Literatur
 1. Einleitung Der Landesjagdverband Sachsen e.v. hat im Jagdjahr 2000 / 2001 im Freistaat Sachsen eine landesweite Wildtiererfassung durchgeführt. Gefördert aus der Jagdabgabe durch das Staatsministerium
1. Einleitung Der Landesjagdverband Sachsen e.v. hat im Jagdjahr 2000 / 2001 im Freistaat Sachsen eine landesweite Wildtiererfassung durchgeführt. Gefördert aus der Jagdabgabe durch das Staatsministerium
TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich
 TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich Bei drei brütenden Arten ist derzeit davon auszugehen, dass sie in keiner Weise gefährdet sind: Mäusebussard, Turmfalke, Sperber. Sechs Arten sind derzeit
TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich Bei drei brütenden Arten ist derzeit davon auszugehen, dass sie in keiner Weise gefährdet sind: Mäusebussard, Turmfalke, Sperber. Sechs Arten sind derzeit
Sind die Greifvögel am Niederwild-Rückgang schuld? Rückschlüsse aus Revieren einer Insel mit minimalem Vorkommen natürlicher Feinde von H.
 295 CORAX 8, Heft 4, 1981 Sind die Greifvögel am Niederwild-Rückgang schuld? Rückschlüsse aus Revieren einer Insel mit minimalem Vorkommen natürlicher Feinde von H. THIES Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein
295 CORAX 8, Heft 4, 1981 Sind die Greifvögel am Niederwild-Rückgang schuld? Rückschlüsse aus Revieren einer Insel mit minimalem Vorkommen natürlicher Feinde von H. THIES Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein
Im Text verwendete Abkürzungen und Fachausdrücke 12 Einleitung 13 Methoden der Altersbestimmung 14
 Im Text verwendete Abkürzungen und Fachausdrücke 12 Einleitung 13 Methoden der Altersbestimmung 14 Das Zementzonenverfahren 16 Die Bestimmung des Linsentrockengewichtes 19 Die Verknöcherung der Schädelnähte
Im Text verwendete Abkürzungen und Fachausdrücke 12 Einleitung 13 Methoden der Altersbestimmung 14 Das Zementzonenverfahren 16 Die Bestimmung des Linsentrockengewichtes 19 Die Verknöcherung der Schädelnähte
INHALT. Waidmannssprache 37. DER NORDISCHE UND DER ALPENSCHNEEHASE Naturgeschichte 117 Jagd 119
 INHALT DAS REH Jagdrechtliche Stellung 19 Naturgeschichte 21 Systematik 21 - Lebensraum 21 - Färbung 22 - Gewichte 22 - Haarwechsel 22 - Altersbestimmung 25 - Gehörn 26 - Fortpflanzung 29 - Feinde 30 -
INHALT DAS REH Jagdrechtliche Stellung 19 Naturgeschichte 21 Systematik 21 - Lebensraum 21 - Färbung 22 - Gewichte 22 - Haarwechsel 22 - Altersbestimmung 25 - Gehörn 26 - Fortpflanzung 29 - Feinde 30 -
Jagdbar. Anzahl Junge oder Eier. Grösse (cm) Gewicht (Kg) Nahrung. Lebensraum. Nistorte. Schonzeit. Jagdbar. Anzahl Junge oder Eier.
 Lappentaucher Ruderfüssler Lappentaucher Kormorane Zwergtaucher Kormoran Schreitvögel Schreitvögel Reiher Störche Graureiher Weissstorch Schwäne Gänse Höckerschwan Saatgans Schwimmenten Schwimmenten Krickente
Lappentaucher Ruderfüssler Lappentaucher Kormorane Zwergtaucher Kormoran Schreitvögel Schreitvögel Reiher Störche Graureiher Weissstorch Schwäne Gänse Höckerschwan Saatgans Schwimmenten Schwimmenten Krickente
TIER-STECKBRIEF BRAUNBÄR
 TIER-STECKBRIEF BRAUNBÄR 2 bis 3 Meter bis 50 km/h 150 bis ca. 700 kg max. 20-30 Jahre Wurzeln, Pilze, Beeren, Früchte, Nüsse, Insekten, Nagetiere und Fische Selten auch: Hirsche, Elche und Moschusochsen
TIER-STECKBRIEF BRAUNBÄR 2 bis 3 Meter bis 50 km/h 150 bis ca. 700 kg max. 20-30 Jahre Wurzeln, Pilze, Beeren, Früchte, Nüsse, Insekten, Nagetiere und Fische Selten auch: Hirsche, Elche und Moschusochsen
Wildtier-Kataster Schleswig-Holstein
 Foto: Dave Menke, Wikipedia Foto: John and Karen Hollingsworth, Wikipedia Institut für Natur- & Resourcenschutz Abt. Landschaftsökologie Ökologiezentrum Kiel Dipl. Geogr. Heiko Schmüser Themen Einleitung
Foto: Dave Menke, Wikipedia Foto: John and Karen Hollingsworth, Wikipedia Institut für Natur- & Resourcenschutz Abt. Landschaftsökologie Ökologiezentrum Kiel Dipl. Geogr. Heiko Schmüser Themen Einleitung
Tiere im Winter. OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1
 OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst verabschieden
OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst verabschieden
Bundesjagdgesetz BJG A
 BJG A Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mai 2013 (BGBl. I S. 1386) Übersicht I. Abschnitt:
BJG A Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mai 2013 (BGBl. I S. 1386) Übersicht I. Abschnitt:
Tierspuren. Fährten, Fraßspuren, Losungen, Gewölle u.a. Text: Preben Bang Zeichnungen: Preben Dahlström
 Tierspuren Fährten, Fraßspuren, Losungen, Gewölle u.a. Text: Preben Bang Zeichnungen: Preben Dahlström Was Sie in diesem Buch finden Vorwort 9 Hinweise zum Arbeiten mit dem Buch 10 Einführung 11 Fährten
Tierspuren Fährten, Fraßspuren, Losungen, Gewölle u.a. Text: Preben Bang Zeichnungen: Preben Dahlström Was Sie in diesem Buch finden Vorwort 9 Hinweise zum Arbeiten mit dem Buch 10 Einführung 11 Fährten
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief.
 Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Verordnung über die Jagdzeiten Landesjagdzeitenverordnung (LJZeitVO) 1 Vom
 Verordnung über die Jagdzeiten Landesjagdzeitenverordnung (LJZeitVO) 1 Vom.. 2015 Auf Grund der 2 und 24 Absatz 1 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember
Verordnung über die Jagdzeiten Landesjagdzeitenverordnung (LJZeitVO) 1 Vom.. 2015 Auf Grund der 2 und 24 Absatz 1 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 17/ Wahlperiode der Abgeordneten Marlies Fritzen (Bündnis 90/Die Grünen)
 SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 17/431 17. Wahlperiode 10-03-31 Kleine Anfrage der Abgeordneten Marlies Fritzen (Bündnis 90/Die Grünen) und Antwort der Landesregierung Ministerin für Landwirtschaft,
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 17/431 17. Wahlperiode 10-03-31 Kleine Anfrage der Abgeordneten Marlies Fritzen (Bündnis 90/Die Grünen) und Antwort der Landesregierung Ministerin für Landwirtschaft,
Winter-Rallye Tiere im Winter
 OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Winter-Rallye Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst
OPEL-ZOO Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung Seite 1 Winter-Rallye Tiere im Winter Im Winter ist es sehr kalt und die Nahrung wird knapp, so dass sich viele Tiere zurückziehen. Bereits im Herbst
Lebensraum: Feld Waldreviere zieht sich gerne in Baue zurück die er aber nicht selber baut (Mitbewohner in Dachsbauen)
 1 Raubwild: Fuchs: Lebensraum: Feld Waldreviere zieht sich gerne in Baue zurück die er aber nicht selber baut (Mitbewohner in Dachsbauen) Nahrung: - Mäuse, Aas, Fallwild Wildkaninchen, Junghasen, Rehkitze,
1 Raubwild: Fuchs: Lebensraum: Feld Waldreviere zieht sich gerne in Baue zurück die er aber nicht selber baut (Mitbewohner in Dachsbauen) Nahrung: - Mäuse, Aas, Fallwild Wildkaninchen, Junghasen, Rehkitze,
Streckenliste (A Schalenwild und B sonstige Wildarten)
 Landratsamt Amberg-Sulzbach Untere Jagdbehörde Schlossgraben 3 92224 Amberg Streckenliste (A Schalenwild und B sonstige Wildarten) für das Jagdjahr des 371 ( Kreis/Gemede), (lfd. des Reviers) Anleitung:
Landratsamt Amberg-Sulzbach Untere Jagdbehörde Schlossgraben 3 92224 Amberg Streckenliste (A Schalenwild und B sonstige Wildarten) für das Jagdjahr des 371 ( Kreis/Gemede), (lfd. des Reviers) Anleitung:
Tiere in der Bergbaufolgelandschaft
 Tiere in der Bergbaufolgelandschaft Bild: Seidenschwanz in Wanninchen Fotograf: Ralf Donat Seidenschwanz (Bombycilla garrulus). Singvogel aus der Familie der Seidenschwänze (Bombycillidae). Lebt in der
Tiere in der Bergbaufolgelandschaft Bild: Seidenschwanz in Wanninchen Fotograf: Ralf Donat Seidenschwanz (Bombycilla garrulus). Singvogel aus der Familie der Seidenschwänze (Bombycillidae). Lebt in der
Wildkunde/ Marder- und Katzenartige Frage 1 Wildkunde/ Marder- und Katzenartige Antwort 1
 / Marder- und Katzenartige Frage 1 / Marder- und Katzenartige Antwort 1 Erkläre den Begriff Verkehrtfärbung beim Dachs Bei der Verkehrtfärbung ist die Körperoberseite (Rücken) heller und die Körperunterseite
/ Marder- und Katzenartige Frage 1 / Marder- und Katzenartige Antwort 1 Erkläre den Begriff Verkehrtfärbung beim Dachs Bei der Verkehrtfärbung ist die Körperoberseite (Rücken) heller und die Körperunterseite
Der Kormoran in der Steiermark
 Der Kormoran in der Steiermark Ein Überblick über Bestandsentwicklung und Verbreitung. Sebastian Zinko Inhalt Allgemeines Verbreitung Bestandsentwicklung Jahreszeitliches Auftreten Herkunft unserer Kormorane
Der Kormoran in der Steiermark Ein Überblick über Bestandsentwicklung und Verbreitung. Sebastian Zinko Inhalt Allgemeines Verbreitung Bestandsentwicklung Jahreszeitliches Auftreten Herkunft unserer Kormorane
Der Grasfrosch. Lurch des Jahres 2018
 Der Grasfrosch Lurch des Jahres 2018 VON WOLF-RÜDIGER GROSSE Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) hat gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen den Grasfrosch zum Lurch
Der Grasfrosch Lurch des Jahres 2018 VON WOLF-RÜDIGER GROSSE Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) hat gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen den Grasfrosch zum Lurch
Rote Liste der Säugetiere (Mammalia pt.) Thüringens (ohne Fledermäuse)
 Rote Liste der Säugetiere (Mammalia pt.) Thüringens (ohne Fledermäuse) Feldhamster, Cricetus cricetus, aus der Umgebung von Sömmerda. (Aufn. T. Pröhl, fokus-natur) Rote Liste der Säugetiere (Mammalia pt.)
Rote Liste der Säugetiere (Mammalia pt.) Thüringens (ohne Fledermäuse) Feldhamster, Cricetus cricetus, aus der Umgebung von Sömmerda. (Aufn. T. Pröhl, fokus-natur) Rote Liste der Säugetiere (Mammalia pt.)
WILDTIERERFASSUNG IN NIEDERSACHSEN
 19.4.216 WILDTIERERFASSUNG IN NIEDERSACHSEN 1991-215 Vorkommen und Verbreitung von Dachs, Iltis, Stein- und Baummarder Dr. Egbert Strauß Landesjägerschaft Niedersachsen Institut für Terrestrische und Aquatische
19.4.216 WILDTIERERFASSUNG IN NIEDERSACHSEN 1991-215 Vorkommen und Verbreitung von Dachs, Iltis, Stein- und Baummarder Dr. Egbert Strauß Landesjägerschaft Niedersachsen Institut für Terrestrische und Aquatische
WILD: Die Volkszählung fürs Wild. Zensus Rebhuhn
 D E U T S C H E R J A G D S C H U T Z - V E R B A N D E. V. V E R E I N I G U N G D E R D E U T S C H E N L A N D E S J A G D V E R B Ä N D E WILD: Die Volkszählung fürs Wild Zensus Rebhuhn Kommt die Sprache
D E U T S C H E R J A G D S C H U T Z - V E R B A N D E. V. V E R E I N I G U N G D E R D E U T S C H E N L A N D E S J A G D V E R B Ä N D E WILD: Die Volkszählung fürs Wild Zensus Rebhuhn Kommt die Sprache
Management von Wasservögeln an Badestränden. Gerd Bauschmann Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
 Management von Wasservögeln an Badestränden Gerd Bauschmann Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 1 Jahresbrut (oft Nachgelege) Legezeit März bis Juni 7-11 (5-15) Eier
Management von Wasservögeln an Badestränden Gerd Bauschmann Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 1 Jahresbrut (oft Nachgelege) Legezeit März bis Juni 7-11 (5-15) Eier
Streckenliste (A und B) EJR / GJR
 Landratsamt Amberg-Sulzbach Untere Jagdbehörde Schlossgraben 3 92224 Amberg Streckenliste (A und B) für das Jagdjahr des EJR / GJR Anleitung: Der Nachweis über den getätigten Abschuss/Fang ist vom Revierhaber
Landratsamt Amberg-Sulzbach Untere Jagdbehörde Schlossgraben 3 92224 Amberg Streckenliste (A und B) für das Jagdjahr des EJR / GJR Anleitung: Der Nachweis über den getätigten Abschuss/Fang ist vom Revierhaber
Wildtiere und Wildtierlebensräume In Liechtenstein
 Seniorenkolleg 29. Oktober 2009 Wildtiere und Wildtierlebensräume In Liechtenstein Lic.phil.nat. Michael Fasel, Biologe, Amt für Wald, Natur und Landschaft, 9490 Vaduz Tel. 00423 236 64 05 Mail. Michael.fasel@awnl.llv.li
Seniorenkolleg 29. Oktober 2009 Wildtiere und Wildtierlebensräume In Liechtenstein Lic.phil.nat. Michael Fasel, Biologe, Amt für Wald, Natur und Landschaft, 9490 Vaduz Tel. 00423 236 64 05 Mail. Michael.fasel@awnl.llv.li
Definition Monitoring
 Mehr als Jagdbericht und Niederwildzensus Das Wildtiermonitoring der WFS Was bedeutet Wildtiermonitoring? Definition Monitoring aus dem Englischen = Überwachung, Beobachtung, Kontrolle Definition im JWMG
Mehr als Jagdbericht und Niederwildzensus Das Wildtiermonitoring der WFS Was bedeutet Wildtiermonitoring? Definition Monitoring aus dem Englischen = Überwachung, Beobachtung, Kontrolle Definition im JWMG
Schonzeiten für Raubwild und Neubürger?
 18. ÖSTERREICHISCHE JÄGERTAGUNG Schonzeiten für Raubwild und Neubürger? Fredy Frey-Roos Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft Universität für Bodenkultur Wien Raubwild in den österreichischen JG
18. ÖSTERREICHISCHE JÄGERTAGUNG Schonzeiten für Raubwild und Neubürger? Fredy Frey-Roos Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft Universität für Bodenkultur Wien Raubwild in den österreichischen JG
Sachgebiet 1 Wildbiologie
 Unterrichtsinhalte: 1.1 Biologie der Wildarten einschließlich Erkennungsmerkmale und Lebensweise verbindlich / fakultativ Klassen der Wirbeltiere: Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische Die Ordnungen
Unterrichtsinhalte: 1.1 Biologie der Wildarten einschließlich Erkennungsmerkmale und Lebensweise verbindlich / fakultativ Klassen der Wirbeltiere: Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische Die Ordnungen
Bestimmung heimischer Säuger
 Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft () Department für Integrative Biologie Universität für Bodenkultur Wien VO 832.110 Bestimmung heimischer Säuger Teil: Raubsäugetiere Teil 1 Frey-Roos Raubtiere
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft () Department für Integrative Biologie Universität für Bodenkultur Wien VO 832.110 Bestimmung heimischer Säuger Teil: Raubsäugetiere Teil 1 Frey-Roos Raubtiere
Jagdstatistik Kanton Solothurn
 Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik Kanton Solothurn
 Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Unser Haushund ( Canis lupus f. familiaris ) ist ein Säugetier welches innerhalb der Ordnung Raubtiere zur großen Familie der Hundeartigen gehört.
 Hundeverwandtschaft Unser Haushund ( Canis lupus f. familiaris ) ist ein Säugetier welches innerhalb der Ordnung Raubtiere zur großen Familie der Hundeartigen gehört. Hundeartige gibt es mit Ausnahme der
Hundeverwandtschaft Unser Haushund ( Canis lupus f. familiaris ) ist ein Säugetier welches innerhalb der Ordnung Raubtiere zur großen Familie der Hundeartigen gehört. Hundeartige gibt es mit Ausnahme der
Jagdstatistik Kanton Solothurn
 Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdrecht Schleswig-Holstein
 Jagdrecht Schleswig-Holstein Vorschriftensammlung mit Anmerkungen Bearbeitet von Fritz Maurischat 1. Auflage 2009. Taschenbuch. X, 296 S. Paperback ISBN 978 3 555 01465 4 Format (B x L): 12 x 17 cm Gewicht:
Jagdrecht Schleswig-Holstein Vorschriftensammlung mit Anmerkungen Bearbeitet von Fritz Maurischat 1. Auflage 2009. Taschenbuch. X, 296 S. Paperback ISBN 978 3 555 01465 4 Format (B x L): 12 x 17 cm Gewicht:
Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands
 Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands Ergebnisse Deutscher Jagdschutz-Verband e.v. Was ist WILD? Das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) ist ein bundesweites Monitoring-Programm,
Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands Ergebnisse Deutscher Jagdschutz-Verband e.v. Was ist WILD? Das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) ist ein bundesweites Monitoring-Programm,
Jagdstatistik Kanton Solothurn
 Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik Kanton Solothurn
 Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik Kanton Solothurn
 Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik Kanton Solothurn (DB Version 2008) bitte eintragen Revier Nummer: Revier Name: Namen gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Jagdgesetz (Anhang 1) Der Eintrag des Reviernamens erfolgt automatisch
Jagdstatistik 2015 Aufgrund der Jagdstatistik zusammengestellt von BirdLife Schweiz, 3.
 Jagdstatistik 2015 Aufgrund der Jagdstatistik http://www.wild.uzh.ch/jagdst/index.php zusammengestellt von BirdLife Schweiz, 3. Oktober 2016, WM Jagdbare Vogelarten Diverse Entenarten Gesamtschweizerisch
Jagdstatistik 2015 Aufgrund der Jagdstatistik http://www.wild.uzh.ch/jagdst/index.php zusammengestellt von BirdLife Schweiz, 3. Oktober 2016, WM Jagdbare Vogelarten Diverse Entenarten Gesamtschweizerisch
Gesetzentwurf. Deutscher Bundestag 10. Wahlperiode. Drucksache 10/1306. der Fraktion DIE GRÜNEN
 Deutscher Bundestag 10. Wahlperiode Drucksache 10/1306 13.04.84 Sachgebiet 792 Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesjagdgesetzes A. Problem Das Gesetz dient
Deutscher Bundestag 10. Wahlperiode Drucksache 10/1306 13.04.84 Sachgebiet 792 Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesjagdgesetzes A. Problem Das Gesetz dient
Streckenliste für das Jagdjahr
 Landratsamt Lörrach - Kreisjagdamt - Palmstraße 3 79539 Lörrach Telefon: 07621 / 410-3110 Streckenliste für das Jagdjahr... Name des Jagdausübungsberechtigten ggf. Namen der Mitpächter Straße PLZ, Ort
Landratsamt Lörrach - Kreisjagdamt - Palmstraße 3 79539 Lörrach Telefon: 07621 / 410-3110 Streckenliste für das Jagdjahr... Name des Jagdausübungsberechtigten ggf. Namen der Mitpächter Straße PLZ, Ort
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Jagd Stationen Aufgabenblätter. Aufgabe: Station 1. Der Wolf
 1/5 Aufgabe: Gehe von Station zu Station und löse die Aufgaben! Was ist an jedem Tier besonders? Mache dir Stichworte, damit du viel weisst, wenn du nachher gefragt wirst! Station 1 Der Wolf Aufgabe Diskutiert
1/5 Aufgabe: Gehe von Station zu Station und löse die Aufgaben! Was ist an jedem Tier besonders? Mache dir Stichworte, damit du viel weisst, wenn du nachher gefragt wirst! Station 1 Der Wolf Aufgabe Diskutiert
Marten Winter, Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (idiv) Leipzig
 Der Waschbär - Eine Erfolgsgeschichte und die Frage wieviel Schaden richtet er wirklich an? Marten Winter, Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (idiv) Leipzig Nordamerikanischer Waschbär
Der Waschbär - Eine Erfolgsgeschichte und die Frage wieviel Schaden richtet er wirklich an? Marten Winter, Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (idiv) Leipzig Nordamerikanischer Waschbär
FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT
 FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT IN DER SCHWEIZ UND IM KANTON BERN Weshalb verändert sich die Biodiversität? Die Biodiversität verändert sich zum einen durch langfristige und grossräumige
FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT IN DER SCHWEIZ UND IM KANTON BERN Weshalb verändert sich die Biodiversität? Die Biodiversität verändert sich zum einen durch langfristige und grossräumige
Vergleich der Klimanormalperiode mit den Projektionen für und Mittlere Temperatur im Frühjahr
 Kartenreihe 1 - Temperatur Vergleich der Klimanormalperiode mit den Projektionen für und Mittlere Temperatur im Frühjahr Referenzzustand März bis Mai Projektionen der Niederschlagsänderungen für die Monate
Kartenreihe 1 - Temperatur Vergleich der Klimanormalperiode mit den Projektionen für und Mittlere Temperatur im Frühjahr Referenzzustand März bis Mai Projektionen der Niederschlagsänderungen für die Monate
Bayerisches Landesamt für Umwelt
 NATURA 2000 - Vogelarten Alpenschneehuhn (Lagopus mutus) Das Alpenschneehuhn trägt im Winter bis auf die Schwanzfedern ein weißes Federkleid. Im Sommer sind nur die Flügel weiß, das restliche Federkleid
NATURA 2000 - Vogelarten Alpenschneehuhn (Lagopus mutus) Das Alpenschneehuhn trägt im Winter bis auf die Schwanzfedern ein weißes Federkleid. Im Sommer sind nur die Flügel weiß, das restliche Federkleid
Jagdrecht Schleswig-Holstein
 Kommunale Schriften für Schleswig-Holstein Jagdrecht Schleswig-Holstein Vorschriftensammlung mit Anmerkungen Bearbeitet von Fritz Maurischat Neuausgabe 2007. Taschenbuch. X, 286 S. Paperback ISBN 978 3
Kommunale Schriften für Schleswig-Holstein Jagdrecht Schleswig-Holstein Vorschriftensammlung mit Anmerkungen Bearbeitet von Fritz Maurischat Neuausgabe 2007. Taschenbuch. X, 286 S. Paperback ISBN 978 3
Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Bericht 2010
 Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 10. November 2010 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Bericht 2010 Einleitung Die Fotofallen der Sektion Jagd und Fischerei
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 10. November 2010 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Bericht 2010 Einleitung Die Fotofallen der Sektion Jagd und Fischerei
Eulen des Burgwalds. Warum sind Eulen so interessant?
 Eulen des Burgwalds Vom König und vom Kobold der Nacht Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.v., Lindenstr. 5, 61209 Echzell Arbeitskreis Marburg-Biedenkopf, In den Erlengärten 10,
Eulen des Burgwalds Vom König und vom Kobold der Nacht Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.v., Lindenstr. 5, 61209 Echzell Arbeitskreis Marburg-Biedenkopf, In den Erlengärten 10,
Rabenvögel. Saatkrähen (Corvus frugilegus) werden etwa 46 Zentimeter groß und wiegen 360 bis 670 Gramm, sind also etwa so groß wie
 Rabenvögel Corvidae Rabenvögel haben in den verschiedenen Kulturen einen ganz unterschiedlichen Ruf: Bei einigen Völkern gelten sie als Unglücksboten, bei anderen als Boten der Götter. Aussehen Gemeinsam
Rabenvögel Corvidae Rabenvögel haben in den verschiedenen Kulturen einen ganz unterschiedlichen Ruf: Bei einigen Völkern gelten sie als Unglücksboten, bei anderen als Boten der Götter. Aussehen Gemeinsam
des NATURSCHUTZAMTES des LANDKREIS STADE mit Unterstützung des LANDES NIEDERSACHSEN und des
 Verbesserung des Bruterfolges und der Eignung als Rastlebensraum für Wat- und Wasservögel. Ein des NATURSCHUTZAMTES des LANDKREIS STADE mit Unterstützung des LANDES NIEDERSACHSEN und des im EU-Vogelschutzgebiet
Verbesserung des Bruterfolges und der Eignung als Rastlebensraum für Wat- und Wasservögel. Ein des NATURSCHUTZAMTES des LANDKREIS STADE mit Unterstützung des LANDES NIEDERSACHSEN und des im EU-Vogelschutzgebiet
Gemeinde Horgenzell Bebauungsplan "Zogenweiler Kreuzbreite" Artenschutzrechtlicher Kurzbericht. Büro Sieber, Lindau (B) Datum:
 Gemeinde Horgenzell Bebauungsplan "Zogenweiler Kreuzbreite" Büro Sieber, Lindau (B) Datum: 01.10.2015 Artenschutzrechtlicher Kurzbericht 1. Allgemeines 1.1 Die Gemeinde Horgenzell beabsichtigt, am nordwestlichen
Gemeinde Horgenzell Bebauungsplan "Zogenweiler Kreuzbreite" Büro Sieber, Lindau (B) Datum: 01.10.2015 Artenschutzrechtlicher Kurzbericht 1. Allgemeines 1.1 Die Gemeinde Horgenzell beabsichtigt, am nordwestlichen
Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands. Ergebnisse 2005
 Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands Ergebnisse Was ist WILD? Das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) ist ein bundesweites Monitoring-Programm mit dem Daten zur Häufigkeit
Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands Ergebnisse Was ist WILD? Das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) ist ein bundesweites Monitoring-Programm mit dem Daten zur Häufigkeit
Einheimische Raubtiere Carnivora. Lösungsblätter. Unterrichtshilfe Einheimische Raubtiere (Carnivora)
 Unterrichtshilfe Einheimische Raubtiere Carnivora Lösungsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Unterrichtshilfe Einheimische Raubtiere Carnivora Lösungsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Merkblatt zum Artenschutz
 Merkblatt zum Artenschutz Umgang mit verletzten Tieren wild lebender Arten Verletzte, hilflose oder kranke Tiere besonders geschützter Arten dürfen nach 45 Abs. 5 BNatSchG vorbehaltlich jagdrechtlicher
Merkblatt zum Artenschutz Umgang mit verletzten Tieren wild lebender Arten Verletzte, hilflose oder kranke Tiere besonders geschützter Arten dürfen nach 45 Abs. 5 BNatSchG vorbehaltlich jagdrechtlicher
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Lehndorf, 01.12.2014 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Lehndorf, 01.12.2014 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
CC BY-SA 3.0 Wikipedia- 4028mdk09
 CC BY-SA 3.0 Wikipedia- 4028mdk09 Das Wildschwein ist der Vorfahre unseres Hausschweins lebt in Familienverbänden, die nennt man Rotte frisst gerne Kräuter, Eicheln, Schwammerl, Mäuse und Frösche liebt
CC BY-SA 3.0 Wikipedia- 4028mdk09 Das Wildschwein ist der Vorfahre unseres Hausschweins lebt in Familienverbänden, die nennt man Rotte frisst gerne Kräuter, Eicheln, Schwammerl, Mäuse und Frösche liebt
Die Eifel Winter und Frühling
 Der Nationalpark Eifel ist Lebensraum für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Im Film kommen verschiedene Tierarten vor, die alle in der Eifel beheimatet sind. Recherchiert in zwei Gruppen Informationen
Der Nationalpark Eifel ist Lebensraum für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Im Film kommen verschiedene Tierarten vor, die alle in der Eifel beheimatet sind. Recherchiert in zwei Gruppen Informationen
Ist die Einstellung der Jagd im Kanton Basel möglich und sinnvoll? Wildtierökologische Betrachtung
 Ist die Einstellung der Jagd im Kanton Basel möglich und sinnvoll? Wildtierökologische Betrachtung Josef H. Reichholf Em. Honorarprofessor für Naturschutz an der Technischen Universität München & früherer
Ist die Einstellung der Jagd im Kanton Basel möglich und sinnvoll? Wildtierökologische Betrachtung Josef H. Reichholf Em. Honorarprofessor für Naturschutz an der Technischen Universität München & früherer
Verordnung zur Änderung der Bundeswildschutzverordnung
 Bun d esrat Drucksache 132/18 23.04.18 Verordnung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft AV - U Verordnung zur Änderung der Bundeswildschutzverordnung A. Problem und Ziel Die Richtlinie
Bun d esrat Drucksache 132/18 23.04.18 Verordnung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft AV - U Verordnung zur Änderung der Bundeswildschutzverordnung A. Problem und Ziel Die Richtlinie
Dachs 42 Fischotter 42 Europäischer Seehund 43 Waschbär 44 Marderhund 44 Nutria 45 Mink 45
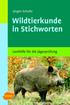 Inhalt Auf einen Blick (Haarwild) Tabelle 1 Lebensraum, Lebensweise, Nahrung Tabelle 2 Brunft/Rauschzeit, Tragezeit, Zahl der Jungen Tabelle 3 Fährte/Spur, Trophäe, Losung, Zahnformel Auf einen Blick (Federwild)
Inhalt Auf einen Blick (Haarwild) Tabelle 1 Lebensraum, Lebensweise, Nahrung Tabelle 2 Brunft/Rauschzeit, Tragezeit, Zahl der Jungen Tabelle 3 Fährte/Spur, Trophäe, Losung, Zahnformel Auf einen Blick (Federwild)
Rabenvögel ins rechte Licht gerückt
 Rabenvögel ins rechte Licht gerückt Zu den Beschreibungen von Elster, Aaskrähe, Rabenkrähe, Nebelkrähe, Eichelhäher, Dohle, Kolkrabe und Saatkrähe Elster (Pica pica) Elstern gehören zur Familie der Rabenvögel.
Rabenvögel ins rechte Licht gerückt Zu den Beschreibungen von Elster, Aaskrähe, Rabenkrähe, Nebelkrähe, Eichelhäher, Dohle, Kolkrabe und Saatkrähe Elster (Pica pica) Elstern gehören zur Familie der Rabenvögel.
ENTWURFSSTAND 20. September 2016
 20. September 2016 1 3.0 2 . EG- VSchRL: I - Anhang I. BNatSchG - - bes. geschützt, - streng geschützt. BJagdG - ganzjährige Schonzeit bzw. Jagdzeit. Rote Liste - V - Vorwarnliste, 2 - stark gefährdet,
20. September 2016 1 3.0 2 . EG- VSchRL: I - Anhang I. BNatSchG - - bes. geschützt, - streng geschützt. BJagdG - ganzjährige Schonzeit bzw. Jagdzeit. Rote Liste - V - Vorwarnliste, 2 - stark gefährdet,
Pressemitteilung. Streckenergebnis des Jagdjahres 2016/17. Zu einzelnen Wildarten:
 Pressemitteilung 30.05.2017 Ernst-Kamieth-Straße 2 06112 Halle (Saale) Telefon (0345) 514-0 31.08.2011 Telefax (0345) 514 1444 www.landesverwaltungsamt.sachsenanhalt.de Streckenergebnis des Jagdjahres
Pressemitteilung 30.05.2017 Ernst-Kamieth-Straße 2 06112 Halle (Saale) Telefon (0345) 514-0 31.08.2011 Telefax (0345) 514 1444 www.landesverwaltungsamt.sachsenanhalt.de Streckenergebnis des Jagdjahres
Windpark Uckley. Ausgleichsmaßnahmen
 Ausgleichsmaßnahmen Trotz sorgfältiger Planung sind Eingriffe in die Natur beim Bau eines Windparks unausweichlich. Um diese zu kompensieren, müssen Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen umgesetzt werden. Welche
Ausgleichsmaßnahmen Trotz sorgfältiger Planung sind Eingriffe in die Natur beim Bau eines Windparks unausweichlich. Um diese zu kompensieren, müssen Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen umgesetzt werden. Welche
Neues Jagdrecht. Einfach für Jäger Verantwortung zutrauen Starker Naturschutz Hinwendung zum Tierschutz effiziente Jagdbehörde Weniger Bürokratie
 Neues Jagdrecht Mut zum Umdenken! Einfach für Jäger Verantwortung zutrauen Starker Naturschutz Hinwendung zum Tierschutz effiziente Jagdbehörde Weniger Bürokratie 22.6.2012 FDir. Christian Kirch, Waldenbuch
Neues Jagdrecht Mut zum Umdenken! Einfach für Jäger Verantwortung zutrauen Starker Naturschutz Hinwendung zum Tierschutz effiziente Jagdbehörde Weniger Bürokratie 22.6.2012 FDir. Christian Kirch, Waldenbuch
Stellungnahme. Sehr geehrte Damen und Herren,
 16 Stellungnahme STELLUNGNAHME 16/2524 Zweites Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften (Ökologisches Jagdgesetz) (GesEntw Drs 16/7383) vom 24.11.2014
16 Stellungnahme STELLUNGNAHME 16/2524 Zweites Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften (Ökologisches Jagdgesetz) (GesEntw Drs 16/7383) vom 24.11.2014
Legekreis Heimische Vögel
 Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Der Hund ernährt sich zum Beispiel von Fleisch, Wasser und Hundefutter.
 Tierlexikon Der Hund Der Hund stammt vom Wolf ab. Er lebt als Haustier beim Menschen. Der Hund kann klein sein,wie ein Chihuahua, oder groß wie ein Irischer Wolfshund. Sein Gewicht liegt zwischen 600 g
Tierlexikon Der Hund Der Hund stammt vom Wolf ab. Er lebt als Haustier beim Menschen. Der Hund kann klein sein,wie ein Chihuahua, oder groß wie ein Irischer Wolfshund. Sein Gewicht liegt zwischen 600 g
Muster Original 50 ct
 Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 8 Jahre Am Bach entlang: Einheimische Tiere Bevor du losgehst: Die Räume sind nummeriert, damit man sich besser zurechtfindet. Rechts von der großen Säulenhalle steht
Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 8 Jahre Am Bach entlang: Einheimische Tiere Bevor du losgehst: Die Räume sind nummeriert, damit man sich besser zurechtfindet. Rechts von der großen Säulenhalle steht
Der Rotfuchs. 3.1 Arbeitsblatt Name: Datum: Tiersteckbrief: Der Rotfuchs DVD-Kapitel 1. So sieht der Fuchs aus:
 Tiersteckbrief: DVD-Kapitel 1 So sieht der Fuchs aus: Körperhöhe Körperlänge Gewicht Färbung des Fells, des Schwanzes (Lunte), der Beine (Läufe) Auf diesen Teilen der Erde lebt der Fuchs: Der Fuchs frisst:
Tiersteckbrief: DVD-Kapitel 1 So sieht der Fuchs aus: Körperhöhe Körperlänge Gewicht Färbung des Fells, des Schwanzes (Lunte), der Beine (Läufe) Auf diesen Teilen der Erde lebt der Fuchs: Der Fuchs frisst:
Die Jagdstrecke des Jagdjahres 2013/2014
 WFS-MITTEILUNGEN Nr. 3/214 LANDWIRTSCHAFTLICHES ZENTRUM FÜR RINDERHALTUNG, GRÜNLANDWIRTSCHAFT, MILCHWIRTSCHAFT, WILD UND FISCHEREI BADEN-WÜRTTEMBERG (LAZBW) WILDFORSCHUNGSSTELLE AULENDORF 88326 Aulendorf,
WFS-MITTEILUNGEN Nr. 3/214 LANDWIRTSCHAFTLICHES ZENTRUM FÜR RINDERHALTUNG, GRÜNLANDWIRTSCHAFT, MILCHWIRTSCHAFT, WILD UND FISCHEREI BADEN-WÜRTTEMBERG (LAZBW) WILDFORSCHUNGSSTELLE AULENDORF 88326 Aulendorf,
Das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands
 Das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands Voraussetzungen für eine nachhaltige Nutzung von Tierpopulationen sind: 1. belastbare Informationen zur Populationsdichte und -trends sowie 2. die
Das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands Voraussetzungen für eine nachhaltige Nutzung von Tierpopulationen sind: 1. belastbare Informationen zur Populationsdichte und -trends sowie 2. die
Naturreichtum im Ballungsraum Tiervielfalt auf den Feldern des Ruhrgebiets
 Tierfotografie Naturreichtum im Ballungsraum Tiervielfalt auf den Feldern des Ruhrgebiets Natur im Ruhrgebiet? Manch einer wird sich aufgrund tiefsitzener Klischees von Kohle, Stahl und Kumpeln mit einem
Tierfotografie Naturreichtum im Ballungsraum Tiervielfalt auf den Feldern des Ruhrgebiets Natur im Ruhrgebiet? Manch einer wird sich aufgrund tiefsitzener Klischees von Kohle, Stahl und Kumpeln mit einem
EU gegen fremde Arten: Waschbär und Nutria sollen verschwinden , 15:55 Uhr dpa, feelgreen.de
 EU gegen fremde Arten: Waschbär und Nutria sollen verschwinden 17.07.2016, 15:55 Uhr dpa, feelgreen.de Chinesische Muntjaks oder Zwergmuntjaks sind aus Asien stammende, kleine Hirsche. Das Bild zeigt ein
EU gegen fremde Arten: Waschbär und Nutria sollen verschwinden 17.07.2016, 15:55 Uhr dpa, feelgreen.de Chinesische Muntjaks oder Zwergmuntjaks sind aus Asien stammende, kleine Hirsche. Das Bild zeigt ein
Gesetz- und Verordnungsblatt
 Gesetz- und Verordnungsblatt 109 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin Herausgeber: Senatsverwaltung für Justiz 63. Jahrgang Nr. 6 Berlin, den 10. März 2007 A 3227 A Inhalt 6. 3. 2007 Siebzehntes Gesetz
Gesetz- und Verordnungsblatt 109 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin Herausgeber: Senatsverwaltung für Justiz 63. Jahrgang Nr. 6 Berlin, den 10. März 2007 A 3227 A Inhalt 6. 3. 2007 Siebzehntes Gesetz
1. Organisatorisches für die JHV der Jägerschaft ROW
 1. Organisatorisches für die JHV der Jägerschaft ROW 4 Helfer aus 4 Revieren auf der jährlichen JHV der Jägerschaft Rotenburg/Wümme Lfd. Nr. zuständiges Revier/ Jagdbezirk 1 Helfer / Revier zur JHV der
1. Organisatorisches für die JHV der Jägerschaft ROW 4 Helfer aus 4 Revieren auf der jährlichen JHV der Jägerschaft Rotenburg/Wümme Lfd. Nr. zuständiges Revier/ Jagdbezirk 1 Helfer / Revier zur JHV der
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räumet des Landes Schleswig-Holstein Situation der Saatkrähen in Schleswig-Holstein,
 Situation der Saatkrähen in, Rüdiger Albrecht, ländliche Räume 1 Rabenvögel in S.-H. Kolkrabe Jagdrecht keine Jagdzeit Rabenkrähe Nebelkrähe seit 2015 keine Jagdzeit Elster seit 2015 keine Jagdzeit Dohle
Situation der Saatkrähen in, Rüdiger Albrecht, ländliche Räume 1 Rabenvögel in S.-H. Kolkrabe Jagdrecht keine Jagdzeit Rabenkrähe Nebelkrähe seit 2015 keine Jagdzeit Elster seit 2015 keine Jagdzeit Dohle
Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus) (Stand November 2011)
 Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen Wertbestimmende Brutvogelarten der EU-Vogelschutzgebiete Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)
Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen Wertbestimmende Brutvogelarten der EU-Vogelschutzgebiete Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)
Wildpark-Rallye. Für Jugendliche ab 15 Jahre
 Gleich beginnt für euch die. Die Antworten erhaltet ihr durch Beobachten, Schätzen oder Lesen der Infotafeln bei den Tiergehegen. Manche setzen jedoch auch Allgemeinbildung voraus. Bei jeder Frage können
Gleich beginnt für euch die. Die Antworten erhaltet ihr durch Beobachten, Schätzen oder Lesen der Infotafeln bei den Tiergehegen. Manche setzen jedoch auch Allgemeinbildung voraus. Bei jeder Frage können
Museumskiste Winterspeck und Pelzmantel
 Museumskiste Winterspeck und Pelzmantel Lösungen MS Wer ist hier der Dachs? Biber Wildschwein Baummarder Igel Murmeltier 1 - Umkreise den Dachs und schreibe die Namen der anderen Tiere dazu. 2 - Wer bleibt
Museumskiste Winterspeck und Pelzmantel Lösungen MS Wer ist hier der Dachs? Biber Wildschwein Baummarder Igel Murmeltier 1 - Umkreise den Dachs und schreibe die Namen der anderen Tiere dazu. 2 - Wer bleibt
Erlebnismobil Wild Wald Wissen
 Erlebnismobil Wild Wald Wissen ANHÄNGER 1 / ERLEBNISMOBIL Inventarliste Übernahme- / Rückgabeprotokoll übernahme Sauberkeit Zustand Pneu Zustand Elektroanschluss Erkennbare Defekte Zustand Lichter/Folie
Erlebnismobil Wild Wald Wissen ANHÄNGER 1 / ERLEBNISMOBIL Inventarliste Übernahme- / Rückgabeprotokoll übernahme Sauberkeit Zustand Pneu Zustand Elektroanschluss Erkennbare Defekte Zustand Lichter/Folie
06 Artenschutzrechtliche Vorprüfung
 06 Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan samt örtlicher Bauvorschriften Löhl V, Legelshurst im beschleunigten Verfahren gem. 13a BauGB Fassung für die Offenlage 17.06.2016 Projekt: 1627 Bearbeiter:
06 Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan samt örtlicher Bauvorschriften Löhl V, Legelshurst im beschleunigten Verfahren gem. 13a BauGB Fassung für die Offenlage 17.06.2016 Projekt: 1627 Bearbeiter:
WILD: Die Volkszählung fürs Wild Meister Grimbart
 a b r q p ` e b o g ^ d a p ` e r q w J s b o _ ^ k a b K s K s bobfkfdrkdaboabrqp`ebki ^kabpg^dasbo_ûkab WILD: Die Volkszählung fürs Wild Meister Grimbart Warum wird der Dachs im WILD erfasst? Ähnlich
a b r q p ` e b o g ^ d a p ` e r q w J s b o _ ^ k a b K s K s bobfkfdrkdaboabrqp`ebki ^kabpg^dasbo_ûkab WILD: Die Volkszählung fürs Wild Meister Grimbart Warum wird der Dachs im WILD erfasst? Ähnlich
Ratgeber FÄHRTEN UND SPUREN
 Ratgeber FÄHRTEN UND SPUREN EINLEITUNG INHALTSVERZEICHNIS Wildtiere faszinieren Inhalt Alle Wildtiere hinterlassen Spuren. In Schnee und in feuchten Böden sind sie besonders gut zu erkennen. Mit diesem
Ratgeber FÄHRTEN UND SPUREN EINLEITUNG INHALTSVERZEICHNIS Wildtiere faszinieren Inhalt Alle Wildtiere hinterlassen Spuren. In Schnee und in feuchten Böden sind sie besonders gut zu erkennen. Mit diesem
Wildpark-Rallye Für Kinder ab 15 Jahre
 Gleich beginnt für Euch die Wildpark-Rallye. Die Antworten erhaltet ihr durch Beobachten, Schätzen oder Lesen der Infotafeln. Manche setzen jedoch auch Allgemein-Bildung voraus. Bei jeder Frage können
Gleich beginnt für Euch die Wildpark-Rallye. Die Antworten erhaltet ihr durch Beobachten, Schätzen oder Lesen der Infotafeln. Manche setzen jedoch auch Allgemein-Bildung voraus. Bei jeder Frage können
Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten?
 Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten? Die Bedeutung des Schutzes von Lebensräumen am Beispiel des Vogelschutzgebietes Düsterdieker Niederung Maike Wilhelm, Biologische Station
Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten? Die Bedeutung des Schutzes von Lebensräumen am Beispiel des Vogelschutzgebietes Düsterdieker Niederung Maike Wilhelm, Biologische Station
Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2011
 Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 9. Januar 2012 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2011 Übersicht und Einleitung Abb. 1: Untersuchte Quadrate
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 9. Januar 2012 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Kurzbericht 2011 Übersicht und Einleitung Abb. 1: Untersuchte Quadrate
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere
 Hüpfdiktat 1 - Waldtiere 1 trägt seinen Namen, 2 jedoch werden sie etwa 3 auf Bäumen mit Blättern A B C D E F Früchte, Eicheln, Im August bringt Waldkauz, Katzen, Tiere haben viele Feinde, herumklettern
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere 1 trägt seinen Namen, 2 jedoch werden sie etwa 3 auf Bäumen mit Blättern A B C D E F Früchte, Eicheln, Im August bringt Waldkauz, Katzen, Tiere haben viele Feinde, herumklettern
Satzanfang/Satzende 1. Lies den Text. Setze nach jedem Satzende einen Strich. (/)
 Satzanfang/Satzende 1 Lies den Text. Setze nach jedem Satzende einen Strich. (/) die Wildschweine sind in unseren Wäldern die größten Tiere am Tag verstecken sie sich im Unterholz erst abends und in der
Satzanfang/Satzende 1 Lies den Text. Setze nach jedem Satzende einen Strich. (/) die Wildschweine sind in unseren Wäldern die größten Tiere am Tag verstecken sie sich im Unterholz erst abends und in der
Verordnung über den Schutz von Wild (Bundeswildschutzverordnung - BWildSchV)
 Verordnung über den Schutz von Wild (Bundeswildschutzverordnung - BWildSchV) BWildSchV Ausfertigungsdatum: 25.10.1985 Vollzitat: "Bundeswildschutzverordnung vom 25. Oktober 1985 (BGBl. I S. 2040), die
Verordnung über den Schutz von Wild (Bundeswildschutzverordnung - BWildSchV) BWildSchV Ausfertigungsdatum: 25.10.1985 Vollzitat: "Bundeswildschutzverordnung vom 25. Oktober 1985 (BGBl. I S. 2040), die
Stieleiche (Quercus robur L.) Forstliche Herkunftsgebiete in der Bundesrepublik Deutschland
 Stieleiche (Quercus robur L.) Forstliche Herkunftsgebiete in der Bundesrepublik Deutschland 817 01 Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch- Westfälische Bucht 817 02 Ostsee-Küstenraum 817 03 Heide und
Stieleiche (Quercus robur L.) Forstliche Herkunftsgebiete in der Bundesrepublik Deutschland 817 01 Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch- Westfälische Bucht 817 02 Ostsee-Küstenraum 817 03 Heide und
