BILDUNGSPLAN DES GYMNASIUMS. Bildungsplan Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT)
|
|
|
- Sarah Schuster
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 BILDUNGSPLAN DES GYMNASIUMS Bildungsplan 2016 Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT)
2 KULTUS UND UNTERRICHT AMTSBLATT DES MINISTERIUMS FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG Stuttgart, den 23. März 2016 BILDUNGSPLAN DES GYMNASIUMS Vom 23. März 2016 Az /370/292 I. Der Bildungsplan des Gymnasiums gilt für das Gymnasium der Normalform und Aufbauform mit Heim sowie für Schulen besonderer Art. II. Der Bildungsplan tritt am 1. August 2016 mit der Maßgabe in Kraft, dass er erstmals für die Schülerinnen und Schüler Anwendung findet, die im Schuljahr 2016/2017 in die Klassen 5 und 6 eintreten. Gleichzeitig tritt der Bildungsplan für das Gymnasium der Normalform vom 21. Januar 2004 (Lehrplanheft 4/2004) mit der Maßgabe außer Kraft, dass er letztmals für die Schülerinnen und Schüler gilt, die vor dem Schuljahr 2016/2017 in die Klasse 6 eingetreten sind. Abweichend hiervon tritt der Fachplan Literatur und Theater am 1. August 2016 mit der Maßgabe in Kraft, dass er erstmals für Schülerinnen und Schüler Anwendung findet, die im Schuljahr 2016/2017 in die Jahrgangsstufe 1 eintreten. Gleichzeitig tritt der Bildungsplan für das Fach Literatur und Theater in der Kursstufe des Gymnasiums der Normalform und der Aufbauform mit Heim (K.u.U. 2012, S. 122) mit der Maßgabe außer Kraft, dass er letztmals für die Schülerinnen und Schüler gilt, die vor dem Schuljahr 2016/2017 in die Jahrgangsstufe 1 eingetreten sind. K.u.U., LPH 3/2016 BEZUGSSCHLÜSSEL FÜR DIE BILDUNGSPLÄNE DER ALLGEMEIN BILDENDEN SCHULEN 2016 Reihe Bildungsplan Bezieher A Bildungsplan der Grundschule Grundschulen, Schule besonderer Art Heidelberg, alle sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren S Gemeinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I Werkrealschulen/Hauptschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Schulen besonderer Art, alle sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren G Bildungsplan des Gymnasiums allgemein bildende Gymnasien, Schulen besonderer Art, sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat mit Förderschwerpunkt Hören, Stegen O Bildungsplan der Oberstufe an Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschulen Nummerierung der kommenden Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen: LPH 1/2016 Bildungsplan der Grundschule, Reihe A Nr. 10 LPH 2/2016 Gemeinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I, Reihe S Nr. 1 LPH 3/2016 Bildungsplan des Gymnasiums, Reihe G Nr. 16 LPH 4/2016 Bildungsplan der Oberstufe an Gemeinschaftsschulen, Reihe O Nr. 1 Der vorliegende Fachplan ist als Heft Nr. 23 (Pflichtbereich) Bestandteil des Bildungsplans des Gymnasiums, der als Bildungsplanheft 3/2016 in der Reihe G erscheint, und kann einzeln bei der Neckar-Verlag GmbH bezogen werden.
3 Inhaltsverzeichnis 1. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Bildungswert des Fächerverbundes Kompetenzen Didaktische Hinweise Prozessbezogene Kompetenzen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung Herstellung Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/ Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik Materialien trennen Umwelt schützen Wasser ein lebenswichtiger Stoff Energie effizient nutzen Wirbeltiere Entwicklung des Menschen Wirbellose Pflanzen Ökologie Operatoren Anhang Verweise Abkürzungen Geschlechtergerechte Sprache Besondere Schriftauszeichnungen Inhaltsverzeichnis 1
4 2
5 1. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 1.1 Bildungswert des Fächerverbundes Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) Der Fächerverbund umfasst integrative Themen bereiche mit biologischen, chemischen, physikalischen und technischen Aspekten sowie fachsystematische Themenbereiche der Biologie. Er hat eine Brückenfunktion zwischen dem integrativen Sachunterricht der Grundschule und den naturwissenschaftlichen Fächern der weiterführenden Schulen ab Klasse 7, die sich an der Fachsystematik orientieren. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Einblick in die beeindruckende Welt der Naturwissenschaften und der Technik, die viele Bereiche ihres Lebens beeinflusst. Sie lernen Zusammenhänge und einfache Gesetzmäßigkeiten kennen, die ihnen helfen, ihre Vorstellungs- und Erfahrungswelt zu ordnen und zu erweitern. Das in natürlicher Weise vorhandene Interesse an Phänomenen der belebten und unbelebten Natur wird im Fächerverbund BNT genutzt, um Schülerinnen und Schüler für naturwissenschaftliche und technische Fragestellungen zu begeistern. Beitrag des Faches zu den Leitperspektiven In welcher Weise der Fächerverbund BNT einen Beitrag zu den Leitperspektiven leistet, wird im Folgenden dargestellt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Die im Fächerverbund erworbenen Kenntnisse stärken das Bewusstsein für die Möglichkeiten und Notwendigkeit nachhaltigen Handelns im Sinne der Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch die im Unterricht erworbenen Kompetenzen werden die Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsvollem und umweltbewusstem Handeln angeregt. Der ressourcenschonende Umgang mit Stoffen, der sorgsame Umgang mit Energie, die Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen sowie die Herstellung und Entsorgung technischer Produkte werden kritisch im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung hinterfragt. Prävention und Gesundheitsförderung (PG) Kenntnisse über das Gefahrenpotenzial von Stoffen tragen zum sicheren Umgang mit diesen sowohl im schulischen wie auch außerschulischen Bereich bei. In vielfältigen handlungsorientierten Tätigkeiten wird der sicherheitsbewusste Umgang mit Experimentiergeräten, Werkzeugen und Werkstoffen eingeübt und damit ein Beitrag zur Leitperspektive Prävention und Gesundheitsförderung geleistet. Die spezifischen Arbeitsweisen in BNT können die Selbstregulation, das selbstständige und kooperative Lernen sowie die Team- und Kommunikationsfähigkeit junger Menschen im Sinne dieser Leitperspektive fördern. Berufliche Orientierung (BO) Der Unterricht im Fächerbund BNT kann auch einen Beitrag zur beruflichen Orientierung leisten. Durch das vielfältige praktische Arbeiten in BNT können die Schülerinnen und Schüler Interesse Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 3
6 an den Naturwissenschaften entwickeln und gegebenenfalls ihre individuellen Stärken erkennen. Die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit Technik dient zur Berufsorientierung in technikaffinen Bereichen vor dem Hintergrund der persönlichen Interessen und Neigungen. Medienbildung (MB) Zur Medienbildung gehören sehr vielfältige Bereiche, wie die verantwortungsbewusste Nutzung von Informationstechnologien oder das selbstbestimmte Leben in einer Mediengesellschaft. In BNT kommen vielfältige Medien als Informationsquelle und zur Veranschaulichung zum Einsatz. Sowohl bei der Erarbeitung von fachlichen Inhalten als auch bei der Präsentation von Arbeitsergebnissen greifen die Schülerinnen und Schüler in BNT auf verschiedene Medien zurück und üben so den Umgang mit diesen. Verbraucherbildung (VB) Das in BNT erworbene Wissen über den Nutzen und das Gefahrenpotenzial von Stoffen für Mensch und Umwelt sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler für ein verantwortungsvolles Konsumverhalten im Alltag. Die kritische Auseinandersetzung mit Aussagen in Werbung und Produktgestaltung ermöglicht ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Verbraucherverhalten. Eine nachhaltige Verbraucherbildung wird durch die kritische Analyse der Qualität technischer Produkte sowie deren Herstellung, Verwendung, Verwertung und Entsorgung gefördert. 4 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
7 1.2 Kompetenzen Die prozessbezogenen Kompetenzen gliedern sich in Anlehnung an die Vorgaben der Kultusministerkonferenz für die naturwissenschaftlichen Fächer in die Bereiche Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewertung und Herstellung. Sie werden im Bildungsplan getrennt aufgeführt, jedoch im Unterrichtsprozess gemeinsam mit den inhaltsbezogenen Kompetenzen erworben. Die inhaltsbezogenen Themenbereiche umfassen vier integrative naturwissenschaftlich-technische Bereiche und fünf fachsystematische Bereiche der Biologie. Den integrativen Themenbereichen kommt dabei eine überfachliche und propädeutische Bedeutung zu, während sich die biologischen Bereiche bereits an der Fachsystematik des Faches Biologie orientieren. Inhaltsbezogene Themenbereiche ( Landesinstitut für Schulentwicklung) Integrative Themenbereiche Der Bereich der naturwissenschaftlichen und technischen Denk- und Arbeitsweisen erstreckt sich über alle inhaltsbezogenen Themenbereiche und stellt eine Schnittstelle zwischen inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen dar: Die Schülerinnen und Schüler lernen unterschiedliche Fachmethoden an konkreten Inhalten handlungsorientiert kennen. Sie wenden in altersgemäßer Form die Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und die der Technik an. Im Rahmen von naturwissenschaftlichen Fragestellungen beobachten und beschreiben sie Phänomene und versuchen erste Erklärungsansätze zu formulieren (kausaler Ansatz). In der Technik wenden sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zielorientiert an, um Lösungen für Problemstellungen zu entwickeln und zu realisieren (finaler Ansatz). Dabei beschreiben die Schülerinnen und Schüler ihr Vorgehen. Ihre Ergebnisse stellen sie verständlich und zunehmend unter Verwendung von Fachbegriffen dar. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 5
8 Themenbereiche der Biologie In den Themenbereichen Wirbeltiere, Wirbellose, Pflanzen, Ökologie und Entwicklung des Menschen lernen die Schülerinnen und Schüler Betrachtungsweisen und Konzepte der erklärenden Wissenschaft Biologie kennen. Die Basiskonzepte der Kultusministerkonferenz für das Fach Biologie, Struktur und Funktion, Entwicklung und System, finden als Erklärungsmuster auf der Ebene der Organismen ihre Anwendung. Die biologischen Prinzipien sind diesen Basiskonzepten zugeordnet. Das Konzept Struktur und Funktion wird auf der Ebene der Organismen durch Beschreiben und Skizzieren anatomischer und morphologischer Strukturen mit Bezug auf deren Funktionen verstanden. Entwicklung begegnet den Schülerinnen und Schülern bei der Individualentwicklung von Tieren, Pflanzen und dem Menschen. Angepasstheiten sind das Ergebnis von evolutiven Entwicklungen. Den Systemgedanken entwickeln die Schülerinnen und Schüler durch Beobachtung und Beschreibung der komplexen Leistungen der Lebewesen und deren vielseitiger Wechselwirkung mit ihrer Umwelt. Auf der Basis einer angemessenen Artenkenntnis entwickeln die Schülerinnen und Schüler Achtung vor der Natur. Sie verstehen die wechselseitige Abhängigkeit von Mensch und Umwelt und werden für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur sensibilisiert. 1.3 Didaktische Hinweise Ein vorrangiges Anliegen des Unterrichts in BNT ist es, die Schülerinnen und Schüler für naturwissenschaftliche und technische Fragestellungen zu begeistern. Dazu eignen sich die Freude an der Natur und der Vielfalt des Lebens, das Staunen über Naturphänomene und der Erfolg beim Herstellen eigener Produkte. Die direkte Naturerfahrung, die eigene Naturbeobachtung, das selbst durchgeführte Experiment und das selbst gelöste technische Problem stehen im Zentrum des Unterrichts. Primärerfahrungen sind den Sekundärerfahrungen vorzuziehen. Dazu ist es insbesondere bei den biologischen Themen notwendig, auch Lernorte außerhalb des Schulgebäudes aufzusuchen oder Langzeitbeobachtungen durchzuführen und zu dokumentieren. Die Alltagserfahrungen und Präkonzepte der Schülerinnen und Schüler stellen den Ausgangspunkt für Lernprozesse dar. Regelmäßige Diagnosen können Auskunft darüber geben, über welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler bereits verfügen und welche sie noch weiterentwickeln sollen. Der Unterricht folgt hinsichtlich der Bildung für nachhaltige Entwicklung und des globalen Lernens einem pädagogischen Dreischritt vom Sensibilisieren über das Befähigen hin zum Ermutigen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Gespür für die Auswirkungen ihres Handelns, leiten daraus einfache Verhaltensweisen für den Alltag ab und sind zur Umsetzung motiviert. Die integrativen Bereiche verfolgen einen fächerverbindenden, kontextorientierten Ansatz. Bei der Umsetzung im Unterricht ist ein fachsystematisches Vorgehen dem kontextorientierten Vorgehen unterzuordnen. Naturwissenschaften und Technik verfolgen unterschiedliche Wege der Erkenntnisgewinnung. Die Schülerinnen und Schüler sollen in altersgemäßer Weise den Unterschied zwischen naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen erkennen: die Naturwissenschaften fragen nach dem Warum, die Technik nach dem Wie. 6 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
9 Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung geht von beobachteten Phänomenen und Fragen an die Natur aus, die zu Vermutungen führen. Diese werden im Experiment überprüft. Erklärungsansätze sollen weitgehend von den Schülerinnen und Schülern formuliert werden. Die Einführung ab strakter Modelle und Theorien ist nicht vorgesehen. Stufenspezifische Hinweise Der Unterricht des Fächerverbundes BNT baut auf den im Sachunterricht der Grundschule erworbenen Kompetenzen auf und führt diese fort. Der sich daran anschließende Fachunterricht in den Basisfächern Biologie, Chemie, Physik sowie im Profilfach Naturwissenschaft und Technik baut auf den in BNT erworbenen Kompetenzen auf und setzt diese voraus. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 7
10 2. Prozessbezogene Kompetenzen 2.1 Erkenntnisgewinnung Beim eigenen Experimentieren erleben die Schülerinnen und Schüler Phänomene in Natur und Technik und beschreiben diese sorgfältig. Dabei können sie zunehmend zwischen Beobachtung und Erklärung unterscheiden. Sie gewinnen weitere Einblicke in die naturwissenschaftlichen und technischen Denk- und Arbeitsweisen sowie zugehörige Berufsfelder. Ausgehend von kindlichen Vorstellungen verstehen die Schülerinnen und Schüler Naturphänomene und Zusammenhänge mithilfe von einfachen Sachmodellen. Durch zielgerichtete Beobachtungen und den kriteriengeleiteten Vergleich von Organismen gewinnen sie Erkenntnisse hinsichtlich Anatomie, Morphologie und Verwandtschaft. technische Objekte hinsichtlich ihres Zwecks, ihrer Funktion und ihrer Wirkungsweise verstehen und beschreiben. 1. Phänomene beobachten und beschreiben 2. subjektive Wahrnehmungen beschreiben und von objektiven Messungen unterscheiden 3. einfache Messungen durchführen 4. zunehmend Beobachtungen von Erklärungen unterscheiden 5. zu naturwissenschaftlichen Phänomenen und technischen Sachverhalten Fragen formulieren, Vermutungen aufstellen und experimentell überprüfen 6. Experimente unter Anleitung planen, durchführen, auswerten 7. ein Sachmodell kritisch einsetzen 8. Gestaltmerkmale von Lebewesen kriterienbezogen beschreiben und vergleichen 9. einfache Bestimmungshilfen sachgerecht anwenden 10. einfache Ansätze zur Lösung eines naturwissenschaftlichen beziehungsweise technischen Problems entwickeln 8 Prozessbezogene Kompetenzen
11 2.2 Kommunikation Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich über naturwissenschaftliche Beobachtungen und technische Sachverhalte aus. Sie beschreiben Phänomene und Vorgänge alltagssprachlich und zunehmend unter Verwendung von Fachbegriffen. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihr Vorgehen, ihre Beobachtungen und die Ergebnisse ihrer Arbeit. Sie stellen naturwissenschaftliche und technische Sachverhalte, Arbeitsprozesse und Ergebnisse mit geeigneten Präsentationsformen dar. Als Informationsquellen nutzen sie verschiedene analoge und digitale Medien. Sie lesen und erstellen einfache Skizzen und Zeichnungen. 1. beim naturwissenschaftlichen und technischen Arbeiten im Team Verantwortung für Arbeitsprozesse übernehmen, ausdauernd zusammenarbeiten und dabei Ziele sowie Aufgaben sachbezogen diskutieren 2. ihr Vorgehen, ihre Beobachtungen und die Ergebnisse ihrer Arbeit dokumentieren 3. zur Veranschaulichung von Ergebnissen und Daten geeignete Tabellen und Diagramme anlegen 4. Zusammenhänge zwischen Alltagssituationen und naturwissenschaftlichen und technischen Sachverhalten herstellen 5. Sachverhalte adressatengerecht präsentieren 6. relevante Informationen aus Sach- oder Alltagstexten und aus grafischen Darstellungen in angemessener Fachsprache strukturiert wiedergeben 7. zunehmend zwischen alltagssprachlicher und fachsprachlicher Beschreibung unterscheiden 8. einfache Skizzen und Zeichnungen lesen und erstellen Prozessbezogene Kompetenzen 9
12 2.3 Bewertung Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihr Verhalten in Bezug auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Materialien und Energie. Sie beschreiben artgerechte Tierhaltung und bewerten die unterschiedliche Nutztierhaltung in der Landwirtschaft. Sie bewerten ihren Arbeitsprozess und ihre selbst hergestellten Objekte und Modelle. 1. naturwissenschaftliche Erkenntnisse für die Lösung von Alltagsfragen sinnvoll einsetzen 2. die Ansprüche von Tieren an ihren Lebensraum mit den Haltungsbedingungen als Heimoder Nutztiere an ausgewählten Beispielen vergleichen und kritisch bewerten 3. Handlungsmöglichkeiten für ein umwelt- und naturverträgliches Leben beschreiben und deren Umsetzungshemmnisse erkennen 4. naturwissenschaftliches und technisches Wissen zur Einschätzung von Risiken und Sicherheitsmaßnahmen nutzen 5. ökologisch und ökonomisch verantwortungsbewusst mit Material und Energie umgehen 6. ihr Vorgehen und das Ergebnis nach vorher festgelegten Kriterien bewerten und reflektieren 2.4 Herstellung Die Schülerinnen und Schüler erfahren exemplarisch, dass Menschen technische Produkte zu einem bestimmten Zweck schaffen. Sie nutzen Werkzeuge und sind so in der Lage, einfache technische Produkte ausgehend von der Planung zu gestalten und zu fertigen. 1. einfache Planungsunterlagen umsetzen 2. Werkzeuge sicher und fachgerecht einsetzen 3. einfache technische Objekte planen 4. einfache technische Objekte fertigen und in Betrieb nehmen 5. Schwierigkeiten bei der Herstellung eines Produkts überwinden 10 Prozessbezogene Kompetenzen
13 3. Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen 3.1 Klassen 5/ Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik Naturphänomene, Lebewesen und die Gestaltung technischer Produkte beschreiben und untersuchen. Dabei vertiefen sie die in der Grundschule angelegte Fähigkeit, Fragen an die Natur zu stellen. Sie lernen einerseits, wie man naturwissenschaftlich denkt und arbeitet, andererseits erleben sie bei der Herstellung eines Produkts die Zielorientierung der Technik. Die Schülerinnen und Schüler wenden Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik an und beschreiben oder erläutern ihr Vorgehen. Um ihr Vorgehen und ihre Ergebnisse zu kommunizieren, verwenden die Schülerinnen und Schüler zunächst die Alltagssprache, zunehmend auch Fachbegriffe. Sie kennen die jeweils benötigten Arbeitsgeräte und können diese sachgerecht und sicher einsetzen. (1) wichtige Arbeitsgeräte sicher nutzen und deren bestimmungsgemäßen Einsatz erläutern (unter anderem Gasbrenner, Thermometer, Lupe oder Stereolupe, Werkzeuge) 2.1 Erkenntnisgewinnung Bewertung Herstellung 2 GEO Teilsystem Wetter und Klima PG Selbstregulation und Lernen; Sicherheit und Unfallschutz (2) an Naturphänomenen Beobachtungen sammeln, zielgerichtet zuordnen und auswerten sowie an geeigneten Beispielen beschreiben, wie man dabei vorgeht (zum Beispiel anhand von Schwimmen und Sinken, thermischem Energietransport, Fortbewegung, Wachstum) 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, 2, 6 SPO Bewegen im Wasser (3) an Beispielen die Vorteile der fachsprachlichen Beschreibung von Phänomenen gegenüber der Alltagssprache darstellen (zum Beispiel anhand von Schwereempfinden, Masse, Dichte, Wärmeempfinden, Temperatur, Brennen, Erhitzen, Schmelzen) 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation 6, Wasser ein lebenswichtiger Stoff (4), (5) GEO Teilsystem Wetter und Klima (4) an Beispielen die naturwissenschaftliche Arbeitsweise durchführen und erläutern (Beobachtung eines Phänomens, Vermutung, Experiment, Überprüfung der Vermutung) 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation 2 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6 11
14 (5) Experimente planen und durchführen, Messwerte erfassen und Ergebnisse protokollieren sowie erläutern, wie man dabei vorgeht (Tabellen, Diagramme und Skizzen) 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation 2, 3 M Leitidee Messen M Leitidee Funktionaler Zusammenhang MB Informationstechnische Grundlagen (6) wirbellose Tiere fangen und untersuchen, Pflanzen klassifizieren und archivieren sowie beschreiben, wie man dabei vorgeht 2.1 Erkenntnisgewinnung 8, Kommunikation Bewertung Wirbellose Pflanzen (7) Wachstum und Entwicklung von Lebewesen beobachten und erläutern (zum Beispiel Keimung von Samen) 2.1 Erkenntnisgewinnung 2, Kommunikation Wirbeltiere Wirbellose Pflanzen (8) verschiedene Lebewesen aufgrund gemeinsamer Merkmale kriteriengeleitet vergleichen und die Bedeutung des systematischen Ordnens beschreiben 2.1 Erkenntnisgewinnung 8, Kommunikation Wirbeltiere (5), (7), (8) (9) an einem Sachmodell die Unterschiede zwischen den Eigenschaften des Originals und denen des Modells beschreiben und Grenzen des Modells beschreiben 2.1 Erkenntnisgewinnung 7 (10) zu einer vorher festgelegten Problemstellung ein technisches Produkt (zum Beispiel Lastkahn, Fahrzeug) herstellen und die Herstellungsschritte erläutern (Planung, Skizze, Materialliste) 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung Herstellung 1, 2, 3, Wasser ein lebenswichtiger Stoff (5) Energie effizient nutzen (14) MB Information und Wissen PG Selbstregulation und Lernen (11) ein selbst hergestelltes technisches Produkt bewerten und den Herstellungsprozess beschreiben (zum Beispiel Funktionalität, Fertigungsqualität, Ästhetik, Ansätze zur Optimierung) 2.3 Bewertung Herstellung Wasser ein lebenswichtiger Stoff Energie effizient nutzen BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt PG Selbstregulation und Lernen 12 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6
15 3.1.2 Materialien trennen Umwelt schützen verschiedene Möglichkeiten des Recyclings in Natur und Technik am Problemfeld des täglich anfallenden Hausmülls beschreiben. Sie führen Modellversuche zur Trennung von Materialien durch. Dabei überdenken sie ihr eigenes Konsumverhalten und werden für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Wertstoffen sensibilisiert. (1) die Bestandteile des Hausmülls im Modellversuch verschiedenen Wertstofffraktionen zuordnen (zum Beispiel Biomüll, Papier, Glas, Metalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Problemmüll) 2.2 Kommunikation 1, 2 (2) aufgrund der Eigenschaften von Materialien (Aussehen, elektrisch leitend, ferromagnetisch, Dichte) geeignete Methoden zu deren Trennung beschreiben und durchführen (Auslesen, elektrische Leitfähigkeitsprüfung, Magnettrennung, Schwimmtrennung) 2.1 Erkenntnisgewinnung 6, Kommunikation Bewertung Wasser ein lebenswichtiger Stoff (5) (3) einen Verbundstoff als aus mehreren Materialien aufgebaut erkennen und in seine Bestandteile trennen (zum Beispiel Getränkeverpackung) 2.1 Erkenntnisgewinnung 6, Bewertung 1, 5 (4) die Notwendigkeit der fachgerechten Entsorgung von Problemmüll begründen (zum Beispiel Batterien, Energiesparlampen) 2.3 Bewertung 3, Wasser ein lebenswichtiger Stoff BNE Bedeutung und Gefährdungen einer nachhaltigen Entwicklung VB Alltagskonsum (5) Möglichkeiten des Recyclings aufgrund der Materialeigenschaften beschreiben und exemplarisch durchführen (zum Beispiel Joghurtbecher umformen, Papier schöpfen) 2.1 Erkenntnisgewinnung Bewertung 1, Wasser ein lebenswichtiger Stoff BNE Bedeutung und Gefährdungen einer nachhaltigen Entwicklung (6) Recyclingverfahren in der Natur beschreiben und untersuchen (Laubfall, Abbau durch Destruenten, exemplarische Untersuchung eines Destruenten) 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Bewertung Energie effizient nutzen Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6 13
16 (7) das eigene Verbraucherverhalten im Sinne einer Ressourcenschonung kritisch bewerten (Müllvermeidung, Mülltrennung) 2.3 Bewertung 1, 3, 5 BNE Bedeutung und Gefährdungen einer nachhaltigen Entwicklung VB Alltagskonsum Wasser ein lebenswichtiger Stoff Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die grundlegende Bedeutung des Wassers für das Leben zu erkennen. Sie können Eigenschaften des Wassers und von Körpern in Wasser an geeigneten Experimenten überprüfen. Am Beispiel der Fische untersuchen sie die Angepasstheit von Lebewesen an den Lebensraum Wasser. (1) Phänomene beim Erwärmen und Abkühlen von Wasser beschreiben (Aggregatzustand, Volumenänderung) 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Kommunikation 1, 2 (2) den Temperaturverlauf beim Erhitzen von Wasser dokumentieren und dabei die Siede temperatur ermitteln (Celsiusskala) 2.1 Erkenntnisgewinnung 2, 3, Kommunikation Energie effizient nutzen M Leitidee Funktionaler Zusammenhang (3) wässrige Lösungen untersuchen und dabei Wasser als Lösungsmittel beschreiben (Mineralwasser, Salzwasser, Süßwasser) 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, 4, Kommunikation 1, Bewertung 1 (4) Eigenschaften von Körpern ermitteln (Masse, Volumen) 2.1 Erkenntnisgewinnung 2, 3, Kommunikation 2, Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik (3) M Leitidee Messen (5) die Schwimmfähigkeit von Körpern in Wasser mithilfe eines qualitativen Dichtebegriffs erklären (Schwimmen, Schweben, Sinken) 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Kommunikation Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik (3), (10) Materialien trennen Umwelt schützen (2) 14 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6
17 (6) die typischen Kennzeichen der Fische untersuchen (Körperform, Flossen, Schuppen, Kiemen, Schwimmblase) und als Angepasstheit an den Lebensraum beschreiben und erklären (Atmung, Fortbewegung, Schweben) 2.1 Erkenntnisgewinnung 6, 7, Kommunikation Energie effizient nutzen Wirbeltiere (7) Experimente zur Trennung von Gemischen planen, durchführen, dokumentieren (Lösen, Filtrieren, Dekantieren, Eindampfen) und technische Anwendungen erklären (Wasserreinigung) 2.1 Erkenntnisgewinnung 6, Kommunikation 2, Materialien trennen Umwelt schützen Energie effizient nutzen BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt (8) die Bedeutung des Wassers für alle Lebewesen erklären (unter anderem Wasser als Lösungsmittel) 2.2 Kommunikation Wirbeltiere Entwicklung des Menschen Wirbellose Pflanzen Ökologie Energie effizient nutzen Die Schülerinnen und Schüler lernen die Bedeutung der Energie in Natur und Technik kennen und werden für einen sorgsamen Umgang mit Energie sensibilisiert sowie ermutigt, ihre erworbenen Kenntnisse anzuwenden. Zur Beschreibung von Phänomenen verwenden sie einen propädeutischen Energiebegriff, der auf den im Sachunterricht der Grundschule erworbenen Kenntnissen aufbaut. Anhand wichtiger Nutzpflanzen erkennen die Schülerinnen und Schüler deren energetische Bedeutung für den Menschen und erfahren, wie Energie in der Tierwelt effizient genutzt wird. Sie kennen die Bedingungen für Verbrennungsvorgänge und sind in der Lage, mit Feuer verantwortungsbewusst umzugehen. An einem Produkt lernen sie die Nutzung von Energie in der Technik kennen. (1) Energieübertragungsketten in Natur und Technik beschreiben (von der Sonne über Pflanzen bis zum Menschen, von fossilen und regenerativen Energieträgern bis zum Haushalt) und Gründe für den sorgsamen Umgang mit Energie erkennen 2.2 Kommunikation Bewertung 3, 5 BNE Kriterien für nachhaltigkeitsfördernde und -hemmende Handlungen Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6 15
18 (2) die energetische Bedeutung von Nutzpflanzen für den Menschen beschreiben (zum Beispiel Kartoffel, Sonnenblume, Hülsenfrüchte) (3) die Verwendung von Nutzpflanzen für die Energiewirtschaft beschreiben (zum Beispiel Holz, Mais) 2.2 Kommunikation Bewertung 3 PG Ernährung (4) Verbrennungen unter dem Aspekt der Energieabgabe beschreiben (5) brennbare Materialien (zum Beispiel Kerzenwachs, Brennergas) im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Sauerstoff als Energieträger beschreiben (Sauerstoff als Luftbestandteil) 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation 4 (6) das Entzünden eines Stoffes bei Temperaturerhöhung untersuchen (zum Beispiel Zündtemperatur, Flammtemperatur) (7) Methoden des Feuerlöschens durchführen und erklären (Verbrennungsbedingungen) 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, 5, Kommunikation Bewertung 1, 4 BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt PG Sicherheit und Unfallschutz (8) thermische Phänomene beobachten und die drei thermischen Energietransportarten untersuchen und beschreiben (9) Materialien und Gegenstände im Hinblick auf deren Aufnahme von Wärmestrahlung untersuchen und Anwendungen in Natur und Technik erklären (zum Beispiel Sonnenkollektor) 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Kommunikation 2, 4 (10) untersuchen, welche Materialien in Natur und Technik zur Wärmedämmung geeignet sind (11) einfache Experimente zum sorgsamen Umgang mit Energie durchführen und daraus Verhaltensregeln für den Alltag in der Schule und zu Hause ableiten (zum Beispiel Kochen, Stoßlüften, Beleuchtung) 2.1 Erkenntnisgewinnung 6, Kommunikation 2, Bewertung 3, 5 BNE Bedeutung und Gefährdungen einer nachhaltigen Entwicklung; Kriterien für nachhaltigkeitsfördernde und -hemmende Handlungen PG Selbstregulation und Lernen (12) die jahreszeitlich bedingten Angepasstheiten von heimischen Tieren in Bezug auf den Energiehaushalt erklären (zum Beispiel Fellwechsel, Winterspeck, Winterruhe, Winterschlaf, Kältestarre, Vogelzug) 2.2 Kommunikation 4, 5, Ökologie 16 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6
19 (13) Angepasstheit bei Tieren im Hinblick auf eine energieoptimierte Fortbewegung im Wasser oder in der Luft beschreiben und untersuchen (zum Beispiel Vogelskelett, Federn, Gestalt bei Fischen) 2.1 Erkenntnisgewinnung 5, 6, Kommunikation Wasser ein lebenswichtiger Stoff Wirbeltiere (14) an einem einfachen Beispiel beschreiben, wie Energie zielgerichtet in einem technischen Prozess genutzt werden kann (zum Beispiel Gummibandantrieb, Elektromotor, einfacher Sonnenkollektor, einfache photovoltaische Anwendung, Fahrrad, Weihnachtspyramide) 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung Herstellung Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik (10) Wasser ein lebenswichtiger Stoff BO Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt Wirbeltiere Lebewesen von unbelebten Gegenständen unterscheiden und die Kennzeichen der Lebewesen beschreiben und erläutern. Anhand ausgewählter Beispiele beschreiben sie Säugetiere in ihrer Vielfalt. Sie stellen deren Lebensweise und Fortpflanzung angemessen dar. Sie beschreiben den verantwortungsvollen Umgang mit Haus- und Nutztieren aufgrund ihrer Kenntnisse angemessener Haltungsbedingungen. Die Schülerinnen und Schüler kennen die typischen Merkmale der verschiedenen Wirbeltiergruppen und beschreiben die Angepasstheit der Wirbeltiere an die Umwelt. Einflüsse des Menschen auf deren Lebensweise können sie beschreiben und bewerten. (1) die Kennzeichen der Lebewesen beschreiben 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation 4 (2) die Lebensweise und den Körperbau von mehreren Säugetieren, die als Haus- oder Nutztiere gehalten werden, beschreiben und vergleichen (zum Beispiel Hund, Katze, Rind, Schwein, Pferd) 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation 5, Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik (2) (3) die typischen Säugetiermerkmale beschreiben 2.1 Erkenntnisgewinnung Energie effizient nutzen (12), (13) Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6 17
20 (4) angemessene Haltungsbedingungen von Haus- und Nutztieren anhand ausgewählter Beispiele erklären (zum Beispiel unter dem Aspekt des Tierschutzes) 2.2 Kommunikation Bewertung 2 BNE Werte und Normen in Entscheidungssituationen MB Information und Wissen (5) verschiedene Formen der Tierhaltung beschreiben und bewerten (zum Beispiel artgerechte Hühnerhaltung) 2.1 Erkenntnisgewinnung Bewertung 2, Energie effizient nutzen BNE Werte und Normen in Entscheidungssituationen (6) den Körperbau und die Lebensweise heimischer Säugetiere als Angepasstheit erläutern (zum Beispiel Eichhörnchen, Igel, Maulwurf, Fledermaus) 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation 1, Energie effizient nutzen Ökologie MB Information und Wissen; Produktion und Präsentation (7) die Veränderung der Lebensweise von Wirbeltieren als Folge der Einflüsse des Menschen erläutern und bewerten (zum Beispiel Kulturfolger) 2.1 Erkenntnisgewinnung Bewertung Ökologie (8) die Angepasstheit der Reptilien an das Leben an Land an zwei verschiedenen Beispielen erklären (innere Befruchtung, verhornte Haut, Lungenatmung) 2.1 Erkenntnisgewinnung Energie effizient nutzen (12) (9) die typischen Merkmale der Amphibien als Angepasstheit beschreiben (Atmung, Fortpflanzung, Entwicklung im Wasser, Metamorphose der Froschlurche) 2.1 Erkenntnisgewinnung Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik (7) Wasser ein lebenswichtiger Stoff (8) Energie effizient nutzen (12) (10) die Ursachen der Gefährdung von Amphibien erläutern und Schutzmaßnahmen beschreiben und bewerten 2.2 Kommunikation Bewertung 1, Ökologie BNE Bedeutung und Gefährdungen einer nachhaltigen Entwicklung 18 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6
21 (11) die Fortpflanzung und Entwicklung bei Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren vergleichen 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik (7) Wasser ein lebenswichtiger Stoff Energie effizient nutzen (12) den Jungentypus (Nesthocker, Nestflüchter) bei Wirbeltieren vergleichen 2.1 Erkenntnisgewinnung Energie effizient nutzen (13) typische Merkmale der Wirbeltiergruppen (unter anderem im Hinblick auf die stammesgeschichtliche Verwandtschaft) erläutern und Tierarten begründet den fünf Wirbeltiergruppen zuordnen und vergleichen 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation Wasser ein lebenswichtiger Stoff Energie effizient nutzen Ökologie Entwicklung des Menschen die Individualentwicklung des Menschen beschreiben. Sie kennen die primären Geschlechtsorgane von Frau und Mann und können die Fortpflanzung des Menschen beschreiben. Sie beschreiben und erklären die physischen und psychischen Veränderungen während der Pubertät. (1) die Geschlechtsorgane des Menschen unter Verwendung der Fachsprache benennen und ihre Funktion beschreiben 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation 6, Wirbeltiere (2) die physischen und psychischen Veränderungen während der Pubertät beschreiben und als Ursache die Geschlechtshormone nennen 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Kommunikation 4 MB Jugendmedienschutz (3) die Grundlagen der geschlechtlichen Fortpflanzung beim Menschen beschreiben (Geschlechtszellen, Zeugung, innere Befruchtung, Schwangerschaft, Geburt) 2.1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation 7 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6 19
22 (4) den Ablauf und die Periodik des Menstruationszyklus beschreiben 2.2 Kommunikation 4, 7 (5) Maßnahmen der Intimhygiene nennen und begründen 2.2 Kommunikation Bewertung Wirbeltiere PG Körper und Hygiene Wirbellose Die Schülerinnen und Schüler stellen strukturelle und funktionelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb der Gruppe der Wirbellosen dar. Sie können deren Entwicklung beschreiben. Sie beschreiben und erklären die Angepasstheit der Wirbellosen an ausgewählten Beispielen. Beim Vergleich mit den Wirbeltieren erkennen die Schülerinnen und Schüler die Unterschiede von Exoskelett und Endoskelett. Sie lernen die Vielfalt der Wirbellosen kennen und wenden einfache Bestimmungshilfen an. Am Beispiel der Insekten erkennen sie die gegenseitige Abhängigkeit von Pflanzen und Tieren und können die Folgen einer Störung durch den Menschen abschätzen. (1) verschiedene Vertreter der wirbellosen Tiere nennen und einer Gruppe der Wirbellosen zuordnen 2.1 Erkenntnisgewinnung 8, Ökologie (2) den Körperbau der Insekten an einem Beispiel beschreiben (zum Beispiel Biene, Maikäfer, Waldameise) (3) den Körperbau und innere Organe (zum Beispiel Kreislauf, Atmungsorgane) von Insekten und Wirbeltieren vergleichen 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Kommunikation Wirbeltiere (4) die vollständige und unvollständige Verwandlung beschreiben und die Metamorphose als Angepasstheit erklären 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Kommunikation Wirbeltiere (9) (5) eine Angepasstheit bei Insekten beschreiben (zum Beispiel Insektenbeine, Mundwerkzeuge, Flugmuskulatur, Staatenbildung) 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, 7, Kommunikation Wirbeltiere 20 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6
23 (6) die Bedeutung der Insekten für die Bestäubung von Pflanzen und umgekehrt die Abhängigkeit der Insekten von den Pflanzen erklären 2.3 Bewertung 2, Pflanzen (3), (5) Ökologie BNE Bedeutung und Gefährdungen einer nachhaltigen Entwicklung (7) vier Gruppen von Wirbellosen nennen und heimische Vertreter begründet zuordnen 2.1 Erkenntnisgewinnung 8, Materialien trennen Umwelt schützen (6) Ökologie Hinweis Es ist darauf zu achten, lebende Objekte (zum Beispiel Schnecken, Insekten, Würmer, Spinnen) in den Unterricht zu integrieren. Es sollten Lernorte im Freien (zum Beispiel Wiese, Wald, Schulgarten, Schulhof, Gewässer, Steinmauer) aufgesucht werden. Dabei sind die Artenschutzverordnung und das Naturschutzgesetz zu beachten Pflanzen Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Pflanzen als lebende Organismen mit ihren typischen Organen. Sie erkennen den Formenreichtum und die Vielgestaltigkeit. Sie können strukturelle und funktionelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Pflanzen und Pflanzenfamilien charakterisieren. Sie beschreiben und erklären die Entwicklung und verschiedene Formen der Fortpflanzung. (1) die typischen Organe einer Blütenpflanze nennen und deren Funktion beschreiben (2) Keimungsexperimente planen, durchführen und auswerten (3) den Aufbau von Blüten untersuchen (zum Beispiel Legebild) 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Kommunikation Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik (5), (7) Wirbellose (6) Ökologie (4) aufgrund des Blütenbaus Vertreter von vier Pflanzenfamilien aus ihrem Lebensumfeld ermitteln und begründet zuordnen (zum Beispiel Herbarium anlegen) 2.1 Erkenntnisgewinnung 8, Ökologie Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6 21
24 (5) die geschlechtliche Fortpflanzung bei Pflanzen (Bestäubung, Befruchtung, Fruchtentwicklung) beschreiben und mit der ungeschlechtlichen Fortpflanzung vergleichen 2.1 Erkenntnisgewinnung Wirbellose (6) (6) verschiedene Möglichkeiten der Ausbreitung von Samen und Früchten beschreiben und Experimente hierzu planen, durchführen, protokollieren und auswerten 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Kommunikation Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik (4) (7) einheimische Laub- und Nadelbäume nennen und mit Bestimmungshilfen zuordnen (je vier bis fünf Arten) 2.1 Erkenntnisgewinnung 8, Ökologie Hinweis Es ist darauf zu achten, lebende Objekte aus dem Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht zu integrieren. Auch sollten außerschulische Lernorte (zum Beispiel Wiese, Wald, Schulgarten, Park) aufgesucht werden. Dabei sind die Artenschutzverordnung und das Naturschutzgesetz zu beachten. 22 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6
25 3.1.9 Ökologie Die Schülerinnen und Schüler untersuchen einen Lebensraum in Bezug auf jahreszeitliche Veränderungen. Sie können Wechselwirkungen zwischen Organismen beschreiben und die Angepasstheit ausgewählter Organismen an die Umwelt beschreiben und erklären. (1) mehrere typische Organismen eines einheimischen Lebensraums mit einfachen Bestimmungshilfen im Freiland klassifizieren 2.1 Erkenntnisgewinnung 8, Kommunikation Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik Wirbeltiere Wirbellose Pflanzen (2) jahreszeitliche Veränderungen innerhalb eines schulnahen Lebensraums (zum Beispiel Baum, Hecke, Wiese) beobachten, protokollieren und mit veränderten Umweltfaktoren begründen 2.1 Erkenntnisgewinnung 1, Kommunikation 1, 2, Energie effizient nutzen Wirbeltiere Wirbellose Pflanzen Hinweis Ökologie ist ein Unterrichtsthema, das in Vernetzung mit anderen Bereichen unterrichtet werden sollte. Empfohlen sind praktische Beobachtungen in schulischen und schulnahen Biotopen, längerfristige Freilanduntersuchungen, Umwelttagebücher als Dokumente. Durch Nähe zur Natur soll die Bereitschaft zum Naturschutz gestärkt werden. Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klassen 5/6 23
26 4. Operatoren Den in den Fächern Biologie, Chemie, Naturwissenschaft und Technik (NwT), Physik und in dem Fächerverbund genutzten Operatoren liegt eine gemeinsame Beschreibung zugrunde. In den Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen werden Operatoren (handlungsleitende Verben) verwendet. Diese sind in der vorliegenden Liste aufgeführt. Standards legen fest, welchen Anforderungen die Schülerinnen und Schüler gerecht werden müssen. Daher werden die Operatoren in der Regel nach drei Anforderungsbereichen (AFB) gegliedert: Reproduktion (AFB I) Reorganisation (AFB II) Transfer (AFB III) In der Regel können Operatoren je nach inhaltlichem Kontext und unterrichtlichem Vorlauf in jeden der drei Anforderungsbereiche eingeordnet werden. Im Folgenden wird den Operatoren der überwiegend in Betracht kommende Anforderungsbereich zugeordnet. Operatoren Beschreibung AFB ableiten auf der Grundlage von Erkenntnissen sachgerechte Schlüsse ziehen II archivieren Dokumente systematisch ordnen und aufbewahren II auswerten begründen Daten, Einzelergebnisse oder andere Aspekte in einen Zusammenhang stellen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen Sachverhalte auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten beziehungsweise kausale Zusammenhänge zurückführen III III benennen Fachbegriffe kriteriengeleitet zuordnen I beobachten beschreiben bewerten darstellen mit eigenen Sinnen bewusst wahrnehmen oder an Messgeräten ablesen Strukturen, Sachverhalte, Prozesse und Eigenschaften von Objekten in der Regel unter Verwendung der Fachsprache wiedergeben einen Sachverhalt nach fachwissenschaftlichen oder fachmethodischen Kriterien, persönlichem oder gesellschaftlichem Wertebezug begründet einschätzen Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden und Ergebnisse strukturiert wiedergeben I II III I dokumentieren das eigene Vorgehen schriftlich und nachvollziehbar festhalten I durchführen erfassen (Messwerte) eine vorgegebene oder eigene Anleitung (zum Beispiel für ein Experiment oder einen Arbeitsauftrag) umsetzen Messgeräte einsetzen, Messwerte ablesen und notieren I I 24 Operatoren
27 Operatoren Beschreibung AFB erkennen erklären erläutern kognitiver Prozess der Abstraktion, bei dem eine Wahrnehmung einem Begriff oder Konzept zugeordnet wird, dieser Prozess ist nur durch beobachtbare Folgehandlungen operationalisierbar Strukturen, Prozesse und Zusammenhänge eines Sachverhalts erfassen sowie auf allgemeine Aussagen oder Gesetze unter Verwendung der Fachsprache zurückführen Strukturen, Prozesse und Zusammenhänge eines Sachverhalts erfassen sowie auf allgemeine Aussagen und Gesetze zurückführen und durch zusätzliche Informationen oder Beispiele verständlich machen I II II ermitteln ein Ergebnis rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen II herstellen nennen ein Sachsystem planen und konstruieren und unter Berücksichtigung von Vorgaben und fachgerechtem Einsatz von Hilfsmitteln fertigen Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten, Fakten ohne Erläuterung wiedergeben II I nutzen fachgerecht einsetzen I ordnen, einordnen, zuordnen, klassifizieren Begriffe, Gegenstände etc. auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen II planen zu einem vorgegebenen Problem Lösungswege entwickeln II protokollieren sammeln Abläufe, Beobachtungen und Ergebnisse sowie gegebenenfalls Auswertungen in fachtypischer Weise wiedergeben siehe dokumentieren systematisches Suchen, Beschaffen und Aufbewahren von Dingen oder Informationen I I trennen in die einzelnen Bausteine zerlegen I untersuchen Sachverhalte oder Objekte zielorientiert erkunden, Merkmale und Zusammenhänge herausarbeiten II vergleichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten II zusammenfassen das Wesentliche in konzentrierter Form herausstellen II Operatoren 25
28 5. Anhang 5.1 Verweise Das Verweissystem im Bildungsplan 2016 unterscheidet zwischen vier verschiedenen Verweisarten. Diese werden durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet: Symbol Erläuterung Verweis auf die prozessbezogenen Kompetenzen Verweis auf andere Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen desselben Fachplans Verweis auf andere Fächer Verweis auf Leitperspektiven Die vier verschiedenen Verweisarten Die Darstellungen der Verweise weichen im Web und in der Druckfassung voneinander ab. Darstellung der Verweise auf der Online-Plattform Verweise auf Teilkompetenzen werden unterhalb der jeweiligen Teilkompetenz als anklickbare Symbole dargestellt. Nach einem Mausklick auf das jeweilige Symbol werden die Verweise im Browser detaillierter dargestellt (dies wird in der Abbildung nicht veranschaulicht): (2) anhand von einfachen Versuchen zwei Wetterelemente analysieren (zum Beispiel Niederschlag, Temperatur) Darstellung der Verweise in der Webansicht (Beispiel aus Geographie Grundlagen von Wetter und Klima ) Darstellung der Verweise in der Druckfassung In der Druckfassung und in der PDF-Ansicht werden sämtliche Verweise direkt unterhalb der jeweiligen Teilkompetenz dargestellt. Bei Verweisen auf andere Fächer ist zusätzlich das Fächerkürzel dargestellt (im Beispiel BNT für ): (2) anhand von einfachen Versuchen zwei Wetterelemente analysieren (zum Beispiel Niederschlag, Temperatur) 2.5 Methodenkompetenz Klimazonen Europas BNT Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik MB Produktion und Präsentation 26 Anhang
29 Darstellung der Verweise in der Druckansicht (Beispiel aus Geographie Grundlagen von Wetter und Klima ) Gültigkeitsbereich der Verweise Sind Verweise nur durch eine gestrichelte Linie von den darüber stehenden Kompetenzbeschreibungen getrennt, beziehen sie sich unmittelbar auf diese. Stehen Verweise in der letzten Zeile eines Kompetenzbereichs und sind durch eine durchgezogene Linie von diesem getrennt, so beziehen sie sich auf den gesamten Kompetenzbereich. Die Verweise gelten für... (1) die Sichtweisen von Betroffenen und Beteiligten in Konfliktsituationen herausarbeiten und bewerten (zum Beispiel Elternhaus, Schule, soziale Netzwerke)... die Teilkompetenz (1) (2) Erklärungsansätze für Gewalt anhand von Beispielsituationen herausarbeiten und beurteilen (3) selbstständig Strategien zu gewaltfreien und verantwortungsbewussten Konfliktlösungen entwickeln und überprüfen (zum Beispiel Kompromiss, Mediation, Konsens)... die Teilkompetenzen (2) und (3)... alle Teilkompetenzen der Tabelle Gültigkeitsbereich von Verweisen (Beispiel aus Ethik Verantwortung im Umgang mit Konflikten und Gewalt ) 5.2 Abkürzungen Leitperspektiven Allgemeine Leitperspektiven BNE BTV PG Bildung für nachhaltige Entwicklung Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt Prävention und Gesundheitsförderung Themenspezifische Leitperspektiven BO MB VB Berufliche Orientierung Medienbildung Verbraucherbildung Anhang 27
30 Fächer des Gymnasiums Abkürzung BIO BK BKPROFIL BMB BNT CH D E1 E2 ETH F1 F2 F3 G GEO GK GR3 ITAL3 L1 L2 L3 LUT M MUS MUSPROFIL NWT PH PORT3 RAK RALE Fach Biologie Bildende Kunst Bildende Kunst Profilfach Basiskurs Medienbildung Chemie Deutsch Englisch als erste Fremdsprache Englisch als zweite Fremdsprache Ethik Französisch als erste Fremdsprache Französisch als zweite Fremdsprache Französisch als dritte Fremdsprache Profilfach Geschichte Geographie Gemeinschaftskunde Griechisch als dritte Fremdsprache Profilfach Italienisch als dritte Fremdsprache Profilfach Latein als erste Fremdsprache Latein als zweite Fremdsprache Latein als dritte Fremdsprache Profilfach Literatur und Theater Mathematik Musik Musik Profilfach Naturwissenschaft und Technik (NwT) Profilfach Physik Portugiesisch als dritte Fremdsprache Profilfach Altkatholische Religionslehre Alevitische Religionslehre 28 Anhang
31 Abkürzung REV RISL RJUED RRK RSYR RU2 RU3 SPA3 SPO SPOPROFIL WBS WI Fach Evangelische Religionslehre Islamische Religionslehre sunnitischer Prägung Jüdische Religionslehre Katholische Religionslehre Syrisch-Orthodoxe Religionslehre Russisch als zweite Fremdsprache Russisch als dritte Fremdsprache Profilfach Spanisch als dritte Fremdsprache Profilfach Sport Sport Profilfach Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Wirtschaft 5.3 Geschlechtergerechte Sprache Im Bildungsplan 2016 wird in der Regel durchgängig die weibliche Form neben der männlichen verwendet; wo immer möglich, werden Paarformulierungen wie Lehrerinnen und Lehrer oder neutrale Formen wie Lehrkräfte, Studierende gebraucht. Ausnahmen von diesen Regeln finden sich bei Überschriften, Tabellen, Grafiken, wenn dies aus layouttechnischen Gründen (Platzmangel) erforderlich ist, Funktions- oder Rollenbezeichnungen beziehungsweise Begriffen mit Nähe zu formalen und juristischen Texten oder domänenspezifischen Fachbegriffen (zum Beispiel Marktteilnehmer, Erwerbs tätiger, Auftraggeber, (Ver )Käufer, Konsument, Anbieter, Verbraucher, Arbeit nehmer, Arbeitgeber, Bürger, Bürgermeister ), massiver Beeinträchtigung der Lesbarkeit. Selbstverständlich sind auch in all diesen Fällen Personen jeglichen Geschlechts gemeint. Anhang 29
32 5.4 Besondere Schriftauszeichnungen Klammern und Verbindlichkeit von Beispielen Im Fachplan sind einige Begriffe in Klammern gesetzt. Steht vor den Begriffen in Klammern zum Beispiel, so dienen die Begriffe lediglich einer genaueren Klärung und Einordnung. Begriffe in Klammern ohne zum Beispiel sind ein verbindlicher Teil der Kompetenzformulierung. Steht in Klammern ein unter anderem, so sind die in der Klammer aufgeführten Aspekte verbindlich zu unterrichten und noch weitere Beispiele der eigenen Wahl darüber hinaus. Beispiel 1: an Naturphänomenen Beobachtungen sammeln, zielgerichtet zuordnen und auswerten sowie an geeigneten Beispielen beschreiben, wie man dabei vorgeht (zum Beispiel anhand von Schwimmen und Sinken, thermischem Energietransport, Fortbewegung, Wachstum) Hier dienen die Beispiele in der Klammer zur Verdeutlichung und Niveaukonkretisierung. Beispiel 2: an Beispielen die naturwissenschaftliche Arbeitsweise durchführen und erläutern (Beobachtung eines Phänomens, Vermutung, Experiment, Überprüfung der Vermutung) Die in der Klammer genannten Begriffe sind verbindlich. Beispiel 3: wichtige Arbeitsgeräte sicher nutzen und deren bestimmungsgemäßen Einsatz erläutern (unter anderem Gasbrenner, Thermometer, Lupe oder Stereolupe, Werkzeuge) Hier können die Schülerinnen und Schüler neben den in der Klammer genannten weitere Geräte sicher nutzen. Gestrichelte Unterstreichungen in den gymnasialen Fachplänen In den prozessbezogenen Kompetenzen: Die gekennzeichneten Stellen sind in der Oberstufe (Klassen 10 12) zu verorten. In den inhaltsbezogenen Kompetenzen: Die gekennzeichneten Stellen reichen über das E-Niveau des gemeinsamen Bildungsplans für die Sekundarstufe I hinaus und sind explizit erst in der Klasse 10 zu verorten. 30 Anhang
33 für Ihre Notizen 31
34 für Ihre Notizen 32
35 Impressum Kultus und Unterricht Ausgabe C Herausgeber Internet Verlag und Vertrieb Urheberrecht Bildnachweis Gestaltung Druck Bezugsbedingungen Amtsblatt des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Bildungsplanplanhefte Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Postfach , Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schulentwicklung, Heilbronner Str. 172, Stuttgart Neckar-Verlag GmbH, Villingen-Schwenningen Die fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion des Satzes beziehungsweise der Satzordnung für kommerzielle Zwecke nur mit Genehmigung des Herausgebers. Robert Thiele, Stuttgart Ilona Hirth Grafik Design GmbH, Karlsruhe Konrad Triltsch Print und digitale Medien GmbH, Ochsenfurt Soweit die vorliegende Publikation Nachdrucke enthält, wurden dafür nach bestem Wissen und Gewissen Lizenzen eingeholt. Die Urheberrechte der Copyrightinhaber werden ausdrücklich anerkannt. Sollten dennoch in einzelnen Fällen Urheberrechte nicht berücksichtigt worden sein, wenden Sie sich bitte an den Herausgeber. Alle eingesetzten beziehungsweise verarbeiteten Rohstoffe und Materialien entsprechen den zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen beziehungsweise geltenden Bestimmungen und Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Der Herausgeber hat bei seinen Leistungen sowie bei Zulieferungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Verfahren und Erzeugnisse bevorzugt eingesetzt. Juni 2016 Die Lieferung der unregelmäßig erscheinenden Bildungsplanplanhefte erfolgt automatisch nach einem festgelegten Schlüssel. Der Bezug der Ausgabe C des Amtsblattes ist verpflichtend, wenn die betreffende Schule im Verteiler (abgedruckt auf der zweiten Umschlagseite) vorgesehen ist (Verwaltungsvorschrift vom 22. Mai 2008, K.u.U. S. 141). Die Bildungsplanplanhefte werden gesondert in Rechnung gestellt. Die einzelnen Reihen können zusätzlich abonniert werden. Abbestellungen nur halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres schriftlich acht Wochen vorher bei der Neckar-Verlag GmbH, Postfach 1820, Villingen-Schwenningen.
36
Bildungsplan 2016 BNT
 Bildungsplan 2016 BNT Vom Bildungsplan zum Stoffplan Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Leitperspektiven Verweise auf weitere Fächer Struktur des Fachplans BNT Leitgedanken Prozessbezogene
Bildungsplan 2016 BNT Vom Bildungsplan zum Stoffplan Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Leitperspektiven Verweise auf weitere Fächer Struktur des Fachplans BNT Leitgedanken Prozessbezogene
BNT Curriculum Klassen 5 und 6
 BNT Curriculum Klassen 5 und 6 Der Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) setzt sich aus den Fächern Biologie, Chemie und Physik zusammen. Der naturwissenschaftliche Unterricht wird durch
BNT Curriculum Klassen 5 und 6 Der Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) setzt sich aus den Fächern Biologie, Chemie und Physik zusammen. Der naturwissenschaftliche Unterricht wird durch
Alle inhaltsbezogenen Kompetenzen des Bildungsplans BNT 5/6 (Seiten 12-33) finden Sie hier bereits den entsprechenden Schülerbuch-Seiten zugeordnet.
 Stoffverteilungsplan Bildungsplan 2016 für die Sekundarstufe I in Baden-Württemberg PRISMA Biologie, Naturphänomene und Technik 5/6, Baden-Württemberg Band BNT für die Klasse 5/6 Klettbuch ISBN 978-3-12-068962-1
Stoffverteilungsplan Bildungsplan 2016 für die Sekundarstufe I in Baden-Württemberg PRISMA Biologie, Naturphänomene und Technik 5/6, Baden-Württemberg Band BNT für die Klasse 5/6 Klettbuch ISBN 978-3-12-068962-1
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen
 Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Gesamtplan BNT Themen- & Stundenverteilung für die Klassen 5 und 6 Modell 6 + 0
 Gesamtplan BNT Themen- & Stundenverteilung für die Klassen 5 und 6 Modell 6 + 0 Erläuterungen für die folgende Tabelle: Gesamtplan nur für das Kerncurriculum (3/4), entspricht 162 Wochenstunden zusätzliche
Gesamtplan BNT Themen- & Stundenverteilung für die Klassen 5 und 6 Modell 6 + 0 Erläuterungen für die folgende Tabelle: Gesamtplan nur für das Kerncurriculum (3/4), entspricht 162 Wochenstunden zusätzliche
 NwT 9: Wald Pflanzen und Tiere Ökosystem Wald und Mensch Nutzung Naturschutz Artenkenntnis, Artenvielfalt; Wechselbeziehungen Waldformen, Biotope, Anpassungen von Pfl. u. Tieren; Nahrungsketten, Energiekreisläufe
NwT 9: Wald Pflanzen und Tiere Ökosystem Wald und Mensch Nutzung Naturschutz Artenkenntnis, Artenvielfalt; Wechselbeziehungen Waldformen, Biotope, Anpassungen von Pfl. u. Tieren; Nahrungsketten, Energiekreisläufe
EF Q1 Q2 Seite 1
 Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
Fachcurriculum Naturphänomene Klassen 5 und 6
 Fachcurriculum Naturphänomene Klassen 5 und 6 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Im Fach Naturphänomene erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die beeindruckende Welt der Naturwissenschaften
Fachcurriculum Naturphänomene Klassen 5 und 6 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Im Fach Naturphänomene erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die beeindruckende Welt der Naturwissenschaften
Interne Ergänzungen Kompetenzen
 Inhaltsfelder Die Zelle als Grundbaustein von Organismen Jahrgang: Klasse 5 Fach: Biologie Stand: 23.11.2015 Konzeptbezogene Prozessbezogene Interne Ergänzungen Kompetenzen Kompetenzen Die SuS Die SuS
Inhaltsfelder Die Zelle als Grundbaustein von Organismen Jahrgang: Klasse 5 Fach: Biologie Stand: 23.11.2015 Konzeptbezogene Prozessbezogene Interne Ergänzungen Kompetenzen Kompetenzen Die SuS Die SuS
Kern- und Schulcurriculum Biologie Klasse 5/6. Stand Schuljahr 2009/10
 Kern- und Schulcurriculum Biologie Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Das integrierte Schulcurriculum ist auf den folgenden Seiten grün hervorgehoben. Klasse 6: Grundlegende biologische Prinzipien: Angepasstheit,
Kern- und Schulcurriculum Biologie Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Das integrierte Schulcurriculum ist auf den folgenden Seiten grün hervorgehoben. Klasse 6: Grundlegende biologische Prinzipien: Angepasstheit,
Inhalt. So arbeitest du mit dem Biobuch 10. Was ist Biologie? 12. Biologie eine Naturwissenschaft 14
 Inhalt So arbeitest du mit dem Biobuch 10 Was ist Biologie? 12 Biologie eine Naturwissenschaft 14 Kennzeichen des Lebens 16 Pflanzen sind Lebewesen 18 MMP: Lebendig oder nicht? 19 Zusammenfassung 20 Teste
Inhalt So arbeitest du mit dem Biobuch 10 Was ist Biologie? 12 Biologie eine Naturwissenschaft 14 Kennzeichen des Lebens 16 Pflanzen sind Lebewesen 18 MMP: Lebendig oder nicht? 19 Zusammenfassung 20 Teste
Wesentliche prozessbezogene Kompetenzen Erkenntnisgewinnung (EG), Kommunikation (KK), Bewertung (BW), den Aufgaben ( 1, 2 ) zugeordnet
 Einführung 1. Allgemeines (Begriffsbestimmung, Mappenführung) Anschauungsmaterial, Buch 2.Arbeitsmethoden in der Biologie 1 Kennzeichen des Lebens Kennzeichen des Lebens (S. 14/15) Die Kennzeichen von
Einführung 1. Allgemeines (Begriffsbestimmung, Mappenführung) Anschauungsmaterial, Buch 2.Arbeitsmethoden in der Biologie 1 Kennzeichen des Lebens Kennzeichen des Lebens (S. 14/15) Die Kennzeichen von
Kernlehrplan Biologie SCHULCURRICULUM Ernst-Barlach-Gymnasium
 Jahrgangsstufe 6.1.1 Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen Prozessbezogene Kompetenzen Bauplan der Blütenpflanzen Fortpflanzung, Entwicklung
Jahrgangsstufe 6.1.1 Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen Prozessbezogene Kompetenzen Bauplan der Blütenpflanzen Fortpflanzung, Entwicklung
Oken-Gymnasium. Kern- und Schulcurriculum für das Fach Naturphänomene
 Oken-Gymnasium Kern- und Schulcurriculum für das Fach Naturphänomene I. Überfachliche Kompetenzen Im Fach Naturphänomene lernen die Schülerinnen und Schüler einfache Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten
Oken-Gymnasium Kern- und Schulcurriculum für das Fach Naturphänomene I. Überfachliche Kompetenzen Im Fach Naturphänomene lernen die Schülerinnen und Schüler einfache Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten
Schülerinnen und Schüler. nennen die Kennzeichen des Lebendigen (UF1)
 Jahrgang Fach: Biologie.1 1. Was ist Biologie? Kennzeichen des Lebendigen (S.6-10) 2. Verantwortung für Haus- und Nutztiere (S.18-28) 3. Haustiere (z.b. Katze, Hund) (S. 22-33) Körperbau Sinnesleistung
Jahrgang Fach: Biologie.1 1. Was ist Biologie? Kennzeichen des Lebendigen (S.6-10) 2. Verantwortung für Haus- und Nutztiere (S.18-28) 3. Haustiere (z.b. Katze, Hund) (S. 22-33) Körperbau Sinnesleistung
Didaktisches Modell: Zielsetzung
 Ergänzung der BO-Handreichung: Einordnung nach Seite 65 (3.4.1 Das neue Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung ) Wirtschaft/Studien- und Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1 1 Didaktisches
Ergänzung der BO-Handreichung: Einordnung nach Seite 65 (3.4.1 Das neue Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung ) Wirtschaft/Studien- und Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1 1 Didaktisches
Schuleigenes Curriculum für die Jahrgangsstufe 5 an der Holzkamp-Gesamtschule Witten. Angepasst an das Lehrbuch: Biologie heute aktuell
 Angepasst an das Lehrbuch: Biologie heute aktuell Kompetenzentwicklung und Basiskonzepte Der Kernlehrplan gliedert die geforderten Kompetenzen in vier Bereiche: Umgang mit Fachwissen (UF 1 4), Erkenntnisgewinnung
Angepasst an das Lehrbuch: Biologie heute aktuell Kompetenzentwicklung und Basiskonzepte Der Kernlehrplan gliedert die geforderten Kompetenzen in vier Bereiche: Umgang mit Fachwissen (UF 1 4), Erkenntnisgewinnung
CURRICULUM AUS NATURWISSENSCHAFTEN Physik und Chemie 1. Biennium FOWI
 Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der soll den SchülerInnen eine aktive Auseinandersetzung mit physikalischen und chemischen Phänomenen ermöglichen. In aktuellen und gesellschaftsrelevanten
Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der soll den SchülerInnen eine aktive Auseinandersetzung mit physikalischen und chemischen Phänomenen ermöglichen. In aktuellen und gesellschaftsrelevanten
Wahlpflicht- und Profilfächer an Gemeinschaftsschulen
 Wahlpflicht- und Profilfächer an Gemeinschaftsschulen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Wahlpflicht- und Profilfächer Alle Schülerinnen und Schüler belegen verpflichtend je ein Fach aus dem Wahlpflichtbereich
Wahlpflicht- und Profilfächer an Gemeinschaftsschulen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Wahlpflicht- und Profilfächer Alle Schülerinnen und Schüler belegen verpflichtend je ein Fach aus dem Wahlpflichtbereich
Berufliche Orientierung im Bildungsplan 2016
 Berufliche Orientierung im Bildungsplan 2016 Ausbildungs- und Studienorientierung in Baden- Württemberg Sandra Brenner Kultusministerium/ Ref. 34 (Arbeitsbereich Berufliche Orientierung) Bildungsplan 2016
Berufliche Orientierung im Bildungsplan 2016 Ausbildungs- und Studienorientierung in Baden- Württemberg Sandra Brenner Kultusministerium/ Ref. 34 (Arbeitsbereich Berufliche Orientierung) Bildungsplan 2016
Inhaltsverzeichnis. Haustiere und Nutztiere
 Inhaltsverzeichnis M Aufgaben richtig verstehen 8 M Biologische Prinzipien 10 1 Kennzeichen von Lebewesen 1.1 Biologie ein neues Unterrichtsfach 12 M Mein Biologieheft führen 13 1.2 Lebewesen haben typische
Inhaltsverzeichnis M Aufgaben richtig verstehen 8 M Biologische Prinzipien 10 1 Kennzeichen von Lebewesen 1.1 Biologie ein neues Unterrichtsfach 12 M Mein Biologieheft führen 13 1.2 Lebewesen haben typische
Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10
 Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10 Kompetenzen werden an Inhalten erworben. Für den Mittleren Schulabschluss werden die Inhalte im Fach Biologie in den folgenden drei Basiskonzepten
Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10 Kompetenzen werden an Inhalten erworben. Für den Mittleren Schulabschluss werden die Inhalte im Fach Biologie in den folgenden drei Basiskonzepten
Prototypische Beispiele für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen.
 OStR. Mag. Werner Gaggl Prototypische Beispiele für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen. Aufgabenstellungen 1 Am Montag, 22.11.2010 von 9:00 bis 17:00 Uhr fand ein ganztägiger Workshop zur Neuen Reifeprüfung
OStR. Mag. Werner Gaggl Prototypische Beispiele für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen. Aufgabenstellungen 1 Am Montag, 22.11.2010 von 9:00 bis 17:00 Uhr fand ein ganztägiger Workshop zur Neuen Reifeprüfung
Konzeptbezogene Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler... Basiskonzept. Basiskonzept Basiskonzept Struktur und Funktion Entwicklung
 Schulinternes Curriculum des Landrat-Lucas-Gymnasiums im Fach Biologie Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Jahrgangsstufen 5 und 6 Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tier in verschiedenen Lebensräumen Prozessbezogene
Schulinternes Curriculum des Landrat-Lucas-Gymnasiums im Fach Biologie Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Jahrgangsstufen 5 und 6 Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tier in verschiedenen Lebensräumen Prozessbezogene
Schulinterner Lehrplan Sek I Biologie
 Jgst. 5.1 Zeit Inhaltsfeld/ Schlüsselbegriff 10 Bau und Leistungen des menschlichen Körpers Ernährung und Verdauung: Nahrungsmittel und Nährstoffe, Verdauungssystem Kontext/ Konzeptbezogene Kompetenzen,
Jgst. 5.1 Zeit Inhaltsfeld/ Schlüsselbegriff 10 Bau und Leistungen des menschlichen Körpers Ernährung und Verdauung: Nahrungsmittel und Nährstoffe, Verdauungssystem Kontext/ Konzeptbezogene Kompetenzen,
Biologieunterricht in Baden-Württemberg. standardbasiert und kompetenzorientiert
 Biologieunterricht in Baden-Württemberg standardbasiert und kompetenzorientiert Worum geht es Kompetenz- und Standardbegriff Allgemeines und fachliches Kompetenzkomponentenmodell Standardbasierung - vom
Biologieunterricht in Baden-Württemberg standardbasiert und kompetenzorientiert Worum geht es Kompetenz- und Standardbegriff Allgemeines und fachliches Kompetenzkomponentenmodell Standardbasierung - vom
Grundbegriffe der Ökologie Ökologie, Art, Population, Biozönose, Ökosystem, Biotop; biotische und abiotische Faktoren am Beispiel des Ökosystemes Wald
 Jahrgang: Klasse 8 Fach: Biologie Inhaltsfelder Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Interne rgänzungen Grundbegriffe der Ökologie Ökologie, Art, Population, Biozönose, Ökosystem, Biotop;
Jahrgang: Klasse 8 Fach: Biologie Inhaltsfelder Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Interne rgänzungen Grundbegriffe der Ökologie Ökologie, Art, Population, Biozönose, Ökosystem, Biotop;
Kernlehrplan Biologie SCHULCURRICULUM Ernst-Barlach-Gymnasium
 Jahrgangsstufe 5.1.1 Inhaltsfeld: Bau und Leistungen des menschlichen Körpers Fachlicher Kontext: Gesundheitsbewusstes Leben Konzeptbezogene Prozessbezogene Bewegungssystem Atmung und Blutkreislauf 1.
Jahrgangsstufe 5.1.1 Inhaltsfeld: Bau und Leistungen des menschlichen Körpers Fachlicher Kontext: Gesundheitsbewusstes Leben Konzeptbezogene Prozessbezogene Bewegungssystem Atmung und Blutkreislauf 1.
Angebote für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
 Angebote für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I Waldpädagogische Themen in Bezug zur Leitperspektive der Bildung für nachhalti- gen Entwicklung (BNE) Bildung für nachhaltige Entwicklung befähigt
Angebote für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I Waldpädagogische Themen in Bezug zur Leitperspektive der Bildung für nachhalti- gen Entwicklung (BNE) Bildung für nachhaltige Entwicklung befähigt
Fachwissen. Kommunikation. Bewertung. Kompetenzbereich. Erkenntnisgewinnung. Zusatzmodul in der regionalen Fortbildung
 Fachwissen Kommunikation Erkenntnisgewinnung Bewertung Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Zusatzmodul in der regionalen Fortbildung Erkenntnisgewinnung in den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb in den
Fachwissen Kommunikation Erkenntnisgewinnung Bewertung Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Zusatzmodul in der regionalen Fortbildung Erkenntnisgewinnung in den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb in den
Das Wichtigste auf einen Blick... 66
 Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Inhaltsverzeichnis. Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16
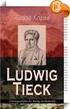 Inhaltsverzeichnis Was sind Naturwissenschaften?... 8 Rundgang durch den Nawi-Raum... 10 Kennzeichen des Lebendigen................................. 12 Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16 Die Pflanzenzelle...
Inhaltsverzeichnis Was sind Naturwissenschaften?... 8 Rundgang durch den Nawi-Raum... 10 Kennzeichen des Lebendigen................................. 12 Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16 Die Pflanzenzelle...
Der Wahlpflichtbereich
 Lernbereich Naturwissenschaften Der Wahlpflichtbereich Der naturwissenschaftliche Unterricht im Wahlpflichtbereich soll das besondere Interesse der Schülerschaft für naturwissenschaftliche Inhalte, Denk-
Lernbereich Naturwissenschaften Der Wahlpflichtbereich Der naturwissenschaftliche Unterricht im Wahlpflichtbereich soll das besondere Interesse der Schülerschaft für naturwissenschaftliche Inhalte, Denk-
und folgenden Unterricht Kooperation Vorunterrichtliche Erfahrungen,
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Chemie in der Jahrgangsstufe 6 (Klassenunterricht) Holzkamp-Gesamtschule, Witten (aktualisiert 2/2013) Unterrichtseinheit / Thema: Stoffe im Alltag, Stoffe können gefährlich
Schulinterner Lehrplan für das Fach Chemie in der Jahrgangsstufe 6 (Klassenunterricht) Holzkamp-Gesamtschule, Witten (aktualisiert 2/2013) Unterrichtseinheit / Thema: Stoffe im Alltag, Stoffe können gefährlich
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
KINDER FORSCHEN LERNEN MIT STUFENGERECHTEN EXPERIMENTEN
 KINDER FORSCHEN LERNEN MIT STUFENGERECHTEN EXPERIMENTEN Innovationstag SWiSE 29. März 2014 Judith Egloff, PH Zürich Ablauf des Ateliers Kurze Vorstellungsrunde Einstiegsreferat Ausprobieren, sichten, diskutieren
KINDER FORSCHEN LERNEN MIT STUFENGERECHTEN EXPERIMENTEN Innovationstag SWiSE 29. März 2014 Judith Egloff, PH Zürich Ablauf des Ateliers Kurze Vorstellungsrunde Einstiegsreferat Ausprobieren, sichten, diskutieren
2. Klassenarbeiten Im Fach Biologie werden in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben.
 1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
Kerncurriculum/Schulcurriculum für Klasse 5 und 6 im Fach Biologie
 Kerncurriculum/Schulcurriculum für Klasse 5 und 6 im Fach Biologie Klasse 5 Fachschaft Biologie Albert-Einstein-Gymnasium Reutlingen beschlossen von der Fachkonferenz am 04.03.04 Thema Inhalt Kerncurriculum
Kerncurriculum/Schulcurriculum für Klasse 5 und 6 im Fach Biologie Klasse 5 Fachschaft Biologie Albert-Einstein-Gymnasium Reutlingen beschlossen von der Fachkonferenz am 04.03.04 Thema Inhalt Kerncurriculum
Zooschule Artenschutz
 Zooschule Der Zoo Leipzig beging im Jahr 2008 sein 130-jähriges Jubiläum und befindet sich derzeit in seiner größten Umgestaltungsphase. Seit 2001 lädt die Welt der Menschenaffen, das Pongoland, die Besucher
Zooschule Der Zoo Leipzig beging im Jahr 2008 sein 130-jähriges Jubiläum und befindet sich derzeit in seiner größten Umgestaltungsphase. Seit 2001 lädt die Welt der Menschenaffen, das Pongoland, die Besucher
-lich Willkommen zum. Informationsabend. Realschule
 -lich Willkommen zum Informationsabend Realschule Neuerungen in der Bildungslandschaft Seit dem Schuljahr 2016/2017 gilt ein einheitlicher Bildungsplan für die Sekundarstufe I (Klasse 5-10). Orientierungsstufe
-lich Willkommen zum Informationsabend Realschule Neuerungen in der Bildungslandschaft Seit dem Schuljahr 2016/2017 gilt ein einheitlicher Bildungsplan für die Sekundarstufe I (Klasse 5-10). Orientierungsstufe
Schuleigener Lehrplan Chemie, Klasse 5 und 6
 Schuleigener Lehrplan Chemie, Klasse 5 und 6 Sachkenntnis S - Physikalische und chemische Phänomene auf der Modellebene von Teilchen deuten S1 - Chemische Reaktionen als Veränderung auf der Stoff- und
Schuleigener Lehrplan Chemie, Klasse 5 und 6 Sachkenntnis S - Physikalische und chemische Phänomene auf der Modellebene von Teilchen deuten S1 - Chemische Reaktionen als Veränderung auf der Stoff- und
Die Realschule in Baden-Württemberg.
 Kein Abschluss ohne Anschluss Realschule 6 Jahre allgemeine Bildung und vertieftes Grundwissen Praktische Berufe Schulische Bildungsgänge Bildungsplan Zielsetzungen des Bildungsplans: Erwerb von Erfahrungen
Kein Abschluss ohne Anschluss Realschule 6 Jahre allgemeine Bildung und vertieftes Grundwissen Praktische Berufe Schulische Bildungsgänge Bildungsplan Zielsetzungen des Bildungsplans: Erwerb von Erfahrungen
Zooschule. Angebote für Grundschulen
 Zooschule Der Zoo Leipzig ist ein geschichtsträchtiger Kulturort, der eine Fülle an Lernanlässen bietet. Er wirbt zu Recht mit dem Slogan "Der Natur auf der Spur". Mit der Umsetzung des Masterplans Zoo
Zooschule Der Zoo Leipzig ist ein geschichtsträchtiger Kulturort, der eine Fülle an Lernanlässen bietet. Er wirbt zu Recht mit dem Slogan "Der Natur auf der Spur". Mit der Umsetzung des Masterplans Zoo
Vorgaben für die Abiturprüfung 2017
 Vorgaben für die Abiturprüfung 2017 in den Bildungsgängen des Beruflichen Gymnasiums Anlagen D 1 D 28 Profil bildender Leistungskurs Fach Maschinenbautechnik Fachbereich Technik mbt_pblk_tech_abivorgaben2017
Vorgaben für die Abiturprüfung 2017 in den Bildungsgängen des Beruflichen Gymnasiums Anlagen D 1 D 28 Profil bildender Leistungskurs Fach Maschinenbautechnik Fachbereich Technik mbt_pblk_tech_abivorgaben2017
Fachcurriculum. BIOLOGIE Klassen 5 und 6
 Fachcurriculum BIOLOGIE Klassen 5 und 6 Ab Schuljahr 2004/05 Bilgie 5/6 Seite 1 Inhalte Kern- Schulcurriculumt Methdisch-didaktische Hinweise Kmpetenzschwerpunkte Themenbereich 1 Grundprinzipien des Lebens
Fachcurriculum BIOLOGIE Klassen 5 und 6 Ab Schuljahr 2004/05 Bilgie 5/6 Seite 1 Inhalte Kern- Schulcurriculumt Methdisch-didaktische Hinweise Kmpetenzschwerpunkte Themenbereich 1 Grundprinzipien des Lebens
1 Stoffe in Alltag und Technik
 Schülerband Blickpunkt Chemie 1 Niedersachsen (978-3-507-77292-2) Basiskonzept inhaltsbezogene Kompetenzen: Fachwissen prozessbezogene Kompetenzen: Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewertung Die Schülerinnen
Schülerband Blickpunkt Chemie 1 Niedersachsen (978-3-507-77292-2) Basiskonzept inhaltsbezogene Kompetenzen: Fachwissen prozessbezogene Kompetenzen: Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewertung Die Schülerinnen
Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn
 Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn 1 für die Sekundarstufe I Klassenstufe 5 Optional: Hund oder Katze; Rind oder 10 F 1.4, F2.4, Pferd F2.6, F3.2 -Tierhaltung und Tierpflege
Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn 1 für die Sekundarstufe I Klassenstufe 5 Optional: Hund oder Katze; Rind oder 10 F 1.4, F2.4, Pferd F2.6, F3.2 -Tierhaltung und Tierpflege
Kern- und Schulcurriculum für das Fach Biologie Klassenstufe 5/6
 Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Im Eichbäumle 1 76139 Karlsruhe Kern- und Schulcurriculum für das Fach Biologie Klassenstufe 5/6 Stundenbedarf 10 (6+4) S/F A, V R I/K typische Merkmale der Insekten und die
Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Im Eichbäumle 1 76139 Karlsruhe Kern- und Schulcurriculum für das Fach Biologie Klassenstufe 5/6 Stundenbedarf 10 (6+4) S/F A, V R I/K typische Merkmale der Insekten und die
Schuleigener Lehrplan Biologie (Grundlage: KLP 2008) Klasse 5. Vielfalt von Lebewesen. Stand: Zeit Std ca. 14
 ca. 14 Vielfalt von Lebewesen Lebensräume, Artenkenntnis, Bauplan von Blütenpflanzen und Insekten, Unterscheidung zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen, Fortbewegung, Nahrungsbeziehung en Was lebt in meiner
ca. 14 Vielfalt von Lebewesen Lebensräume, Artenkenntnis, Bauplan von Blütenpflanzen und Insekten, Unterscheidung zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen, Fortbewegung, Nahrungsbeziehung en Was lebt in meiner
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft. Analysekompetenz (A)
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der
Lernaufgaben Sachunterricht
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein - Westfalen Lernaufgaben Sachunterricht Grundschule Natur und Leben Wie kann man Salz und Wasser trennen? I. Übersicht: Sachunterricht Bereich:
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein - Westfalen Lernaufgaben Sachunterricht Grundschule Natur und Leben Wie kann man Salz und Wasser trennen? I. Übersicht: Sachunterricht Bereich:
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Musik. Musik hören und beschreiben
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Musik Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Musik Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in
Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium
 Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium Niveaukonkretisierung für Physik Klasse 10 Landesinstitut für Schulentwicklung Elektromotoren Qualitätsentwicklung und Evaluation Schulentwicklung und empirische
Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium Niveaukonkretisierung für Physik Klasse 10 Landesinstitut für Schulentwicklung Elektromotoren Qualitätsentwicklung und Evaluation Schulentwicklung und empirische
Themenplan MNT. Thema Inhalte Bezug zu Bildungsstandards. Lebensweise der Rennmaus Beobachten; Dokumentieren der Beobachtungen
 Folgende Themen können zum Erarbeiten von Methoden- und Fachkompetenzen behandelt werden. Es ist nicht notwendig alle aufgeführten Themen zu behandeln, um die Kompetenzen zu erreichen. Tiere im Klassenzimmer
Folgende Themen können zum Erarbeiten von Methoden- und Fachkompetenzen behandelt werden. Es ist nicht notwendig alle aufgeführten Themen zu behandeln, um die Kompetenzen zu erreichen. Tiere im Klassenzimmer
Handlungsfelder schulischer Prävention: die Leitperspektive Prävention und Gesundheitsförderung
 Handlungsfelder schulischer Prävention: die Leitperspektive Prävention und Gesundheitsförderung Kongress zur Bildungsplanreform 2016 Liane Hartkopf KM, Referat 56 Prävention und Schulpsychologische Dienste
Handlungsfelder schulischer Prävention: die Leitperspektive Prävention und Gesundheitsförderung Kongress zur Bildungsplanreform 2016 Liane Hartkopf KM, Referat 56 Prävention und Schulpsychologische Dienste
Naturwissenschaftliches Propädeutikum Lehrplan für das kantonale Zusatzfach
 Kantonsschule Zug l Gymnasium Naturwissenschaftliches Propädeutikum Kantonales Zusatzfach Naturwissenschaftliches Propädeutikum Lehrplan für das kantonale Zusatzfach A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3.
Kantonsschule Zug l Gymnasium Naturwissenschaftliches Propädeutikum Kantonales Zusatzfach Naturwissenschaftliches Propädeutikum Lehrplan für das kantonale Zusatzfach A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3.
Bildungsplanreform 2015/2016. Baden-Württemberg
 Bildungsplanreform 2015/2016 Baden-Württemberg Die BP-Reform 2015 im Fach Mathematik Arbeitsauftrag der Kommission Aufbau des neuen Planes Umgang mit den Plan 2015 Ein genauerer Blick auf die Erprobungsfassung
Bildungsplanreform 2015/2016 Baden-Württemberg Die BP-Reform 2015 im Fach Mathematik Arbeitsauftrag der Kommission Aufbau des neuen Planes Umgang mit den Plan 2015 Ein genauerer Blick auf die Erprobungsfassung
Kompetenzen, die mit dem Wald-Papier-Projekt erreicht werden können:
 Kompetenzen, die mit dem Wald-Papier-Projekt erreicht werden können: 1. Bereich: Natur und Leben Stoffe und ihre Umwandlung legen eine Sammlung von Materialien aus der belebten und unbelebten Natur an
Kompetenzen, die mit dem Wald-Papier-Projekt erreicht werden können: 1. Bereich: Natur und Leben Stoffe und ihre Umwandlung legen eine Sammlung von Materialien aus der belebten und unbelebten Natur an
Stdn. Themenbereich 2: Vom Wolf zum Dackel Verbindliche Inhalte Basiskonzepte Kompetenzen Lehrbuch-
 Fortschreibung von 2008/09 Themenbereich 1: Biologie ein neues Fach Verbindliche Inhalte Basiskonzepte Kompetenzen a) vorwiegend prozessbezogene K. b) inhaltsbezogene K. Lehrbuch- Zeitplan Kompartimentierung,
Fortschreibung von 2008/09 Themenbereich 1: Biologie ein neues Fach Verbindliche Inhalte Basiskonzepte Kompetenzen a) vorwiegend prozessbezogene K. b) inhaltsbezogene K. Lehrbuch- Zeitplan Kompartimentierung,
Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS)
 Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Das Fach Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Ziele der ökonomischen Bildung Ökonomisch geprägte Lebenssituationen
Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Das Fach Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Ziele der ökonomischen Bildung Ökonomisch geprägte Lebenssituationen
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14
 Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
THEMENFELD 4: PFLANZEN, TIERE, LEBENSRÄUME. Folie 1
 Fortbildung des PL Rheinland-Pfalz, Beraterinnen und Berater für Unterrichtsentwicklung Naturwissenschaften (FAMONA) 2011 Folie 1 Klasse 5: Von den Sinnen zum Messen Vom ganz Kleinen und ganz Großen Bewegung
Fortbildung des PL Rheinland-Pfalz, Beraterinnen und Berater für Unterrichtsentwicklung Naturwissenschaften (FAMONA) 2011 Folie 1 Klasse 5: Von den Sinnen zum Messen Vom ganz Kleinen und ganz Großen Bewegung
Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 5-6
 ASG Schulcurriculum Biologie Jg. 5/6-1 - Stand: Feb 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 5-6 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94)
ASG Schulcurriculum Biologie Jg. 5/6-1 - Stand: Feb 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 5-6 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94)
MNT-Planung - Übersicht über die Stoffgebiete in Klasse 5 und 6
 MNT-Planung - Übersicht über die Stoffgebiete in Klasse 5 und 6 (auf dem Computer: Thema anklicken, dann springt der Cursor zum Themenblatt) Pflanzen und Tiere im Lebensraum Pflanzen und Tiere im Lebensraum
MNT-Planung - Übersicht über die Stoffgebiete in Klasse 5 und 6 (auf dem Computer: Thema anklicken, dann springt der Cursor zum Themenblatt) Pflanzen und Tiere im Lebensraum Pflanzen und Tiere im Lebensraum
Der Fächerverbund in Klasse 10 Umsetzung des Integrativen Moduls
 Der Fächerverbund in Klasse 10 Umsetzung des Integrativen Moduls Sonja Winklhofer Leitgedanken zum Kompetenzerwerb im Fächerverbund GWG Bildungsplan 2004, S. 234 Die wachsende Komplexität unserer heutigen
Der Fächerverbund in Klasse 10 Umsetzung des Integrativen Moduls Sonja Winklhofer Leitgedanken zum Kompetenzerwerb im Fächerverbund GWG Bildungsplan 2004, S. 234 Die wachsende Komplexität unserer heutigen
Bildungsplan 2016: Die Leitperspektive BTV. Bildungsplan Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV)
 Bildungsplan 2016 Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) Gliederung Vorbemerkung: Die doppelte Funktion eines Bildungsplans 1. Wofür eigentlich Leitperspektiven? 2. Die
Bildungsplan 2016 Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) Gliederung Vorbemerkung: Die doppelte Funktion eines Bildungsplans 1. Wofür eigentlich Leitperspektiven? 2. Die
Ökologie Grundkurs. Unterrichtsvorhaben IV:
 Ökologie Grundkurs Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Autökologische Untersuchungen Welchen Einfluss haben abiotische Faktoren auf das Vorkommen von Arten? Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: E1
Ökologie Grundkurs Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Autökologische Untersuchungen Welchen Einfluss haben abiotische Faktoren auf das Vorkommen von Arten? Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: E1
Jahrgangsstufe 6 Inhaltsfeld: Sexualerziehung (Hier gelten die Richtlinien der Sexualerziehung)
 Jahrgangsstufe 6 Inhaltsfeld: Sexualerziehung (Hier gelten die Richtlinien der Sexualerziehung) Entwicklung und Fortpflanzung des Menschen - Veränderungen in der Pubertät - Bau und Funktion der Geschlechtsorgane
Jahrgangsstufe 6 Inhaltsfeld: Sexualerziehung (Hier gelten die Richtlinien der Sexualerziehung) Entwicklung und Fortpflanzung des Menschen - Veränderungen in der Pubertät - Bau und Funktion der Geschlechtsorgane
Lehrplan Sachkunde Klassenstufen 1 und 2
 Lehrplan Sachkunde Klassenstufen 1 und 2 Gesellschaft und Politik Lernziele Inhalte Hinweise erkennen, dass das Zusammenleben durch Symbole, Regeln und Rituale organisiert wird und diese Orientierung Sicherheit
Lehrplan Sachkunde Klassenstufen 1 und 2 Gesellschaft und Politik Lernziele Inhalte Hinweise erkennen, dass das Zusammenleben durch Symbole, Regeln und Rituale organisiert wird und diese Orientierung Sicherheit
JMS Curriculum Biologie 6. Jahrgangsstufe
 Blütenpflanzen Wildpflanzen in ihrem Lebensraum, Kulturpflanzen Stundenzahl 10 Heimische - Kennübungen Pflanzenmaterial Exkursionen Blütenpflanzen Bestimmungbücher - Einordnen in Verwandtschaftsgruppe
Blütenpflanzen Wildpflanzen in ihrem Lebensraum, Kulturpflanzen Stundenzahl 10 Heimische - Kennübungen Pflanzenmaterial Exkursionen Blütenpflanzen Bestimmungbücher - Einordnen in Verwandtschaftsgruppe
Basiskonzept: Stoff-Teilchen (3/7)
 Basiskonzept: Stoff-Teilchen (3/7) 1 Schuljahrgänge 7 und 8 Stoffe besitzen quantifizierbare Eigenschaften Die Schülerinnen und Schüler... unterscheiden Stoffe anhand von Schmelz- und Siedetemperatur.
Basiskonzept: Stoff-Teilchen (3/7) 1 Schuljahrgänge 7 und 8 Stoffe besitzen quantifizierbare Eigenschaften Die Schülerinnen und Schüler... unterscheiden Stoffe anhand von Schmelz- und Siedetemperatur.
Bildungsplan Gymnasium Physik Kompetenzen und (verbindliche) Inhalte Klasse 8
 Bildungsplan Gymnasium Physik Kompetenzen und (verbindliche) Inhalte Klasse 8 1. Physik als Naturbeobachtung unter bestimmten Aspekten a) zwischen Beobachtung und physikalischer Erklärung unterscheiden
Bildungsplan Gymnasium Physik Kompetenzen und (verbindliche) Inhalte Klasse 8 1. Physik als Naturbeobachtung unter bestimmten Aspekten a) zwischen Beobachtung und physikalischer Erklärung unterscheiden
Gesamtplan BNT - Themen- und Stundenverteilung für die Klassen 5 und 6 (Modell "klassisch": 4 +2)
 Gesamtplan BNT - Themen- und Stundenverteilung für die Klassen 5 und 6 (Modell "klassisch": 4 +2) Biologie und NT werden parallel unterrichtet: 2 Wochenstunden Biologie und 1 Wochenstunde Naturphänomene-Technik
Gesamtplan BNT - Themen- und Stundenverteilung für die Klassen 5 und 6 (Modell "klassisch": 4 +2) Biologie und NT werden parallel unterrichtet: 2 Wochenstunden Biologie und 1 Wochenstunde Naturphänomene-Technik
Sicherheitsvorkehrungen im Chemieunterricht
 Thema.: Sicherheitsvorkehrungen im Chemieunterricht Kompetenz: LehramtsanwärterInnen kennen und beachten die grundlegenden gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. die geltenden Sicherheitsbestimmungen: rechtliche
Thema.: Sicherheitsvorkehrungen im Chemieunterricht Kompetenz: LehramtsanwärterInnen kennen und beachten die grundlegenden gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. die geltenden Sicherheitsbestimmungen: rechtliche
Wirtschaft-Arbeit-Technik im neuen Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufe 1 bis 10 (Berlin/Brandenburg) 24. Februar 2015
 Wirtschaft-Arbeit-Technik im neuen Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufe 1 bis 10 (Berlin/Brandenburg) 24. Februar 2015 Auftrag Entwicklung neuer Rahmenlehrpläne für die Grundschule und die Sekundarstufe
Wirtschaft-Arbeit-Technik im neuen Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufe 1 bis 10 (Berlin/Brandenburg) 24. Februar 2015 Auftrag Entwicklung neuer Rahmenlehrpläne für die Grundschule und die Sekundarstufe
Umsetzung des Bildungsplans 2016 GS Sachunterricht für Baden-Württemberg
 Umsetzung des Bildungsplans 2016 GS Sachunterricht für Baden-Württemberg Pusteblume Das Sachbuch 2 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klasse 2 Prozessbezogene Teilkompetenzen Klasse 2 Umsetzung
Umsetzung des Bildungsplans 2016 GS Sachunterricht für Baden-Württemberg Pusteblume Das Sachbuch 2 Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klasse 2 Prozessbezogene Teilkompetenzen Klasse 2 Umsetzung
Naturwissenschaft und Technik
 Naturwissenschaft und Technik Das Profilfach des naturwissenschaftlichen Profils auf der Basis von Biologie, Chemie, Erdkunde und Physik, ergänzt durch Technik Biologie Chemie Physik NWT: Vernetztes Lernen
Naturwissenschaft und Technik Das Profilfach des naturwissenschaftlichen Profils auf der Basis von Biologie, Chemie, Erdkunde und Physik, ergänzt durch Technik Biologie Chemie Physik NWT: Vernetztes Lernen
KLASSE: 5 (1. HALBJAHR)
 Heinrich Böll Gymnasiuum Troisdorf Sieglar Fachschaft Biologie Interne Lehrpläne Biologie, Sek. I KLASSE: 5 (1. HALBJAHR) 1. Inhaltsfeld: Bau und Leistungen des menschlichen Körpers 2. Fachliche Kontexte:
Heinrich Böll Gymnasiuum Troisdorf Sieglar Fachschaft Biologie Interne Lehrpläne Biologie, Sek. I KLASSE: 5 (1. HALBJAHR) 1. Inhaltsfeld: Bau und Leistungen des menschlichen Körpers 2. Fachliche Kontexte:
Im Schuljahr 2016/17 sind für die allgemein bildenden Schulen folgende Lehrplanvorgaben verbindlich:
 3 2/5012 Im Schuljahr 2016/17 sind für die allgemein bildenden Schulen folgende Lehrplanvorgaben verbindlich: 1. Grundschule alle 1-4 Leitgedanken zu den Lehrplänen für die Grundschule und für die Förderschule
3 2/5012 Im Schuljahr 2016/17 sind für die allgemein bildenden Schulen folgende Lehrplanvorgaben verbindlich: 1. Grundschule alle 1-4 Leitgedanken zu den Lehrplänen für die Grundschule und für die Förderschule
Wahlpflichtfach Technik
 Erzähl mir etwas und ich vergesse es. Zeig mir etwas und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich verstehe. Konfuzius chin. Philosoph Wahlpflichtbereich Technik an der Realschule Neckartenzlingen Aussagen
Erzähl mir etwas und ich vergesse es. Zeig mir etwas und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich verstehe. Konfuzius chin. Philosoph Wahlpflichtbereich Technik an der Realschule Neckartenzlingen Aussagen
Zygote, (Morula), (Blastula), Einnistung, Plazenta, Mutterkuchen
 5a Das Leben beginnt vor der Geburt Erste Schritte von der befruchteten Eizelle zur Einnistung Schwangerschaft Veränderungen für Mutter und Kind Vorsorgeuntersuchungen ärztliche Begleitung der Schwangerschaft
5a Das Leben beginnt vor der Geburt Erste Schritte von der befruchteten Eizelle zur Einnistung Schwangerschaft Veränderungen für Mutter und Kind Vorsorgeuntersuchungen ärztliche Begleitung der Schwangerschaft
Name: Klasse: 4. Überfachliche Kompetenzen
 Arbeitsverhalten Überfachliche Kompetenzen Du hast die benötigten Unterrichts- und Arbeitsmaterialien dabei. Du beteiligst dich mit sinnvollen Beiträgen am Unterrichtsgespräch. Du hältst dich an die Gesprächsregeln.
Arbeitsverhalten Überfachliche Kompetenzen Du hast die benötigten Unterrichts- und Arbeitsmaterialien dabei. Du beteiligst dich mit sinnvollen Beiträgen am Unterrichtsgespräch. Du hältst dich an die Gesprächsregeln.
Kompetenzmodell 8. Schulstufe (Stand September 2007)
 Kompetenzmodell 8. Schulstufe (Stand September 2007) Handlungsbereiche Beobachten, Erfassen, Beschreiben Untersuchen, Bearbeiten, nterpretieren Bewerten, Entscheiden, Handeln Umfasst die Kompetenz, Vorgänge
Kompetenzmodell 8. Schulstufe (Stand September 2007) Handlungsbereiche Beobachten, Erfassen, Beschreiben Untersuchen, Bearbeiten, nterpretieren Bewerten, Entscheiden, Handeln Umfasst die Kompetenz, Vorgänge
Schulcurriculum Chemie Klasse 7
 Schulcurriculum Chemie Klasse 7 Inhaltsfeld 1: Stoffe und Stoffveränderungen 3:Wasser und Luft 2: Stoff- und Energieumsätze bei chemischen Reaktionen 4: Metalle und Metallgewinnung Kl. Prozessbezogene
Schulcurriculum Chemie Klasse 7 Inhaltsfeld 1: Stoffe und Stoffveränderungen 3:Wasser und Luft 2: Stoff- und Energieumsätze bei chemischen Reaktionen 4: Metalle und Metallgewinnung Kl. Prozessbezogene
Schulinternes Curriculum Physik
 Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe 7 Inhaltsfelder: Optische Instrumente, Farbzerlegung des Lichtes, Elektrizitätslehre Fachlicher Kontext / Dauer in Wo. Mit optischen Geräten Unsichtbares
Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe 7 Inhaltsfelder: Optische Instrumente, Farbzerlegung des Lichtes, Elektrizitätslehre Fachlicher Kontext / Dauer in Wo. Mit optischen Geräten Unsichtbares
Im Schuljahr 2015/16 sind für die allgemein bildenden Schulen folgende Lehrplanvorgaben verbindlich:
 3 2/5012 Im Schuljahr 2015/16 sind für die allgemein bildenden Schulen folgende Lehrplanvorgaben verbindlich: 1. Grundschule alle 1-4 Leitgedanken zu den Lehrplänen für die Grundschule und für die Förderschule
3 2/5012 Im Schuljahr 2015/16 sind für die allgemein bildenden Schulen folgende Lehrplanvorgaben verbindlich: 1. Grundschule alle 1-4 Leitgedanken zu den Lehrplänen für die Grundschule und für die Förderschule
Information über die Anforderungen an die Heftführung. Filmanalyse zur Körpersprache des Hundes (DVD)
 Jahrgangsstufe 5.1 Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen, Subkontext: Was lebt in meiner Nachbarschaft? [5.1: erstes Thema] Inhaltliche
Jahrgangsstufe 5.1 Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen, Subkontext: Was lebt in meiner Nachbarschaft? [5.1: erstes Thema] Inhaltliche
Ansätze für Waldpädagogik in den Bildungsplänen von 2004 der Hauptschule und Werkrealschule
 Ansätze für Waldpädagogik in den Bildungsplänen von 2004 der Hauptschule und Werkrealschule Kl. Fach Bildungsstandard Seite 6 Ev. Religionslehre Themenfelder: mit anderen zusammenleben/ Schöpfung und Verantwortung/
Ansätze für Waldpädagogik in den Bildungsplänen von 2004 der Hauptschule und Werkrealschule Kl. Fach Bildungsstandard Seite 6 Ev. Religionslehre Themenfelder: mit anderen zusammenleben/ Schöpfung und Verantwortung/
Erwartete Kompetenzen. Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Die Schülerinnen und Schüler E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17
 Stoffverteilungsplan Kerncurriculum für die Oberschule in Niedersachsen (Schuljahrgänge 7/8) PRISMA Chemie Niedersachsen Differenzierende Ausgabe Band 7/8 Schule: Klettbuch ISBN 978-3-12-068537-1 Lehrer:
Stoffverteilungsplan Kerncurriculum für die Oberschule in Niedersachsen (Schuljahrgänge 7/8) PRISMA Chemie Niedersachsen Differenzierende Ausgabe Band 7/8 Schule: Klettbuch ISBN 978-3-12-068537-1 Lehrer:
Schulinternes Curriculum Physik
 Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe Kontexte Inhalte Vorschläge für zentrale Versuche Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 8 Elektrizität messen, verstehen, anwenden Alltagserfahrungen
Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe Kontexte Inhalte Vorschläge für zentrale Versuche Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 8 Elektrizität messen, verstehen, anwenden Alltagserfahrungen
INFORMATIONS- TECHNISCHE GRUNDBILDUNG
 BILDUNGSSTANDARDS FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG 309 INFORMATIONS- TECHNISCHE GRUNDBILDUNG 310 LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG I. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
BILDUNGSSTANDARDS FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG 309 INFORMATIONS- TECHNISCHE GRUNDBILDUNG 310 LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG I. Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
Grundschule: Anbindung an den Unterricht des Fächerverbundes Mensch, Natur und Kultur
 Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach Anbindung der pädagogischen Programme an die Bildungspläne der Grund-, Haupt- und Werkrealschulen Stand: März 2015 von Hanno Hohenberger Programm 1: Heut ist Waschtag
Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach Anbindung der pädagogischen Programme an die Bildungspläne der Grund-, Haupt- und Werkrealschulen Stand: März 2015 von Hanno Hohenberger Programm 1: Heut ist Waschtag
BNT Wasser - ein lebenswichtiger Stof
 BNT Wasser - ein lebenswichtiger Stof Fische Wirbeltiere im Wasser Biologie Verortung im Jahresplan (4 + 2) Kz. Leben Fische Säugetiere 20 23 3 4 i=8 Ch. Ph. Kl. 5 f=1 t Schwimmen-Schweben-Sinken Dichte
BNT Wasser - ein lebenswichtiger Stof Fische Wirbeltiere im Wasser Biologie Verortung im Jahresplan (4 + 2) Kz. Leben Fische Säugetiere 20 23 3 4 i=8 Ch. Ph. Kl. 5 f=1 t Schwimmen-Schweben-Sinken Dichte
Laurentius-Siemer-Gymnasium Ramsloh Schuleigener Arbeitsplan für das Fach Biologie (gültig ab dem Schuljahr 2007/08)
 Jahrgangsstufe: 7/8 Lehrwerke / Hilfsmittel: Bioskop 7/8, Westermann, ISBN 978-3-14-150501-6 Inhalte / Themen: Kompetenzen: Die Reihenfolge ist nicht verbindlich, Seitenangaben in Kompetenzen gemäß Kerncurriculum
Jahrgangsstufe: 7/8 Lehrwerke / Hilfsmittel: Bioskop 7/8, Westermann, ISBN 978-3-14-150501-6 Inhalte / Themen: Kompetenzen: Die Reihenfolge ist nicht verbindlich, Seitenangaben in Kompetenzen gemäß Kerncurriculum
Bildungsplanreform 2015/16
 Bildungsplanreform 2015/16 Auftaktveranstaltung für die Erprobung der Arbeitsfassungen des Bildungsplanes 2015/16 11. Juli 2013 Übersicht Erfordernisse Zeitplan Eckpunkte Kompetenzbegriff und Strukturprinzip
Bildungsplanreform 2015/16 Auftaktveranstaltung für die Erprobung der Arbeitsfassungen des Bildungsplanes 2015/16 11. Juli 2013 Übersicht Erfordernisse Zeitplan Eckpunkte Kompetenzbegriff und Strukturprinzip
Naturwissenschaft in der Oberstufe
 Naturwissenschaft in der Oberstufe an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Bedburg-Hau, Förderschule für Körperliche und motorische Entwicklung Der naturwissenschaftliche Unterricht in der Oberstufe umfasst
Naturwissenschaft in der Oberstufe an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Bedburg-Hau, Förderschule für Körperliche und motorische Entwicklung Der naturwissenschaftliche Unterricht in der Oberstufe umfasst
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem
 Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem 1. Der Regenwurm in seinem Lebensraum Im Biologiebuch findest du Informationen über den Regenwurm. Lies den Text durch und betrachte die Abbildung. Regenwürmer
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem 1. Der Regenwurm in seinem Lebensraum Im Biologiebuch findest du Informationen über den Regenwurm. Lies den Text durch und betrachte die Abbildung. Regenwürmer
Bildungsplan 2016 Sekundarstufe I
 Bildungsplan 2016 Sekundarstufe I Beispielcurriculum für den Fächerverbund BNT Landesinstitut für Schulentwicklung Klassen 5/6 Beispiel Hauptschule / Werkrealschule / Realschule Qualitätsentwicklung und
Bildungsplan 2016 Sekundarstufe I Beispielcurriculum für den Fächerverbund BNT Landesinstitut für Schulentwicklung Klassen 5/6 Beispiel Hauptschule / Werkrealschule / Realschule Qualitätsentwicklung und
Pädagogik/Psychologie Lehrplan für das Ergänzungsfach
 Kantonsschule Zug l Gymnasium Pädagogik/Psychologie Ergänzungsfach Pädagogik/Psychologie Lehrplan für das Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 0 0 0 5 B. Didaktische
Kantonsschule Zug l Gymnasium Pädagogik/Psychologie Ergänzungsfach Pädagogik/Psychologie Lehrplan für das Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 0 0 0 5 B. Didaktische
