Schulinternes Curriculum. Biologie. Klasse 5+6
|
|
|
- Arthur Gehrig
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Schulinternes Curriculum im Fach Biologie Church Street 11-15, Windhoek. P O Box 78 Namibia. Tel +264 (0) Fax +264 (0) verwaltung@dhpswindhoek.com Home page: Klasse 5+6 Seite 1 von 18
2 Dieses schulinterne Curriculum ist in enger Anlehnung an den Bildungsplan 2016 für Allgemein bildenden Schulen Sekundarstufe I des Bundeslandes Baden- Württemberg erstellt. In Abwandlung zum Kerncurriculum Baden-Württemberg wird in Klasse 5 und 6 anstelle von BNT das Fach Biologie unterrichtet. Im Biologieunterricht der Klassen 5 und 6 soll der Anknüpfungspunkt der naturwissenschaftliche Unterricht der Grundschule sein. Den Schülerinnen und Schülern soll der Formenreichtum, die Vielseitigkeit und ökologische Bedeutung verschiedener Wirbeltiere, ausgewählter Wirbelloser und verschiedener Blütenpflanzen bewusstgemacht werden. Sie erkennen, dass die Vielfalt das Ergebnis einer evolutionären Entwicklung ist. Auf der Basis einer angemessenen Artenkenntnis entwickeln sie eine Wertschätzung für die Natur. Die Schülerinnen und Schüler kennen grundlegende Vorgänge der Entwicklung und Fortpflanzung des Menschen, sie werden dadurch auf die Veränderungen ihres Körpers während der Pubertät vorbereitet. Da an der DHPS in der Jahrgangsstufe 8 kein Biologieunterricht stattfindet, wurden die Themenbereiche für die Jahrgangsstufen 7, 9 und 10 diesbezüglich angepasst. Da an der Schule in der Klasse 6 eine einwöchige Exkursion in ein Umweltbildungszentrum (NADEET) und in der Klasse 11 eine Wüstenexkursion in die Wüstenforschungsstation Gobabeb stattfindet, werden die Inhalte zur Ökologie in den Jahrgangsstufen 6 und 11 unterrichtet. Der Unterricht erfolgt in den Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 9 jeweils einmal wöchentlich in einer Doppelstunde. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 findet ab 2018 der Unterricht auf Englisch statt. Im Unterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler naturwissenschaftliche Kompetenzen im Allgemeinen sowie biologische Kompetenzen im Besonderen. Seite 2 von 18
3 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Kompetenzen weisen folgende Merkmale auf: Sie zielen auf die erfolgreiche und verantwortungsvolle Bewältigung von Aufgaben und Problemstellungen ab. Sie verknüpfen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu eigenem Handeln. Die Bewältigung von Aufgaben setzt gesichertes Wissen und die Beherrschung fachbezogener Verfahren voraus sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, diese gezielt einzusetzen. Sie stellen eine Zielperspektive für längere Abschnitte des Lernprozesses dar. Sie sind für die persönliche Bildung und für die schulische und berufliche Ausbildung von Bedeutung und ermöglichen anschlussfähiges Lernen. Die erwartenden Kompetenzen werden in Kompetenzbereiche zusammengefasst, die den Unterricht strukturieren. Aufgabe des Unterrichts ist es, die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler anzuregen, zu unterstützen, zu fördern und langfristig zu sichern. Dies gilt auch für die fachübergreifenden Zielsetzungen der Persönlichkeitsbildung. Neben den inhaltbezogenen Kompetenzen, die das Fachwissen strukturieren, erwerben die Schülerinnen und Schüler auch Kompetenzen in den drei prozessbezogenen Kompetenzbereichen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung. Diese Kompetenzen können jeweils nur gemeinsam und in Kontexten erworben werden, insbesondere können die Kompetenzen der prozessbezogenen Kompetenzen nicht ohne Verknüpfung mit Inhalten des inhaltsbezogenen Kompetenzbereichs erworben oder angewendet werden. Nebenstehende Grafik veranschaulicht diesen Sachverhalt: Seite 3 von 18
4 1. Sachbezogene Kompetenzen Das für die Entwicklung von Sachkompetenz erforderliche Fachwissen bezieht sich schwerpunktmäßig auf Basiskonzepte, die an den Organisationsebenen Zelle, Organismus und Ökosystem dargestellt werden. Basiskonzepte Die Schülerinnen und Schüler können an geeigneten Beispielen Struktur und Funktion Struktur-Funktions-Beziehungen ableiten Aufnahme, Transport und Abgabe von Stoffen in Pflanzen und Tieren erklären Kompartimentierung abgegrenzte Reaktionsräume als Voraussetzung für den ungestörten Verlauf von Prozessen erläutern z.b. chemische Reaktionen, Abhängigkeit einer Lebensgemeinschaft von einem Lebensraum mit spezifischen Merkmalen, ökologische Nischen Reproduktion die Bedeutung der Reproduktion lebender Systeme erläutern Varianten der Vervielfältigung (ungeschlechtliche, geschlechtliche Fortpflanzung) beschreiben die Bedeutung von Mitose und Meiose erläuten und 2. Mendelsche Regel anwenden Information und Kommunikation die Bedeutung von Nerven- und Hormonsystem für Information und Kommunikation erläutern den Ablauf zellulärer und humoraler Immunantwort beschreiben und deren Bedeutung erläutern verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten beschreiben (z. B. an Reiz-Reaktionskette, Hormone, Partnersuche) Seite 4 von 18
5 Basiskonzepte Die Schülerinnen und Schüler können an geeigneten Beispielen Steuerung und Regelung die Bedeutung von Steuerung und Regelung in lebenden Systemen erläutern Regelkreise und ihre Beeinflussung beschreiben (z. B. Blutzuckerspiegel, Steuerung des weiblichen Zyklus, Räuber- Beute-Beziehung) Stoff- und Energieumwandlung die Bedeutung der Aufnahme, Umwandlung und Abgabe von Stoffen und Energie für lebende Systeme erläutern Variabilität und Angepasstheit Kennzeichen verschiedener Tierklassen (ausgewählte Wirbellose und Wirbeltiere) und Pflanzenfamilien (z. B. Kreuzblütengewächse, Kieferngewächse) beschreiben Anpassungen und Angepasstheiten von Organismen an ihre Umwelt erklären Entwicklung die Entwicklung von Zellen, Organismen und Ökosystemen beschreiben - Prinzip der Zellteilung und Zellwachstum - Entwicklung von Organismen - zeitliche Veränderungen eines Ökosystems Geschichte und Verwandtschaft die Variabilität der Lebewesen als Voraussetzung und Ergebnis der Evolution erklären - Bedeutung des Zusammenwirkens von Evolutionsfaktoren Seite 5 von 18
6 2. Prozessbezogene Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit biologischen Fragestellungen auseinander und sind in der Lage, diese mithilfe von Experimenten und weiteren fachspezifischen Methoden zu bearbeiten und mit Modellvorstellungen zu erklären. Sie nutzen hierzu auch außerschulische Lernorte wie Schulgelände mit Teich oder Schulgarten, schulnahe Lebensräume, Umweltzentren, botanische und zoologische Gärten oder Naturkundemuseen. Die Schülerinnen und Schüler können biologische Arbeitstechniken anwenden 1. ein Mikroskop bedienen, mikroskopische Präparate herstellen und zeichnen; 2. Anatomie und Morphologie von Lebewesen und Organen untersuchen; 3. Lebewesen kriteriengeleitet vergleichen und klassifizieren; 4. mit Bestimmungshilfen in einem Ökosystem häufig vorkommende Arten bestimmen; Experimente planen, durchführen und auswerten 5. Fragestellungen und Vermutungen zu biologischen Phänomenen formulieren; 6. Beobachtungen und Versuche durchführen und auswerten; 7. Arbeitsgeräte benennen und sachgerecht damit umgehen; 8. Hypothesen formulieren und zur Überprüfung geeignete Experimente planen; 9. qualitative und einfache quantitative Experimente durchführen, protokollieren und auswerten; 10. aus Versuchsergebnissen Regeln ableiten und deren Gültigkeit überprüfen; Modelle einsetzen 11. Struktur- und Funktionsmodelle zur Veranschaulichung anwenden; 12. Wechselwirkungen mithilfe von Modellen analysieren; 13. dynamische Prozesse in Ökosystemen mithilfe von Modellvorstellungen erklären; 14. die Speicherung und Weitergabe von Information mithilfe geeigneter Modelle beschreiben; 15. die Aussagekraft von Modellen beurteilen. Seite 6 von 18
7 Die Schülerinnen und Schüler werten Informationen zu biologischen Fragestellungen aus verschiedenen Quellen zielgerichtet aus, dokumentieren diese und tauschen sich darüber aus. Biologische Sachverhalte stellen sie mit geeigneten Präsentationstechniken und - medien dar. Sie können fachbezogenes Feedback geben und mit Kritik umgehen. Die Schülerinnen und Schüler können Informationen beschaffen und aufarbeiten 1. zu biologischen Themen in unterschiedlichen Quellen recherchieren; 2. Informationen zu biologischen Fragestellungen zielgerichtet auswerten und verarbeiten. Hierzu nutzen sie auch außerschulische Lernorte; 3. Informationen aus Texten, Bildern, Tabellen oder Grafiken entnehmen und aussagekräftig darstellen; 4. biologische Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache beschreiben oder erklären; 5. Zusammenhänge zwischen Alltagssituationen und biologischen Sachverhalten herstellen und dabei die Alltagssprache bewusst in Fachsprache übersetzen; 6. den Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit dokumentieren; 7. komplexe biologische Sachverhalte mithilfe von Schemazeichnungen, Grafiken, Diagrammen und 8. Modellen anschaulich darstellen. Informationen austauschen 9. adressatengerecht präsentieren; 10. sich selbst und andere in ihrer Individualität wahrnehmen und respektieren; 11. ihren Standpunkt zu biologischen Sachverhalten fachlich begründet vertreten; 12. für die Arbeit im Team Verantwortung übernehmen, gemeinsam planen, strukturieren und reflektieren. Seite 7 von 18
8 Die Schülerinnen und Schüler erkennen bei verschiedenen biologischen Themen deren gesellschaftliche Bedeutung. Ihr Fachwissen ermöglicht Ihnen eine multiperspektivische Betrachtung und befähigt sie, die unterschiedlichen Standpunkte begründet zu bewerten. Die Schülerinnen und Schüler können biologische Sachverhalte einordnen 1. in ihrer Lebenswelt biologische Sachverhalte erkennen; 2. Bezüge zu anderen Unterrichtsfächern herstellen; 3. die Aussagekraft von Darstellungen in Medien bewerten; 4. zwischen naturwissenschaftlichen und ethischen Aussagen unterscheiden; 5. naturwissenschaftliche Aussagen kritisch prüfen; 6. die Wirksamkeit von Lösungsstrategien bewerten. biologische Sachverhalte ethisch bewerten 7. biologische Sachverhalte unter dem Aspekt des Perspektivenwechsels beschreiben; 8. biologische Sachverhalte unter dem Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung beschreiben und beurteilen; 9. biologische Sachverhalte unter dem Aspekt der Würde des Menschen bewerten; 10. biologische Sachverhalte unter dem Aspekt der Verantwortung für die Natur beurteilen; 11. die eigenen und auch anderen Standpunkte begründen; 12. den Einfluss des Menschen auf Ökosysteme im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung bewerten; 13. ihr eigenes Handeln unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bewerten; 14. ihr eigenes Handeln unter dem Aspekt einer gesunden Lebensführung bewerten. Seite 8 von 18
9 Klasse ZELLULÄRE ORGANISATION DER LEBEWESEN 1. Kennzeichen der Lebewesen und die Zelle als strukturelle Grundeinheit von Lebewesen Die Schülerinnen und Schüler können Lebewesen von unbelebten Gegenständen unterscheiden und die Kennzeichen der Lebewesen beschreiben und erläutern. Sie können Zellen als strukturelle Grundeinheit von Lebewesen beschreiben. Die Schülerinnen und Schüler lernen wie man sogfältig mit einem Mikroskop umgeht und sammeln die ersten Erfahrungen beim Mikroskopieren. G2 Grundlegendes Niveau M2 Mittleres Niveau E2 Erweitertes Niveau Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler können Inhalte Zeit Methodencurriculum G2 M2 E2 (1) die Kennzeichen der Lebewesen nennen (1) die Kennzeichen der Lebewesen beschreiben (1) die Kennzeichen der Lebewesen beschreiben und erkennen Kennzeichen von Lebewesen 4 Arbeiten mit Texten: Aktives Lesen (Texte markieren, Schlüsselwörter suchen, einfache Mind Maps erstellen) Vergleich Maus Roboter (2) den Bau tierischer und/oder pflanzlicher Zellen anhand mikroskopischer Betrachtungen zeichnen und die lichtmikroskopisch erkennbaren Zellbestandteile benennen. 2) den Bau tierischer und/oder pflanzlicher Zellen anhand mikroskopischer Betrachtungen zeichnen und die lichtmikroskopisch erkennbaren Zellbestandteile benennen. 2) den Bau tierischer und/oder pflanzlicher Zellen anhand mikroskopischer Betrachtungen zeichnen, beschreiben und vergleichen. Aufbau Lichtmikroskop Bedienung Lichtmikroskop Herstellung einfacher Präparate (Zwiebelepidermis, Wasserpest, Mundschleimhaut) Einfache Skizzen anfertigen. Einfacher Bau einer Zelle Stationsarbeit Umgang mit Modellen Betrachten, Beobachten und Untersuchen Arbeiten mit Mikroskop Präparieren Modell herstellen Biologisches Zeichnen und Beschriften Umgang mit Modellen Bei schwächeren Schülern Fertigpräparate verwenden 2,7 3,4,7 2,7 3,4,7 2,7 3,4,7 Seite 9 von 18
10 5.2 Wirbeltiere Anhand ausgewählter Beispiele beschreiben sie Wirbeltiere in ihrer Vielfalt. Sie stellen deren Lebensweise und Fortpflanzung angemessen dar. Sie beschreiben den verantwortungsvollen Umgang mit Haus- und Nutztieren aufgrund ihrer Kenntnisse. Die Schülerinnen und Schüler kennen die typischen Merkmale der verschiedenen Wirbeltiergruppen und beschreiben die Angepasstheit der Wirbeltiere an die Umwelt. Einflüsse des Menschen auf deren Lebensweise können sie beschreiben und bewerten. Kompetenzen Inhalte Zeit Methodencurriculum G2 M2 E2 (1) die Lebensweise und den Körperbau von zwei Säugetieren, die als Haus- oder Nutztiere gehalten werden, beschreiben und vergleichen (z.b. Hund, Katze, Rind, Schwein, Pferd) (2) die typischen Säugetiermerkmale beschreiben 8 (1) die Lebensweise und den Körperbau von zwei Säugetieren, die als Haus- oder Nutztiere gehalten werden, beschreiben und vergleichen (z.b. Hund, Katze, Rind, Schwein, Pferd) (2) die typischen Säugetiermerkmale beschreiben 8 (1) die Lebensweise und den Körperbau von zwei Säugetieren, die als Hausoder Nutztiere gehalten werden, beschreiben und vergleichen (z.b. Hund, Katze, Rind, Schwein, Pferd) (2) die typischen Säugetiermerkmale beschreiben 8 Vergleich zweier Arten hinsichtlich Skelett, Schädel, Gebiss z.b. Hund und Kuh Zitzen, Fell, Plazenta Tiersteckbriefe oder Referate zu Arten mit Binnendifferenzierung Lernzirkel oder Stationsarbeit mit Binnendifferenzierung (3) angemessene Haltungsbedingungen von Haus- und Nutztieren anhand eines Beispiels beschreiben (3) angemessene Haltungsbedingungen von Haus- und Nutztieren anhand eines Beispiels erklären (z.b. unter dem Aspekt des Tierschutzes) (3) angemessene Haltungsbedingungen von Haus- und Nutztieren anhand eines Beispiels erklären (z.b. unter dem Apekt des Tierschutzes) Tierschutzgesetz Bedeutung von Tierschutz Kugellager (4) verschiedene Formen der Tierhaltung beschreiben (4) verschiedene Formen der Tierhaltung beschreiben und bewerten (z.b. artgerechte Hühnerhaltung) (4) verschiedene Formen der Tierhaltung beschreiben und bewerten (z.b. artgerechte Hühnerhaltung) Bsp.: Hühnerhaltung: Käfig-, Boden- u. Freilandhaltung Diskussionsrunde: 6 2, , ,3 10 Seite 10 von 18
11 (5) den Körperbau und die Lebensweise eines weiteren heimischen Säugetiers als Angepasstheit an den Lebensraum beschreiben (z.b. typische einheimische Vertreter der Raub-, Nage- und Huftiere. Oryx Anpassung an das Wüstenleben Fledermaus Ultraschallortung Goldmull Wüste Wale oder Delfine Meersessäugetiere) (5) den Körperbau und die Lebensweise eines weiteren heimischen Säugetiers als Angepasstheit an den Lebensraum erklären (z.b. typische einheimische Vertreter der Raub-, Nage- und Huftiere. Oryx Anpassung an das Wüstenleben Fledermaus Ultraschallortung Goldmull- Wüste Wale oder Delfine Meeressäuger ) (5) den Körperbau und die Lebensweise eines weiteren heimischen Säugetiers als Angepasstheit an den Lebensraum erklären und erläutern (z.b. typische einheimische Vertreter der Raub-, Nage- und Huftiere. Oryx Anpassung an das Wüstenleben Fledermaus Ultraschallortung Goldmull Wüste Wale und Delfine als Meeressäuger) Ultraschallortung Anpassungen an Lebensräume Galeriegang Animation der Schallortung 8 1,2 8 1,2 8 1,2 (6) die Lebensweise und den Körperbau von Vögeln und deren Federn beschreiben (6) die Lebensweise und den Körperbau von Vögeln und deren Federn beschreiben und vergleichen (6) die Lebensweise und den Körperbau von Vögeln und deren Federn beschreiben und vergleichen Allgemeine Merkmale der Vögel Bau der Federn Angepasstheit des Vogelkörpers an den Flug Leichtbauweise Kräfte beim Fliegen 6 Tiersteckbriefe oder Referate zu Arten Plakaterstellung Lernzirkel Stationsarbeit Karteikarten als Lernhilfen erstellen Federn mikroskopieren Besuch beim Vogel- Rehabilitationszentrum (7) die Angepasstheit der Vögel an verschiedene Lebensräume beschreiben (7) die Angepasstheit der Vögel an verschiedene Lebensräume beschreiben und erklären (7) die Angepasstheit der Vögel an verschiedene Lebensräume beschreiben und erklären und vergleichen Anpassung an Lebensraum (Schnäbel und Füße) Untersuchung eines Hühnereis Seite 11 von 18
12 (8) Die Fortpflanzung und Entwicklung von Vögeln beschreiben. Den Jungentypus (Nesthocker, Nestflüchter) beschreiben. Befruchtung und Entwicklung beim Huhn beschreiben. (8) Die Fortpflanzung und Entwicklung von Vögeln beschreiben. Den Jungentypus (Nesthocker, Nestflüchter) beschreiben und vergleichen. Befruchtung und Entwicklung beim Huhn beschreiben. (8) Die Fortpflanzung und Entwicklung von Vögeln beschreiben. Den Jungentypus (Nesthocker, Nestflüchter) beschreiben und vergleichen Befruchtung und Entwicklung beim Huhn beschreiben. Nesthocker und Nestflüchter Befruchtung und Entwicklung beim Huhn 1, 9,8,10 1, , 9,8,10 1,2 1 1, 9,8,10 1,2 9) die Angepassheit der Reptilien an das Leben an Land an einem konkreten Beispiel beschreiben ( innere Befruchtung, verhornte Haut, Lungenatmung) 9) die Angepassheit der Reptilien an das Leben an Land an zweiverschiedenen Beispielen beschreiben ( innere Befruchtung, verhornte Haut, Lungenatmung) 9) die Angepassheit der Reptilien an das Leben an Land an einem konkreten Beispiel erklären ( innere Befruchtung, verhornte Haut, Lungenatmung) Reptilien als wechselwarme Tiere; Thermoregulation Anpassung an den Lebensraum Saurier ausgestorbene Reptilien Stationsarbeit binnendifferenziert Steckbriefe oder Plakaterstellung Quizerstellung Durchführung von Experimenten zur Wärmeisolierung 6 1, 3 6 1, 3 6 1, 3 10) die typischen Merkmale der Amphibien als Angepasstheit an einem Beispiel beschreiben. (Atmung, Fortpflanzung und Entwicklung im Wasser) 10) die typischen Merkmale der Amphibien als Angepasstheit an einem Beispiel beschreiben. (Atmung, Fortpfalnzung und Entwicklung im Wasser Metamorphose der Froschlurche) 10) die typischen Merkmale der Amphibien als Angepasstheit an einem Beispiel beschreiben. (Atmung, Fortpfalnzung und Entwicklung im Wasser Metamorphose der Froschlurche ) Lebensweise und Entwicklung eines Frosches Metamorphose von der Kiemenzur Lungenatmung Gefährdung Filme Modelle 6 1, 3 6 1, 3 6 1, 3 Seite 12 von 18
13 11) die Lebensweise und den Körperbau von Fischen beschreiben 11) die Lebensweise und den Körperbau von Fischen beschreiben und erklären 11) die Lebensweise und den Körperbau von Fischen beschreiben, erklären und vergleichen Exemplarische Darstellung eines Vertreters Lernzirkel Stationsarbeit mit Binnendifferenzierung Untersuchung eines Fisches Film Modell von Kiemen 12) die Angepasstheit der Fische an das Leben im Wasser an einem konkreten Beispiel beschreiben. (Fortbewegung, Atmung und Befruchtung) 12) die Angepasstheit der Fische an das Leben im Wasser an einem konkreten Beispiel beschreiben. (Fortbewegung, Atmung und Befruchtung) 12) die Angepasstheit der Fische an das Leben im Wasser an einem konkreten Beispiel beschreiben. (Fortbewegung, Atmung und Befruchtung) Exemplarische Darstellung eines Vertreters: Lebensweise Anpassung an den Lebensraum 1, 9,8,10 1,2 1 1, 9,8,10 1,2 1 1, 9,8,10 1,2 1 13) die Fortpflanzung und Entwicklung bei Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren beschreiben. 13) die Fortpflanzung und Entwicklung bei Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren beschreiben und vergleichen. 13) die Fortpflanzung und Entwicklung bei Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren beschreiben und vergleichen. Vergleich der verschiedenen Wirbeltiergruppen 14) typische Merkmale der Wirbeltiergruppen nennen und Tierarten den fünf Wirbeltiergruppen zuordnen 14) typische Merkmale der Wirbeltiergruppen erläutern und und Tierarten begründet den fünf Wirbeltiergruppen zuordnen 14) typische Merkmale der Wirbeltiergruppen erläutern und und Tierarten begründet den fünf Wirbeltiergruppen zuordnen und vergleichen Vergleich der verschiedenen Wirbeltiergruppen Tierquiz: Schüler stellen gegenseitig Tiere vor und lassen zuordnen Domino Seite 13 von 18
14 Operatoren im Fach Bio / Physik / Chemie Quelle: Operator Beschreiben der erwarteten Leistung AFB ableiten auf der Grundlage von Erkenntnissen sachgerechte Schlüsse ziehen II abschätzen durch begründete Überlegungen Größenordnungen angeben II analysieren systematisches Untersuchen eines Sachverhaltes, bei dem Bestandteile, dessen Merkmale und ihre Beziehungen zueinander erfasst und dargestellt werden II anwenden einen bekannten Zusammenhang oder eine bekannte Methode auf einen anderen Sachverhalt beziehen II aufstellen von Hypothesen eine begründete Vermutung formulieren III auswerten Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang stellen, gegebenenfalls zu einer Gesamtaussage zusammenführen und Schlussfolgerungen ziehen III begründen Sachverhalte auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen III benennen Begriffe und Sachverhalte einer vorgegebene Struktur zuordnen I berechnen rechnerische Generierung eines Ergebnisses II beschreiben Sachverhalte wie Objekte und Prozesse nach Ordnungsprinzipien strukturiert unter Verwendung der Fachsprache wiedergeben II bestimmen rechnerische, grafische oder inhaltliche Generierung eines Ergebnisses I beurteilen, bewerten beweisen zu einem Sachverhalt eine selbstständige Einschätzung nach fachwissenschaftlichen und fachmethodischen Kriterien formulieren mit Hilfe von sachlichen Argumenten durch logisches Herleiten eine Behauptung/Aussage belegen bzw. widerlegen III III darstellen Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden, Ergebnisse etc. strukturiert wiedergeben I definieren die Bedeutung eines Begriffs unter Angabe eines Oberbegriffs und invarianter (wesentlicher, spezifischer) Merkmale bestimmen III Seite 14 von 18
15 Operator Beschreiben der erwarteten Leistung AFB diskutieren Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen III dokumentieren alle notwendigen Erklärungen, Herleitungen und Skizzen darstellen I entwerfen/planen (Experimente) erklären erläutern herleiten interpretieren/deuten zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranordnung finden und eine Experimentieranleitung erstellen Strukturen, Prozesse, Zusammenhänge, usw. des Sachverhaltes erfassen und auf allgemeine Aussagen/Gesetze zurückführen wesentliche Seiten eines Sachverhalts/Gegenstands/Vorgangs an Beispielen oder durch zusätzliche Informationen verständlich machen aus Größengleichungen durch mathematische Operationen eine physikalische Größe freistellen und dabei wesentliche Lösungsschritte kommentieren Sachverhalte, Zusammenhänge in Hinblick auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und abwägend herausstellen III II II II III klassifizieren,ordnen Begriffe, Gegenstände etc. auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen II nennen Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten, Fakten ohne Erläuterung wiedergeben I protokollieren skizzieren Ablauf, Beobachtungen und Ergebnisse sowie ggf. Auswertung (Ergebnisprotokoll, Verlaufsprotokoll) in fachtypischer Weise wiedergeben Sachverhalte, Objekte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert (vereinfacht) übersichtlich darstellen I I untersuchen Sachverhalte/Objekte erkunden, Merkmale und Zusammenhänge herausarbeiten II verallgemeinern aus einem erkannten Sachverhalt eine erweiterte Aussage formulieren II vergleichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sachverhalten, Objekten, Lebewesen und Vorgängen ermitteln II zeichnen eine exakte Darstellung beobachtbarer oder gegebener Strukturen anfertigen I zusammenfassen das Wesentliche in konzentrierter Form darstellen II Seite 15 von 18
16 Bewertungskriterien: Leistungsbeurteilung im Fach Biologie an den deutschen Auslandsschulen im südlichen Afrika Ein methodisch neuartiger, kompetenz- und handlungsorientierter Unterricht erfordert notwendigerweise auch ein neues Verständnis des Lernbegriffs und neue Formen der Leistungsbeurteilung. Hierzu zählen z. B. Beobachtungsbögen z. B. Schülerselbst-beobachtung, Präsentationsbeurteilungen (durch Lehrer und Schüler). Neben den herkömmlichen Leistungsbeurteilung (Klassenarbeiten, Kurzteste, Referate, mündliche Mitarbeit, Projekte), ist es daher erforderlich, auch folgende Aspekte zu berücksichtigen: Beurteilung von Arbeitsprozessen Zur Prozessbeurteilung gehören u. a.: - Beobachten von Arbeits-/Lernverhalten - Beobachten von Gruppenprozessen Beurteilungen von Präsentationen Hierzu gehören z. B. - Referate - Präsentationen - Schüler als Lehrender Beurteilung von Lern- und Arbeitsprodukten Exemplarisch lassen sich hier nennen: - schriftliche Dokumentation von Vorträgen - Erstellen von Postern /Modellen - Erstellen von Versuchsprotokollen Es bietet sich an, im Sinne einer transparenten Leistungsbeurteilung die Beurteilungskriterien in Absprache mit den Schülern zu entwickeln oder zumindest verständlich vorzustellen. Als Kriterium für die Güte einer Leistung sollte man einerseits die Offenheit und Flexibilität bei der Erstellung und Präsentation von Lernprodukten berücksichtigen, andererseits aber auch den kommunikativen Charakter sowie die Reflexivität des Schülers. Seite 16 von 18
17 Bewertungsmaßstäbe und Hinweise auf die Überprüfbarkeit von Lernergebnissen Die Bewertungsmaßstäbe für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 im Fach Biologie orientieren sich an den verschiedenen Kompetenzbereichen. Hierzu gehören die Methodenkompetenz, die Deutungs- und Analysekompetenz sowie die Urteils- und Orientierungskompetenz. Eine differenzierte Bewertung der Schülerleistungen wird durch die Entwicklung einheitlicher Maßstäbe zur Leistungsbeurteilung sowie transparenter Kriterien gewährleistet. Bewertet werden sowohl Arbeitsprozesse, beispielsweise durch das Beobachten von Lernverhalten und Gruppenprozessen, als auch schriftliche sowie mündliche Leistungen in Klassenarbeiten, Kurztesten, Referaten, mündlicher Mitarbeit sowie Projekten. Darüber hinaus wird der individuelle Lernprozess der Schülerinnen und Schüler bei der Leistungsbewertung berücksichtigt. Ein sicherer Umgang mit Fachsprache sowie die Erfüllung standardsprachlicher Normen und formaler Aspekte werden ebenfalls in die Leistungsbewertung miteinbezogen. Im Zusammenhang mit der Methodenkompetenz werden u.a. Teamfähigkeit, sachgerechtes Problembewusstsein, Methodensicherheit, Informationsbeschaffung und -verarbeitung, Selbstständigkeit sowie Ergebnispräsentation bewertet. Bei der Deutungs- und Analysekompetenz sind Differenzierung, Perspektivität, inhaltliche Adäquatheit sowie Vollständigkeit und Systematik von hoher Bedeutung. Die Schülerinnen und Schüler sollten darüber hinaus in der Lage sein, ein reflektiertes Urteil zu fällen. Hierbei spielen u.a. Begründetheit sowie Multiperspektivität bzw. Kontroversität in der Argumentation eine entscheidende Rolle. Die schriftliche Leistungsbewertung in der Unterstufe (Klassen 5 bis 9) erfolgt anhand von Klassenarbeiten. Zur Ermittlung der mündlichen Leistung werden vor allem die Qualität der Mitarbeit im Unterricht (auch bei Gruppen- und Projektarbeit), Referate sowie die Qualität der Hausaufgaben herangezogen (vgl. oben). In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 wird pro Schulhalbjahr mindestens eine Klassenarbeit geschrieben. Die schriftliche Note zählt 50% der Gesamtnote. Den folgenden Aspekten kommt bei der Bewertung von mündlichen und schriftlichen Leistungen ein besonderes Gewicht zu: - fachliche Korrektheit - Sicherheit im Umgang mit Fachsprache und Methoden des Faches - Folgerichtigkeit, Begründetheit und Verknüpftheit der Ausführungen - Grad der Problemhaftigkeit, Multiperspektivität bzw. Kontroversität in der Argumentation - Umfang der Selbstständigkeit - konzeptionelle Klarheit - Erfüllung standardsprachlicher Normen und formaler Aspekte Bei den vorgeschlagenen Zeitangaben für die entsprechenden Themen kann es sich auf Grund der unterschiedlichen Stundentafeln nur um ungefähre Richtwerte handeln. Seite 17 von 18
18 Binnendifferenzierung Nicht nur die beiden coexistierenden Schulabschlüsse, das NSSC und die DIAP, machen einen sehr differenzierten Unterricht nötig, auch die hohe Anzahl unterschiedlicher Muttersprachen und Ethnien an unserer Schule. In keiner Jahrgangsstufe, in keiner Klasse und in kaum einem Kurs der DHPS kann man gleiche Bedingungen der Schülerinnen und Schüler voraussetzen, sodass eine Binnendifferenzierung als das Minimum angesehen werden kann, das es zu leisten gilt, um unseren Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Die Biologie stellt diesbezogen natürlich keine Ausnahme dar. Auch das sprachliche Niveau der Amtssprache Englisch bietet ein riesiges Spektrum, sodass die Lernvoraussetzungen hinreichend heterogen unter den Schülerinnen und Schülern unserer Schule sind. All diese Fakten führen dazu, dass die Pädagoginnen und Pädagogen der DHPS ein großes Repertoire an binnendifferenzierten Methoden zur Hand haben müssen, um die täglichen Herausforderungen annehmen zu können. Folgende Tabelle aus der Richtlinie der DIAP kann als Bewertungsraster verwendet werden % 94-90% 89-85% 84-80% 79-75% 74-70% 69-65% 64-60% 59-55% 54-50% 49-45% 44-40% 39-34% 33-27% 26-20% 19-0% Seite 18 von 18
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen
 Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Fachwissen. Kommunikation. Bewertung. Kompetenzbereich. Erkenntnisgewinnung. Zusatzmodul in der regionalen Fortbildung
 Fachwissen Kommunikation Erkenntnisgewinnung Bewertung Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Zusatzmodul in der regionalen Fortbildung Erkenntnisgewinnung in den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb in den
Fachwissen Kommunikation Erkenntnisgewinnung Bewertung Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Zusatzmodul in der regionalen Fortbildung Erkenntnisgewinnung in den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb in den
EF Q1 Q2 Seite 1
 Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10
 Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10 Kompetenzen werden an Inhalten erworben. Für den Mittleren Schulabschluss werden die Inhalte im Fach Biologie in den folgenden drei Basiskonzepten
Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10 Kompetenzen werden an Inhalten erworben. Für den Mittleren Schulabschluss werden die Inhalte im Fach Biologie in den folgenden drei Basiskonzepten
Schuleigenes Curriculum für die Jahrgangsstufe 5 an der Holzkamp-Gesamtschule Witten. Angepasst an das Lehrbuch: Biologie heute aktuell
 Angepasst an das Lehrbuch: Biologie heute aktuell Kompetenzentwicklung und Basiskonzepte Der Kernlehrplan gliedert die geforderten Kompetenzen in vier Bereiche: Umgang mit Fachwissen (UF 1 4), Erkenntnisgewinnung
Angepasst an das Lehrbuch: Biologie heute aktuell Kompetenzentwicklung und Basiskonzepte Der Kernlehrplan gliedert die geforderten Kompetenzen in vier Bereiche: Umgang mit Fachwissen (UF 1 4), Erkenntnisgewinnung
Schulinterner Lehrplan Sek I Biologie
 Jgst. 5.1 Zeit Inhaltsfeld/ Schlüsselbegriff 10 Bau und Leistungen des menschlichen Körpers Ernährung und Verdauung: Nahrungsmittel und Nährstoffe, Verdauungssystem Kontext/ Konzeptbezogene Kompetenzen,
Jgst. 5.1 Zeit Inhaltsfeld/ Schlüsselbegriff 10 Bau und Leistungen des menschlichen Körpers Ernährung und Verdauung: Nahrungsmittel und Nährstoffe, Verdauungssystem Kontext/ Konzeptbezogene Kompetenzen,
2. Klassenarbeiten Im Fach Biologie werden in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben.
 1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
Kernlehrplan Biologie SCHULCURRICULUM Ernst-Barlach-Gymnasium
 Jahrgangsstufe 5.1.1 Inhaltsfeld: Bau und Leistungen des menschlichen Körpers Fachlicher Kontext: Gesundheitsbewusstes Leben Konzeptbezogene Prozessbezogene Bewegungssystem Atmung und Blutkreislauf 1.
Jahrgangsstufe 5.1.1 Inhaltsfeld: Bau und Leistungen des menschlichen Körpers Fachlicher Kontext: Gesundheitsbewusstes Leben Konzeptbezogene Prozessbezogene Bewegungssystem Atmung und Blutkreislauf 1.
Biologieunterricht in Baden-Württemberg. standardbasiert und kompetenzorientiert
 Biologieunterricht in Baden-Württemberg standardbasiert und kompetenzorientiert Worum geht es Kompetenz- und Standardbegriff Allgemeines und fachliches Kompetenzkomponentenmodell Standardbasierung - vom
Biologieunterricht in Baden-Württemberg standardbasiert und kompetenzorientiert Worum geht es Kompetenz- und Standardbegriff Allgemeines und fachliches Kompetenzkomponentenmodell Standardbasierung - vom
Interne Ergänzungen Kompetenzen
 Inhaltsfelder Die Zelle als Grundbaustein von Organismen Jahrgang: Klasse 5 Fach: Biologie Stand: 23.11.2015 Konzeptbezogene Prozessbezogene Interne Ergänzungen Kompetenzen Kompetenzen Die SuS Die SuS
Inhaltsfelder Die Zelle als Grundbaustein von Organismen Jahrgang: Klasse 5 Fach: Biologie Stand: 23.11.2015 Konzeptbezogene Prozessbezogene Interne Ergänzungen Kompetenzen Kompetenzen Die SuS Die SuS
Grundbegriffe der Ökologie Ökologie, Art, Population, Biozönose, Ökosystem, Biotop; biotische und abiotische Faktoren am Beispiel des Ökosystemes Wald
 Jahrgang: Klasse 8 Fach: Biologie Inhaltsfelder Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Interne rgänzungen Grundbegriffe der Ökologie Ökologie, Art, Population, Biozönose, Ökosystem, Biotop;
Jahrgang: Klasse 8 Fach: Biologie Inhaltsfelder Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Interne rgänzungen Grundbegriffe der Ökologie Ökologie, Art, Population, Biozönose, Ökosystem, Biotop;
Schulinterner Arbeitsplan für den Doppeljahrgang 7./8. im Fach Biologie Verwendetes Lehrwerk: BIOSKOP 7/8
 Thema Inhaltskompetenzen Prozesskompetenzen Bezug zum Methodencurriculum (in Zukunft) Vorschlag Stunden - zahl Lebewesen bestehen aus Zellen 6 Die Schülerinnen und Schüler Das Mikroskop Pflanzen- und Tierzellen
Thema Inhaltskompetenzen Prozesskompetenzen Bezug zum Methodencurriculum (in Zukunft) Vorschlag Stunden - zahl Lebewesen bestehen aus Zellen 6 Die Schülerinnen und Schüler Das Mikroskop Pflanzen- und Tierzellen
Bildungsplan 2016 BNT
 Bildungsplan 2016 BNT Vom Bildungsplan zum Stoffplan Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Leitperspektiven Verweise auf weitere Fächer Struktur des Fachplans BNT Leitgedanken Prozessbezogene
Bildungsplan 2016 BNT Vom Bildungsplan zum Stoffplan Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Leitperspektiven Verweise auf weitere Fächer Struktur des Fachplans BNT Leitgedanken Prozessbezogene
Kernlehrplan Biologie SCHULCURRICULUM Ernst-Barlach-Gymnasium
 Jahrgangsstufe 6.1.1 Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen Prozessbezogene Kompetenzen Bauplan der Blütenpflanzen Fortpflanzung, Entwicklung
Jahrgangsstufe 6.1.1 Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen Prozessbezogene Kompetenzen Bauplan der Blütenpflanzen Fortpflanzung, Entwicklung
Kern- und Schulcurriculum Biologie Klasse 5/6. Stand Schuljahr 2009/10
 Kern- und Schulcurriculum Biologie Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Das integrierte Schulcurriculum ist auf den folgenden Seiten grün hervorgehoben. Klasse 6: Grundlegende biologische Prinzipien: Angepasstheit,
Kern- und Schulcurriculum Biologie Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Das integrierte Schulcurriculum ist auf den folgenden Seiten grün hervorgehoben. Klasse 6: Grundlegende biologische Prinzipien: Angepasstheit,
Wesentliche prozessbezogene Kompetenzen Erkenntnisgewinnung (EG), Kommunikation (KK), Bewertung (BW), den Aufgaben ( 1, 2 ) zugeordnet
 Einführung 1. Allgemeines (Begriffsbestimmung, Mappenführung) Anschauungsmaterial, Buch 2.Arbeitsmethoden in der Biologie 1 Kennzeichen des Lebens Kennzeichen des Lebens (S. 14/15) Die Kennzeichen von
Einführung 1. Allgemeines (Begriffsbestimmung, Mappenführung) Anschauungsmaterial, Buch 2.Arbeitsmethoden in der Biologie 1 Kennzeichen des Lebens Kennzeichen des Lebens (S. 14/15) Die Kennzeichen von
Stdn. Themenbereich 2: Vom Wolf zum Dackel Verbindliche Inhalte Basiskonzepte Kompetenzen Lehrbuch-
 Fortschreibung von 2008/09 Themenbereich 1: Biologie ein neues Fach Verbindliche Inhalte Basiskonzepte Kompetenzen a) vorwiegend prozessbezogene K. b) inhaltsbezogene K. Lehrbuch- Zeitplan Kompartimentierung,
Fortschreibung von 2008/09 Themenbereich 1: Biologie ein neues Fach Verbindliche Inhalte Basiskonzepte Kompetenzen a) vorwiegend prozessbezogene K. b) inhaltsbezogene K. Lehrbuch- Zeitplan Kompartimentierung,
4 Kompetenzen und Inhalte (Leistungskurs)
 4 (Leistungskurs) 4.1 Physiologische Grundlagen ausgewählter Lebensprozesse am Beispiel der Nervenzelle - Aufbau lebender Organismen aus Zellen - Vorgänge an Biomembranen - Enzyme und ihre Bedeutung -
4 (Leistungskurs) 4.1 Physiologische Grundlagen ausgewählter Lebensprozesse am Beispiel der Nervenzelle - Aufbau lebender Organismen aus Zellen - Vorgänge an Biomembranen - Enzyme und ihre Bedeutung -
Konzeptbezogene Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler... Basiskonzept. Basiskonzept Basiskonzept Struktur und Funktion Entwicklung
 Schulinternes Curriculum des Landrat-Lucas-Gymnasiums im Fach Biologie Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Jahrgangsstufen 5 und 6 Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tier in verschiedenen Lebensräumen Prozessbezogene
Schulinternes Curriculum des Landrat-Lucas-Gymnasiums im Fach Biologie Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Jahrgangsstufen 5 und 6 Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tier in verschiedenen Lebensräumen Prozessbezogene
Ökologie Grundkurs. Unterrichtsvorhaben IV:
 Ökologie Grundkurs Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Autökologische Untersuchungen Welchen Einfluss haben abiotische Faktoren auf das Vorkommen von Arten? Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: E1
Ökologie Grundkurs Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Autökologische Untersuchungen Welchen Einfluss haben abiotische Faktoren auf das Vorkommen von Arten? Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: E1
Schülerinnen und Schüler. nennen die Kennzeichen des Lebendigen (UF1)
 Jahrgang Fach: Biologie.1 1. Was ist Biologie? Kennzeichen des Lebendigen (S.6-10) 2. Verantwortung für Haus- und Nutztiere (S.18-28) 3. Haustiere (z.b. Katze, Hund) (S. 22-33) Körperbau Sinnesleistung
Jahrgang Fach: Biologie.1 1. Was ist Biologie? Kennzeichen des Lebendigen (S.6-10) 2. Verantwortung für Haus- und Nutztiere (S.18-28) 3. Haustiere (z.b. Katze, Hund) (S. 22-33) Körperbau Sinnesleistung
Das Wichtigste auf einen Blick... 66
 Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Jahrgang 7 und 8 HS, RS und Gy
 Jahrgang 7 und 8 HS, RS und Gy Teildisziplin des Faches Kompetenzen Gy Kompetenzen HS und RS (RS zusätzlich in Rot) Zelle und Systemebene Mikroskopieren von Tier- und Pflanzenzellen FW 1.1 erläutern den
Jahrgang 7 und 8 HS, RS und Gy Teildisziplin des Faches Kompetenzen Gy Kompetenzen HS und RS (RS zusätzlich in Rot) Zelle und Systemebene Mikroskopieren von Tier- und Pflanzenzellen FW 1.1 erläutern den
Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn
 Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn 1 für die Sekundarstufe I Klassenstufe 5 Optional: Hund oder Katze; Rind oder 10 F 1.4, F2.4, Pferd F2.6, F3.2 -Tierhaltung und Tierpflege
Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn 1 für die Sekundarstufe I Klassenstufe 5 Optional: Hund oder Katze; Rind oder 10 F 1.4, F2.4, Pferd F2.6, F3.2 -Tierhaltung und Tierpflege
Hausaufgabenkonzept Biologie MGB
 Entwurf: Mai 2011 Kapitel 1 BIOLOGIE Sek I - Grundsätze zur Leistungsbewertung und Hausaufgaben A: Biologie ist ein mündliches Fach in der Sekundarstufe I. B: Neben der mündlichen Beteiligung sind als
Entwurf: Mai 2011 Kapitel 1 BIOLOGIE Sek I - Grundsätze zur Leistungsbewertung und Hausaufgaben A: Biologie ist ein mündliches Fach in der Sekundarstufe I. B: Neben der mündlichen Beteiligung sind als
Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 5-6
 ASG Schulcurriculum Biologie Jg. 5/6-1 - Stand: Feb 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 5-6 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94)
ASG Schulcurriculum Biologie Jg. 5/6-1 - Stand: Feb 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 5-6 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94)
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14
 Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Schulinterner Stoffverteilungsplan für den Unterricht im Fach Biologie in den Jahrgängen 5 10 am TGG
 Schulinterner Stoffverteilungsplan für den Unterricht im Fach Biologie in den Jahrgängen 5 10 am TGG von der Fachkonferenz beschlossen am 12. Januar 2006 Vorwort Die genannten Inhalte, Basiskonzepte und
Schulinterner Stoffverteilungsplan für den Unterricht im Fach Biologie in den Jahrgängen 5 10 am TGG von der Fachkonferenz beschlossen am 12. Januar 2006 Vorwort Die genannten Inhalte, Basiskonzepte und
Prototypische Beispiele für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen.
 OStR. Mag. Werner Gaggl Prototypische Beispiele für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen. Aufgabenstellungen 1 Am Montag, 22.11.2010 von 9:00 bis 17:00 Uhr fand ein ganztägiger Workshop zur Neuen Reifeprüfung
OStR. Mag. Werner Gaggl Prototypische Beispiele für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen. Aufgabenstellungen 1 Am Montag, 22.11.2010 von 9:00 bis 17:00 Uhr fand ein ganztägiger Workshop zur Neuen Reifeprüfung
Laurentius-Siemer-Gymnasium Ramsloh Schuleigener Arbeitsplan für das Fach Biologie (gültig ab dem Schuljahr 2007/08)
 Jahrgangsstufe: 7/8 Lehrwerke / Hilfsmittel: Bioskop 7/8, Westermann, ISBN 978-3-14-150501-6 Inhalte / Themen: Kompetenzen: Die Reihenfolge ist nicht verbindlich, Seitenangaben in Kompetenzen gemäß Kerncurriculum
Jahrgangsstufe: 7/8 Lehrwerke / Hilfsmittel: Bioskop 7/8, Westermann, ISBN 978-3-14-150501-6 Inhalte / Themen: Kompetenzen: Die Reihenfolge ist nicht verbindlich, Seitenangaben in Kompetenzen gemäß Kerncurriculum
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Schulcurriculum Fachbereich Biologie Jg. 7/8
 1. Unterrichtseinheit: Lebewesen bestehen aus Zellen Themen Wovon ernähren sich Pflanzen? Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung bei der Fotosynthese Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät
1. Unterrichtseinheit: Lebewesen bestehen aus Zellen Themen Wovon ernähren sich Pflanzen? Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung bei der Fotosynthese Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät
Inhalt. So arbeitest du mit dem Biobuch 10. Was ist Biologie? 12. Biologie eine Naturwissenschaft 14
 Inhalt So arbeitest du mit dem Biobuch 10 Was ist Biologie? 12 Biologie eine Naturwissenschaft 14 Kennzeichen des Lebens 16 Pflanzen sind Lebewesen 18 MMP: Lebendig oder nicht? 19 Zusammenfassung 20 Teste
Inhalt So arbeitest du mit dem Biobuch 10 Was ist Biologie? 12 Biologie eine Naturwissenschaft 14 Kennzeichen des Lebens 16 Pflanzen sind Lebewesen 18 MMP: Lebendig oder nicht? 19 Zusammenfassung 20 Teste
CURRICULUM AUS NATURWISSENSCHAFTEN Physik und Chemie 1. Biennium FOWI
 Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der soll den SchülerInnen eine aktive Auseinandersetzung mit physikalischen und chemischen Phänomenen ermöglichen. In aktuellen und gesellschaftsrelevanten
Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der soll den SchülerInnen eine aktive Auseinandersetzung mit physikalischen und chemischen Phänomenen ermöglichen. In aktuellen und gesellschaftsrelevanten
Schulinternes Curriculum Biologie Klasse 7
 Schulinternes Curriculum Biologie Klasse 7 Die drei für den Biologieunterricht der Sekundarstufe I bedeutsamen Basiskonzepte Struktur und Funktion (SF), System (S) und Entwicklung (E) sind grundlegende,
Schulinternes Curriculum Biologie Klasse 7 Die drei für den Biologieunterricht der Sekundarstufe I bedeutsamen Basiskonzepte Struktur und Funktion (SF), System (S) und Entwicklung (E) sind grundlegende,
und folgenden Unterricht Kooperation Vorunterrichtliche Erfahrungen,
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Chemie in der Jahrgangsstufe 6 (Klassenunterricht) Holzkamp-Gesamtschule, Witten (aktualisiert 2/2013) Unterrichtseinheit / Thema: Stoffe im Alltag, Stoffe können gefährlich
Schulinterner Lehrplan für das Fach Chemie in der Jahrgangsstufe 6 (Klassenunterricht) Holzkamp-Gesamtschule, Witten (aktualisiert 2/2013) Unterrichtseinheit / Thema: Stoffe im Alltag, Stoffe können gefährlich
Schuleigener Lehrplan Biologie (Grundlage: KLP 2008) Klasse 5. Vielfalt von Lebewesen. Stand: Zeit Std ca. 14
 ca. 14 Vielfalt von Lebewesen Lebensräume, Artenkenntnis, Bauplan von Blütenpflanzen und Insekten, Unterscheidung zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen, Fortbewegung, Nahrungsbeziehung en Was lebt in meiner
ca. 14 Vielfalt von Lebewesen Lebensräume, Artenkenntnis, Bauplan von Blütenpflanzen und Insekten, Unterscheidung zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen, Fortbewegung, Nahrungsbeziehung en Was lebt in meiner
EG 1.4 zeichnen lichtmikroskopische. Präparate )
 Zellen, Fotosynthese und Zellatmung: 1. Lebewesen bestehen aus Zellen; 1.1 Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät FW 2.2 beschreiben Zellen als Grundeinheiten; beschreiben einzelne Zellbestandteile
Zellen, Fotosynthese und Zellatmung: 1. Lebewesen bestehen aus Zellen; 1.1 Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät FW 2.2 beschreiben Zellen als Grundeinheiten; beschreiben einzelne Zellbestandteile
Inhaltsverzeichnis. Haustiere und Nutztiere
 Inhaltsverzeichnis M Aufgaben richtig verstehen 8 M Biologische Prinzipien 10 1 Kennzeichen von Lebewesen 1.1 Biologie ein neues Unterrichtsfach 12 M Mein Biologieheft führen 13 1.2 Lebewesen haben typische
Inhaltsverzeichnis M Aufgaben richtig verstehen 8 M Biologische Prinzipien 10 1 Kennzeichen von Lebewesen 1.1 Biologie ein neues Unterrichtsfach 12 M Mein Biologieheft führen 13 1.2 Lebewesen haben typische
Inhalte Klasse 9 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen
 Inhalte Klasse 9 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 1. Nervensystem des Menschen 1.1 Wie arbeitet das Nervensystem? 1.2 Bau und Funktion der Nervenzellen 1.3 Gehirn und Rückenmark
Inhalte Klasse 9 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 1. Nervensystem des Menschen 1.1 Wie arbeitet das Nervensystem? 1.2 Bau und Funktion der Nervenzellen 1.3 Gehirn und Rückenmark
Information über die Anforderungen an die Heftführung. Filmanalyse zur Körpersprache des Hundes (DVD)
 Jahrgangsstufe 5.1 Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen, Subkontext: Was lebt in meiner Nachbarschaft? [5.1: erstes Thema] Inhaltliche
Jahrgangsstufe 5.1 Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen Fachlicher Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen, Subkontext: Was lebt in meiner Nachbarschaft? [5.1: erstes Thema] Inhaltliche
Kompetenzerwartungen im Fach Biologie in der Sekundarstufe I
 Nelly-Sachs Gymnasium Schulinternes Curriculum Biologie Stand: Oktober 2010 Grundlage: http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-si/gymnasium-g8/biologie-g8/kernlehrplan-biologie/
Nelly-Sachs Gymnasium Schulinternes Curriculum Biologie Stand: Oktober 2010 Grundlage: http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-si/gymnasium-g8/biologie-g8/kernlehrplan-biologie/
Jahrgangsstufe 6 Inhaltsfeld: Sexualerziehung (Hier gelten die Richtlinien der Sexualerziehung)
 Jahrgangsstufe 6 Inhaltsfeld: Sexualerziehung (Hier gelten die Richtlinien der Sexualerziehung) Entwicklung und Fortpflanzung des Menschen - Veränderungen in der Pubertät - Bau und Funktion der Geschlechtsorgane
Jahrgangsstufe 6 Inhaltsfeld: Sexualerziehung (Hier gelten die Richtlinien der Sexualerziehung) Entwicklung und Fortpflanzung des Menschen - Veränderungen in der Pubertät - Bau und Funktion der Geschlechtsorgane
FACH: BIOLOGIE JAHRGANG: 11
 ca. 6 Wochen Folge der Einheiten Dauer der Einheit (ca.) 1 Thema: Zellen Tier-/Pflanzenzelle Biomembran Zelldifferenzierung Prokaryot/Eukaryot Diffusion/Osmose vergleichen komplexe Vorgänge auf zellulärer
ca. 6 Wochen Folge der Einheiten Dauer der Einheit (ca.) 1 Thema: Zellen Tier-/Pflanzenzelle Biomembran Zelldifferenzierung Prokaryot/Eukaryot Diffusion/Osmose vergleichen komplexe Vorgänge auf zellulärer
KLASSE: 5 (1. HALBJAHR)
 Heinrich Böll Gymnasiuum Troisdorf Sieglar Fachschaft Biologie Interne Lehrpläne Biologie, Sek. I KLASSE: 5 (1. HALBJAHR) 1. Inhaltsfeld: Bau und Leistungen des menschlichen Körpers 2. Fachliche Kontexte:
Heinrich Böll Gymnasiuum Troisdorf Sieglar Fachschaft Biologie Interne Lehrpläne Biologie, Sek. I KLASSE: 5 (1. HALBJAHR) 1. Inhaltsfeld: Bau und Leistungen des menschlichen Körpers 2. Fachliche Kontexte:
Inhaltsfelder Luft und Wasser (Nr. 1) Inhaltsfeld Brücken (Nr. 2) Atmosphäre der Erde Luft und Wetter Wetterelemente Der Kreislauf des Wassers
 Inhaltsfelder Luft und Wasser (Nr. 1) Atmosphäre der Erde Luft und Wetter Wetterelemente Der Kreislauf des Wassers Wolkenentstehung, Wolkentypen Wetterbeobachtung Wettervorhersage Wetterphänomene Treibhauseffekt/
Inhaltsfelder Luft und Wasser (Nr. 1) Atmosphäre der Erde Luft und Wetter Wetterelemente Der Kreislauf des Wassers Wolkenentstehung, Wolkentypen Wetterbeobachtung Wettervorhersage Wetterphänomene Treibhauseffekt/
THEMENFELD 4: PFLANZEN, TIERE, LEBENSRÄUME. Folie 1
 Fortbildung des PL Rheinland-Pfalz, Beraterinnen und Berater für Unterrichtsentwicklung Naturwissenschaften (FAMONA) 2011 Folie 1 Klasse 5: Von den Sinnen zum Messen Vom ganz Kleinen und ganz Großen Bewegung
Fortbildung des PL Rheinland-Pfalz, Beraterinnen und Berater für Unterrichtsentwicklung Naturwissenschaften (FAMONA) 2011 Folie 1 Klasse 5: Von den Sinnen zum Messen Vom ganz Kleinen und ganz Großen Bewegung
beschreiben Aufbau und Funktion des menschlichen Skeletts und vergleichen es mit dem eines anderen Wirbeltiers
 1a Bewegung Teamarbeit für den ganzen Körper Pulsmessung und Beobachtung der Atmung Atmung: Bau der Lunge Nachweis des ausgeatmeten CO 2 Blutkreislauf: Herz doppelter Blutkreislauf Bestandteile des Blutes
1a Bewegung Teamarbeit für den ganzen Körper Pulsmessung und Beobachtung der Atmung Atmung: Bau der Lunge Nachweis des ausgeatmeten CO 2 Blutkreislauf: Herz doppelter Blutkreislauf Bestandteile des Blutes
Leistungsanforderung/kriterien Inhaltliche Ausführung Anmerkungen
 Transparente Leistungserwartung Physik Klasse 6-9 Beurteilungskriterien sollten den Lernenden vorgestellt werden. Den Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass sie kontinuierlich beurteilt werden.
Transparente Leistungserwartung Physik Klasse 6-9 Beurteilungskriterien sollten den Lernenden vorgestellt werden. Den Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass sie kontinuierlich beurteilt werden.
Modelle. Modelle im Biologieunterricht
 Modelle Modelle im Biologieunterricht Bildungsplan 2004 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Modelle zur Erklärung von Sachverhalten entwickeln, anwenden, deren Gültigkeitsbereiche prüfen; Modelle im Biologieunterricht
Modelle Modelle im Biologieunterricht Bildungsplan 2004 Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Modelle zur Erklärung von Sachverhalten entwickeln, anwenden, deren Gültigkeitsbereiche prüfen; Modelle im Biologieunterricht
Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 5-6
 ASG Schulcurriculum Biologie Jg. 5/6-1 - Stand: Aug 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 5-6 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94)
ASG Schulcurriculum Biologie Jg. 5/6-1 - Stand: Aug 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 5-6 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94)
Kompetenzen im Fach Biologie
 Fachgruppe Biologie Stand 2012/2013 Kompetenzen im Fach Biologie Kompetenzbereiche des Faches Biologie Fachwissen Lebewesen, biologische Phänomene, Begriffe, Prinzipien, Fakten kennen und den Basiskonzepten
Fachgruppe Biologie Stand 2012/2013 Kompetenzen im Fach Biologie Kompetenzbereiche des Faches Biologie Fachwissen Lebewesen, biologische Phänomene, Begriffe, Prinzipien, Fakten kennen und den Basiskonzepten
Abitur in Biologie Operatoren
 werden, Schwerpunkt sind Aufgaben aus dem Anforderungsbereich II, aber es kommen auch Fragen aus den beiden anderen Bereichen vor. Sollen Sie in der Vorbereitungszeit zur mündlichen Prüfung ein Experiment
werden, Schwerpunkt sind Aufgaben aus dem Anforderungsbereich II, aber es kommen auch Fragen aus den beiden anderen Bereichen vor. Sollen Sie in der Vorbereitungszeit zur mündlichen Prüfung ein Experiment
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte. Wahrnehmungskompetenz für Kontinuität und Veränderung in der Zeit
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in den Kurshalbjahren
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in den Kurshalbjahren
Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 7-8
 ASG Schulcurriculum für Jg 7/8-1- Stand: Aug 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 7-8 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94) sind sowohl
ASG Schulcurriculum für Jg 7/8-1- Stand: Aug 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 7-8 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94) sind sowohl
Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert?
 Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? Inhaltsfeld: IF 1: Biologie der Zelle Inhaltliche Schwerpunkte: Zellaufbau Stofftransport zwischen
Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? Inhaltsfeld: IF 1: Biologie der Zelle Inhaltliche Schwerpunkte: Zellaufbau Stofftransport zwischen
Inhaltsfelder Schwerpunkt im Kompetenzbereich Anregungen zur unterrichtlichen Umsetzung Biologische Strukturen und ihre Funktion
 Fachschaft Biologie Fachcurriculum Biologie, G8 Unterrichtseinheiten der Jahrgangsstufe 5 und 6 wie G9 Unterrichtseinheiten der Jahrgangsstufe 7 (2 Std. pro Schuljahr) Unterrichtseinheit 1: Zelle und Gewebe
Fachschaft Biologie Fachcurriculum Biologie, G8 Unterrichtseinheiten der Jahrgangsstufe 5 und 6 wie G9 Unterrichtseinheiten der Jahrgangsstufe 7 (2 Std. pro Schuljahr) Unterrichtseinheit 1: Zelle und Gewebe
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft. Analysekompetenz (A)
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Politik und Wirtschaft Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, Bildungsstandards und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der
1 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q2 Evolution
 1 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q2 Evolution 1 Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen Evolution Evolutionstheorien LK Evolutionstheorie Biodiversität und Systematik Entwicklung
1 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q2 Evolution 1 Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen Evolution Evolutionstheorien LK Evolutionstheorie Biodiversität und Systematik Entwicklung
11/2 Alles im Gleichgewicht Zuordnung der Kompetenzen aus dem KC Sek II
 Fachgruppe Chemie Kurshalbjahr 11/2 Alles im Gleichgewicht Stand SJ 2010/2011 11/2 Alles im Gleichgewicht Zuordnung der Kompetenzen aus dem KC Sek II Basiskonzept Stoff-Teilchen / unterscheiden anorganische
Fachgruppe Chemie Kurshalbjahr 11/2 Alles im Gleichgewicht Stand SJ 2010/2011 11/2 Alles im Gleichgewicht Zuordnung der Kompetenzen aus dem KC Sek II Basiskonzept Stoff-Teilchen / unterscheiden anorganische
Interne Ergänzungen Kompetenzen
 Inhaltsfelder Bau und Leistungen des A) Bewegungssystem (Knochen, Skelett, Wirbelsäule, Gelenke, Muskulatur) Bedeutung der Wirbelsäule Bewegung Teamarbeit für den ganzen Körper (Körperhaltung) Jahrgang:
Inhaltsfelder Bau und Leistungen des A) Bewegungssystem (Knochen, Skelett, Wirbelsäule, Gelenke, Muskulatur) Bedeutung der Wirbelsäule Bewegung Teamarbeit für den ganzen Körper (Körperhaltung) Jahrgang:
Zygote, (Morula), (Blastula), Einnistung, Plazenta, Mutterkuchen
 5a Das Leben beginnt vor der Geburt Erste Schritte von der befruchteten Eizelle zur Einnistung Schwangerschaft Veränderungen für Mutter und Kind Vorsorgeuntersuchungen ärztliche Begleitung der Schwangerschaft
5a Das Leben beginnt vor der Geburt Erste Schritte von der befruchteten Eizelle zur Einnistung Schwangerschaft Veränderungen für Mutter und Kind Vorsorgeuntersuchungen ärztliche Begleitung der Schwangerschaft
Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften. Chemie Marcus Mössner
 Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittleren Bildungsabschluss (Beschluss vom 16.12.2004) Die Chemie untersucht und beschreibt die stoffliche
Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittleren Bildungsabschluss (Beschluss vom 16.12.2004) Die Chemie untersucht und beschreibt die stoffliche
Hausinternes Curriculum Biologie: Inhalte, Methoden
 Hausinternes Curriculum Biologie: Inhalte, Methoden (Stand: August 2015) E1 Cytologie Cytologie unter dem Aspekt der funktionellen Morphologie unter besonderer Berücksichtigung des licht- und elektronenmikroskopischen
Hausinternes Curriculum Biologie: Inhalte, Methoden (Stand: August 2015) E1 Cytologie Cytologie unter dem Aspekt der funktionellen Morphologie unter besonderer Berücksichtigung des licht- und elektronenmikroskopischen
Schulinternes Curriculum für die Einführungsphase
 Schulinternes Curriculum für die Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? UF1 Wiedergabe UF2 Auswahl K1
Schulinternes Curriculum für die Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? UF1 Wiedergabe UF2 Auswahl K1
Inhaltsverzeichnis. Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16
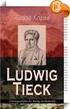 Inhaltsverzeichnis Was sind Naturwissenschaften?... 8 Rundgang durch den Nawi-Raum... 10 Kennzeichen des Lebendigen................................. 12 Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16 Die Pflanzenzelle...
Inhaltsverzeichnis Was sind Naturwissenschaften?... 8 Rundgang durch den Nawi-Raum... 10 Kennzeichen des Lebendigen................................. 12 Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16 Die Pflanzenzelle...
System Ökosystem, Biozönose, Population, Organismus, Symbiose, Parasitismus, Konkurrenz, Kompartiment, Photosynthese, Kohlenstoffkreislauf
 Grundkurs Q 1: Inhaltsfeld: IF 5 (Ökologie) Unterrichtsvorhaben IV: Welchen Einfluss haben abiotische Faktoren auf das Vorkommen von Arten? Unterrichtsvorhaben V: Welchen Einfluss haben biotische Faktoren
Grundkurs Q 1: Inhaltsfeld: IF 5 (Ökologie) Unterrichtsvorhaben IV: Welchen Einfluss haben abiotische Faktoren auf das Vorkommen von Arten? Unterrichtsvorhaben V: Welchen Einfluss haben biotische Faktoren
Kern- und Schulcurriculum für das Fach Biologie Klassenstufe 5/6
 Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Im Eichbäumle 1 76139 Karlsruhe Kern- und Schulcurriculum für das Fach Biologie Klassenstufe 5/6 Stundenbedarf 10 (6+4) S/F A, V R I/K typische Merkmale der Insekten und die
Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Im Eichbäumle 1 76139 Karlsruhe Kern- und Schulcurriculum für das Fach Biologie Klassenstufe 5/6 Stundenbedarf 10 (6+4) S/F A, V R I/K typische Merkmale der Insekten und die
Operatoren im Geschichtsunterricht
 Operatoren im Geschichtsunterricht Die Anforderungsbereiche und zugehörigen Operatoren im Fach Geschichte gelten für alle Schularten (Mittelschule, Gymnasium, BBS). Grundlage bilden die folgenden Beschlüsse
Operatoren im Geschichtsunterricht Die Anforderungsbereiche und zugehörigen Operatoren im Fach Geschichte gelten für alle Schularten (Mittelschule, Gymnasium, BBS). Grundlage bilden die folgenden Beschlüsse
Methodik. Mein Lieblingstier Lern- und Arbeitstechniken an Methodentagen Wochenplan Teamarbeit Mind-Mapping
 Methodencurriculum der GSR Kl. Arbeitsweise in NWA projektorientiertes Thema Lern- und Arbeitstechnik im Methodentraining Markieren Bericht schreiben Nachschlagen Heft gestalten Ordner Methodik 5 Sammeln
Methodencurriculum der GSR Kl. Arbeitsweise in NWA projektorientiertes Thema Lern- und Arbeitstechnik im Methodentraining Markieren Bericht schreiben Nachschlagen Heft gestalten Ordner Methodik 5 Sammeln
Grundsätze der Leistungsbewertung. im Fach Physik
 Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Physik 1. Rechtliche Grundlagen Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Physik hat die Fachkonferenz Physik des Max-Planck-Gymnasiums
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Physik 1. Rechtliche Grundlagen Auf der Grundlage von 48 SchulG, 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Physik hat die Fachkonferenz Physik des Max-Planck-Gymnasiums
Das Thema Landwirtschaft und dessen Umsetzung im Lehrwerk Biologie Heute 1, Hessen
 1 Rezension: Biologie Heute I, Hessen, September 2016 Das Thema Landwirtschaft und dessen Umsetzung im Lehrwerk Biologie Heute 1, Hessen Das Schulbuch Biologie Heute I ist erstmalig 2014 beim Schroedel
1 Rezension: Biologie Heute I, Hessen, September 2016 Das Thema Landwirtschaft und dessen Umsetzung im Lehrwerk Biologie Heute 1, Hessen Das Schulbuch Biologie Heute I ist erstmalig 2014 beim Schroedel
Der Wahlpflichtbereich
 Lernbereich Naturwissenschaften Der Wahlpflichtbereich Der naturwissenschaftliche Unterricht im Wahlpflichtbereich soll das besondere Interesse der Schülerschaft für naturwissenschaftliche Inhalte, Denk-
Lernbereich Naturwissenschaften Der Wahlpflichtbereich Der naturwissenschaftliche Unterricht im Wahlpflichtbereich soll das besondere Interesse der Schülerschaft für naturwissenschaftliche Inhalte, Denk-
Schulinternes Curriculum Physik
 Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe 7 Inhaltsfelder: Optische Instrumente, Farbzerlegung des Lichtes, Elektrizitätslehre Fachlicher Kontext / Dauer in Wo. Mit optischen Geräten Unsichtbares
Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe 7 Inhaltsfelder: Optische Instrumente, Farbzerlegung des Lichtes, Elektrizitätslehre Fachlicher Kontext / Dauer in Wo. Mit optischen Geräten Unsichtbares
Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung im Fach Politik Klasse 7 und 8
 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung im Fach Politik Klasse 7 und 8 Stand: November 2014 KR Grundlegendes: Das Fach Politik in der Realschule trägt dazu bei, dass die Lernenden politische, gesellschaftliche
Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung im Fach Politik Klasse 7 und 8 Stand: November 2014 KR Grundlegendes: Das Fach Politik in der Realschule trägt dazu bei, dass die Lernenden politische, gesellschaftliche
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Latein. 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen
 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Überfachliche Kompetenzen Selbsteinschätzung
 Überfachliche Kompetenzen Selbsteinschätzung Beim selbstorganisierten Lernen (SOL) sind neben Fachinhalten auch die sogenannt überfachlichen Kompetenzen wichtig, z.b. das Planen und Durchführen einer Arbeit,
Überfachliche Kompetenzen Selbsteinschätzung Beim selbstorganisierten Lernen (SOL) sind neben Fachinhalten auch die sogenannt überfachlichen Kompetenzen wichtig, z.b. das Planen und Durchführen einer Arbeit,
Fachcurriculum. BIOLOGIE Klassen 5 und 6
 Fachcurriculum BIOLOGIE Klassen 5 und 6 Ab Schuljahr 2004/05 Bilgie 5/6 Seite 1 Inhalte Kern- Schulcurriculumt Methdisch-didaktische Hinweise Kmpetenzschwerpunkte Themenbereich 1 Grundprinzipien des Lebens
Fachcurriculum BIOLOGIE Klassen 5 und 6 Ab Schuljahr 2004/05 Bilgie 5/6 Seite 1 Inhalte Kern- Schulcurriculumt Methdisch-didaktische Hinweise Kmpetenzschwerpunkte Themenbereich 1 Grundprinzipien des Lebens
Schulinterner Lehrplan. für das Fach. Biologie. (Sekundarstufe I Kurzversion)
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Biologie (Sekundarstufe I ) Jahrgangsstufe: 5 Schulinterner Lehrplan Biologie I. Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen I.I Was lebt in meiner Nachbarschaft? Artenkenntnis
Schulinterner Lehrplan für das Fach Biologie (Sekundarstufe I ) Jahrgangsstufe: 5 Schulinterner Lehrplan Biologie I. Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen I.I Was lebt in meiner Nachbarschaft? Artenkenntnis
Leistungsbewertungskonzept. Physik
 Leistungsbewertungskonzept Physik Stand: November 2014 Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 1 Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I... 3 1.1 Bewertung von
Leistungsbewertungskonzept Physik Stand: November 2014 Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 1 Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I... 3 1.1 Bewertung von
Vom Rahmenlehrplan zum Schulinternen Lehrplan in der Sekundarstufe II
 Vom Rahmenlehrplan zum Schulinternen Lehrplan in der Sekundarstufe II Vorgaben Ausstattung und Möglichkeiten Schülerinteresse und angestrebtes Leistungsniveau Besonderes Profil der Schule Grundsätzliches
Vom Rahmenlehrplan zum Schulinternen Lehrplan in der Sekundarstufe II Vorgaben Ausstattung und Möglichkeiten Schülerinteresse und angestrebtes Leistungsniveau Besonderes Profil der Schule Grundsätzliches
Vorgaben für die Abiturprüfung 2017
 Vorgaben für die Abiturprüfung 2017 in den Bildungsgängen des Beruflichen Gymnasiums Anlagen D 1 D 28 Profil bildender Leistungskurs Fach Maschinenbautechnik Fachbereich Technik mbt_pblk_tech_abivorgaben2017
Vorgaben für die Abiturprüfung 2017 in den Bildungsgängen des Beruflichen Gymnasiums Anlagen D 1 D 28 Profil bildender Leistungskurs Fach Maschinenbautechnik Fachbereich Technik mbt_pblk_tech_abivorgaben2017
6. Schuljahr (Entwurf) Thema der Unterrichtssequenz
 6. Schuljahr (Entwurf) Thema der Unterrichtssequenz Inhalt/kompetenzbezogene Sachverhalte Kompetenzbereiche Die Schülerinnen und Schüler können Schulinterne Absprachen (fakultativ) Inhaltsfeld Arbeit im
6. Schuljahr (Entwurf) Thema der Unterrichtssequenz Inhalt/kompetenzbezogene Sachverhalte Kompetenzbereiche Die Schülerinnen und Schüler können Schulinterne Absprachen (fakultativ) Inhaltsfeld Arbeit im
Lernaufgaben Sachunterricht
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein - Westfalen Lernaufgaben Sachunterricht Grundschule Natur und Leben Wie kann man Salz und Wasser trennen? I. Übersicht: Sachunterricht Bereich:
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein - Westfalen Lernaufgaben Sachunterricht Grundschule Natur und Leben Wie kann man Salz und Wasser trennen? I. Übersicht: Sachunterricht Bereich:
Leistungsbewertung im Fach Chemie
 1 Unterscheidung: Beobachtung - Erklärung vermischen Beobachtung und Erklärung in der Beschreibung von Phänomenen und Vorgängen trennen teilweise zwischen Beobachtung und Erklärung trennen klar zwischen
1 Unterscheidung: Beobachtung - Erklärung vermischen Beobachtung und Erklärung in der Beschreibung von Phänomenen und Vorgängen trennen teilweise zwischen Beobachtung und Erklärung trennen klar zwischen
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Schulinternes Curriculum für das Fach Physik Klasse 8
 Gesamtschule Brüggen. Schulinternes Curriculum für das Fach Physik Klasse 8 Unterrichtseinheit: Kraft und mechanische Energie Zeitbedarf: erstes Schulhalbjahr Skizze der Unterrichtseinheit und Schwerpunkte
Gesamtschule Brüggen. Schulinternes Curriculum für das Fach Physik Klasse 8 Unterrichtseinheit: Kraft und mechanische Energie Zeitbedarf: erstes Schulhalbjahr Skizze der Unterrichtseinheit und Schwerpunkte
Schulcurriculum Erdkunde Stufe 6
 Schulcurriculum Erdkunde Stufe 6 Erdkunde wird in der Stufe 6 einstündig (60 Minuten) unterrichtet. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf der Orientierung der Erde und das Erkunden des Nahraums.
Schulcurriculum Erdkunde Stufe 6 Erdkunde wird in der Stufe 6 einstündig (60 Minuten) unterrichtet. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf der Orientierung der Erde und das Erkunden des Nahraums.
CURRICULUM AUS NATURWISSENSCHAFTEN Biologie und Erdwissenschaften 1. Biennium FOWI
 Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der Biologie, Chemie und Erdwissenschaften soll den SchülerInnen eine naturwissenschaftliche Grundausbildung ermöglichen. Sie können sich mit naturwissenschaftliche
Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der Biologie, Chemie und Erdwissenschaften soll den SchülerInnen eine naturwissenschaftliche Grundausbildung ermöglichen. Sie können sich mit naturwissenschaftliche
biotischen Umweltfaktoren im Ökosystem Wald (Auswahl) Gewässer als Ökosysteme Projekt: Der See als Ökosystem gewusst gekonnt...
 Inhaltsverzeichnis Bio 9 /10 3 Inhaltsverzeichnis 1 Ökologie... 8 1.1 Struktur und Vielfalt von Ökosystemen... 9 1 Lebensraum und abiotische Umweltfaktoren... 10 Lebensraum und biotische Umweltfaktoren...
Inhaltsverzeichnis Bio 9 /10 3 Inhaltsverzeichnis 1 Ökologie... 8 1.1 Struktur und Vielfalt von Ökosystemen... 9 1 Lebensraum und abiotische Umweltfaktoren... 10 Lebensraum und biotische Umweltfaktoren...
Lehrplan Biologie Jahrgangsstufe 5/6 (ab 2008/09)
 Basiskonzepte:Variabilität, Information und Kommunikation, System Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen Unterkontext: Was lebt in meiner Nachbarschaft? Inhaltsfelder: Umfang: ca. Std
Basiskonzepte:Variabilität, Information und Kommunikation, System Kontext: Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen Unterkontext: Was lebt in meiner Nachbarschaft? Inhaltsfelder: Umfang: ca. Std
Themen im Jahrgang 5 Oberschule.
 B B I O L O G I E Themen im Jahrgang 5 Oberschule. PRISMA Biologie 5/6 Niedersachsen Differenzierende Ausgabe, Klett Verlag Unterrichtserteilung: 2 Stunden pro Woche / ganzjährig Womit beschäftigt sich
B B I O L O G I E Themen im Jahrgang 5 Oberschule. PRISMA Biologie 5/6 Niedersachsen Differenzierende Ausgabe, Klett Verlag Unterrichtserteilung: 2 Stunden pro Woche / ganzjährig Womit beschäftigt sich
Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q1: Ökologie
 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q1: Ökologie Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen 3.1 Lebewesen und Umwelt Ökologische und Präferenz Ökologische (SF) planen ausgehend von
Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q1: Ökologie Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen 3.1 Lebewesen und Umwelt Ökologische und Präferenz Ökologische (SF) planen ausgehend von
Kompetenzorientierung im Chemieunterricht
 Kompetenzorientierung im Chemieunterricht gerhard.kern@univie.ac.at http://aeccc.univie.ac.at 1 Ablauf Ausgangspunkt: Neue Matura Fokus: Unterricht Gesetzliche Grundlagen, Begriffsbestimmungen Kompetenzmodell
Kompetenzorientierung im Chemieunterricht gerhard.kern@univie.ac.at http://aeccc.univie.ac.at 1 Ablauf Ausgangspunkt: Neue Matura Fokus: Unterricht Gesetzliche Grundlagen, Begriffsbestimmungen Kompetenzmodell
Kerncurriculum. Klasse 7 Thema/Inhalt Kompetenzen FW & EG Kompetenzen BW & KK. Zelle & Fotosynthese
 Bio 7 Kerncurriculum Klasse 7 Thema/Inhalt Kompetenzen FW & EG Kompetenzen BW & KK Zelle & Fotosynthese Von der Zelle zum Organismus Bau des Mikroskops Mikroskopieren: Wasserpest u./o. Zwiebel, Mundschleimhaut
Bio 7 Kerncurriculum Klasse 7 Thema/Inhalt Kompetenzen FW & EG Kompetenzen BW & KK Zelle & Fotosynthese Von der Zelle zum Organismus Bau des Mikroskops Mikroskopieren: Wasserpest u./o. Zwiebel, Mundschleimhaut
Didaktisches Modell: Zielsetzung
 Ergänzung der BO-Handreichung: Einordnung nach Seite 65 (3.4.1 Das neue Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung ) Wirtschaft/Studien- und Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1 1 Didaktisches
Ergänzung der BO-Handreichung: Einordnung nach Seite 65 (3.4.1 Das neue Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung ) Wirtschaft/Studien- und Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1 1 Didaktisches
 NwT 9: Wald Pflanzen und Tiere Ökosystem Wald und Mensch Nutzung Naturschutz Artenkenntnis, Artenvielfalt; Wechselbeziehungen Waldformen, Biotope, Anpassungen von Pfl. u. Tieren; Nahrungsketten, Energiekreisläufe
NwT 9: Wald Pflanzen und Tiere Ökosystem Wald und Mensch Nutzung Naturschutz Artenkenntnis, Artenvielfalt; Wechselbeziehungen Waldformen, Biotope, Anpassungen von Pfl. u. Tieren; Nahrungsketten, Energiekreisläufe
Schulinternes Curriculum Naturwissenschaften Klassenstufe 5 Aufbau des Körpers Skelett Fachbegriffe/ Fachinhalte
 Aufbau des Körpers Skelett Fachbegriffe/ Fachinhalte Beispiele für Unterrichtsthemen Schwerpunkte der Kompetenzförderung (Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewerten) Unterrichtsmethoden Diagnose/
Aufbau des Körpers Skelett Fachbegriffe/ Fachinhalte Beispiele für Unterrichtsthemen Schwerpunkte der Kompetenzförderung (Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewerten) Unterrichtsmethoden Diagnose/
Fach : Biologie Klasse 5. Kerncurriculum Schulcurriculum Hinweise
 Fach : Biologie Klasse 5 Grundprinzipien des Lebens Säugetiere - Hund oder Katze - ein weiteres Haustier Grundlegende Vorgänge der Entwicklung und Fortpflanzung des Menschen / Pubertät Fische Amphibien
Fach : Biologie Klasse 5 Grundprinzipien des Lebens Säugetiere - Hund oder Katze - ein weiteres Haustier Grundlegende Vorgänge der Entwicklung und Fortpflanzung des Menschen / Pubertät Fische Amphibien
